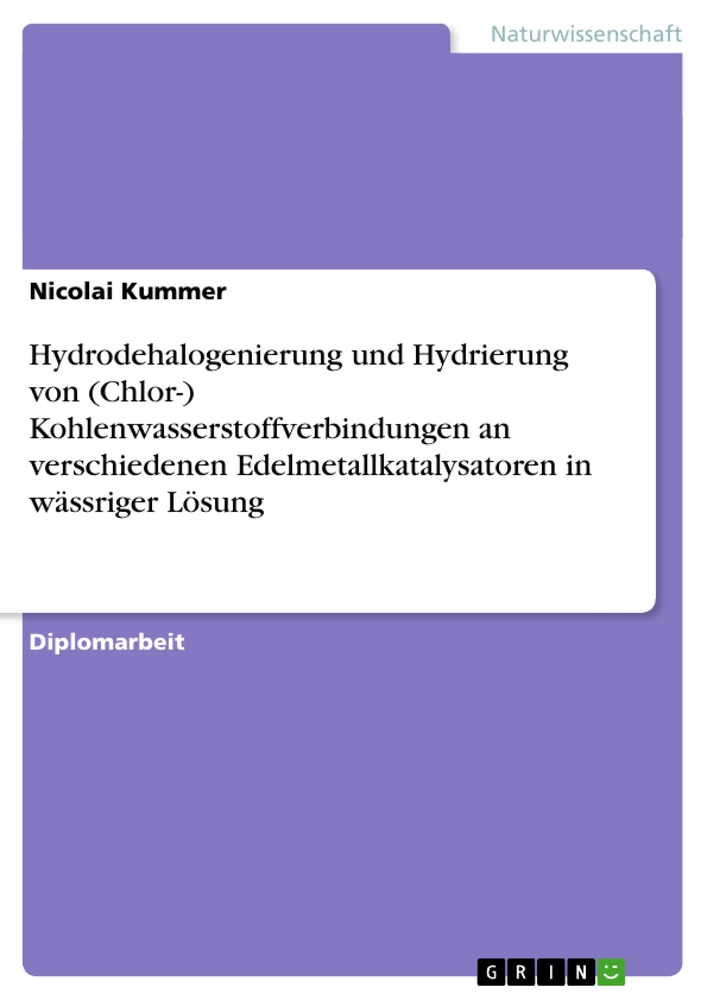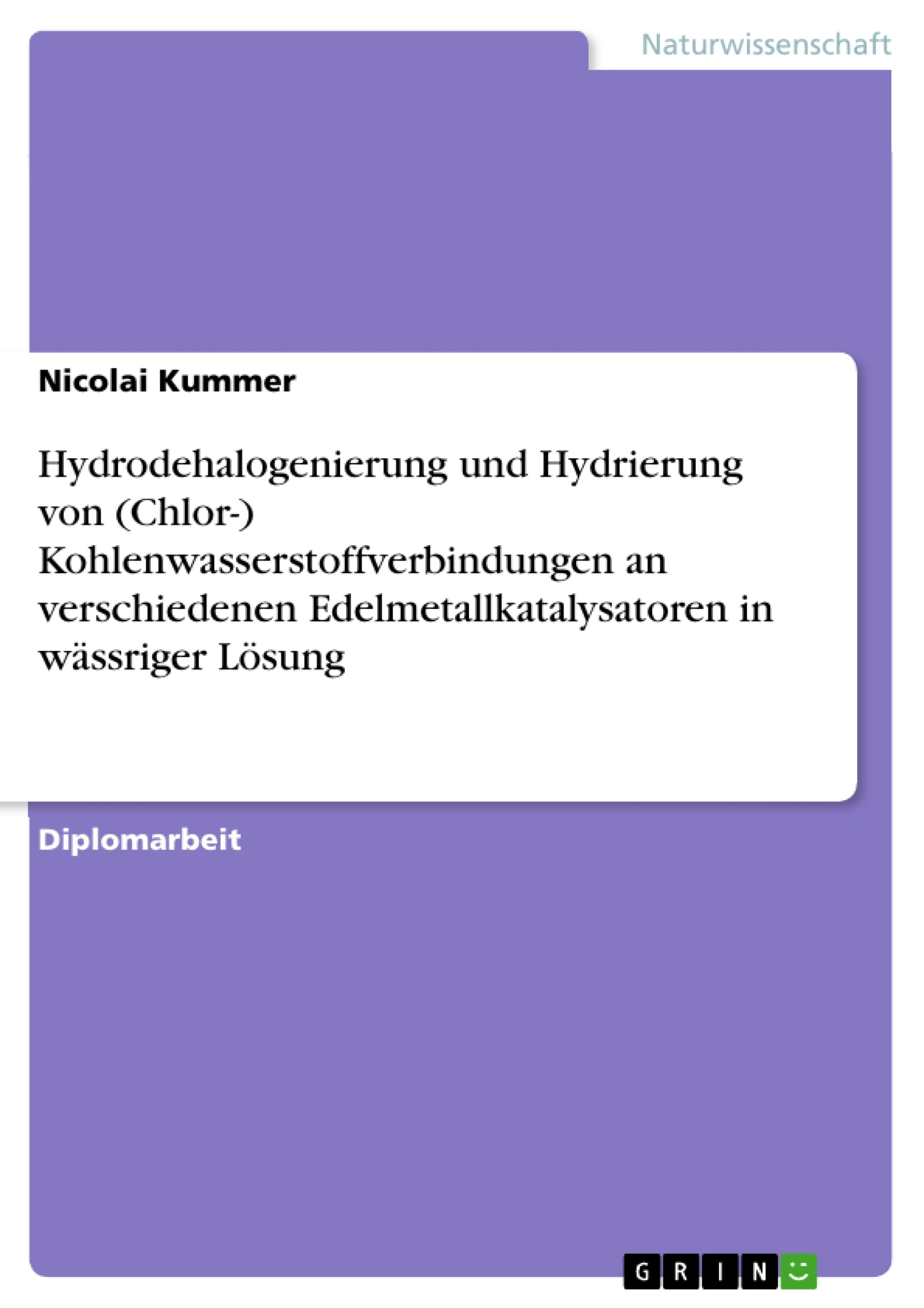1.1 Problemstellung [1, 2, 3, 4, 5]
Die Toxizität und teilweise auch cancerogenen Eigenschaften chlorierter Kohlenwasserstoffe (CKW)
und polycyclischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) sind seit langem bekannt. Der Eintrag der
Substanzen in die Umwelt erfolgt überwiegend anthropogen.
Während man bis 1978 noch der Ansicht war, dass nur die Atmosphäre, das Erdreich und das
Oberfächenwasser, nicht aber das Grundwasser mit derartigen organischen Substanzen belastet sind [1,
5], wurden in den letzten Jahren diese Verbindungen vermehrt im Grundwasser nachgewiesen. Das ist
einerseits bedingt durch die bessere Spurenanalytik - Nachweis einzelner Schadstoffe bis in den
Pikogrammbereich (1 pg/l = 10-12 g/l) - andererseits durch den nach wie vor hohen Eintrag dieser
Substanzen vor allem in den Boden und die Atmosphäre. Insbesondere im Bereich von
Gewerbebetrieben (z.B. chemischen Reinigungen, metallverarbeitenden Firmen und Mineralölfirmen),
Verbrennungsanlagen, Mülldeponien, u.a. können diese Schadstoffe in erhöhten Konzentrationen
auftreten. Weitere Quellen sind Waldbrände, der Kraftfahrzeugverkehr und Heizungsanlagen.
1.2. Eintrag der Schadstoffe in das Grundwasser [2, 3]
Inwieweit diese Substanzen in das Grundwasser gelangen, hängt von der Mobilität dieser Stoffe im
Boden ab, die wiederum durch folgende Faktoren beeinflusst wird:
a) Wasserlöslichkeit der Schadstoffe: wasserlösliche (hydrophile) Stoffe werden leichter mit dem
Bodenwasser in tiefere Bodenschichten verlagert und stellen deshalb eine größere Gefährdung für
das Grundwasser dar als hydrophobe Substanzen.
b) Adsorptionseigenschaften der Schadstoffe und der Bodenpartikel: Je weniger die Schadstoffe von
den Bodenpartikeln adsorbiert werden, um so leichter können sie ins Grundwasser gelangen. Die
Adsorptionsfähigkeit des Bodens hängt stark vom Humus- bzw. Kohlenstoffgehalt des Bodens ab.
Zu beachten ist, dass die an Huminstoffe (Þ Bestandteil des Humus) adsorbierten Schadstoffe nicht
automatisch immobil sind, da die Huminstoffe (wie z.B. die Fulvosäuren) teilweise selbst
wasserlöslich sind und die daran adsorbierten Schadstoffe samt den Huminstoffen in tiefere Schichten
transportiert werden können. Weiterhin ist auch die eingetragene Schadstoffmenge im Verhältnis zur
Adsorptionskapazität entscheidend.
c) Wassergehalt des Bodens: Ist kaum Wasser im Boden vorhanden, so werden selbst gut
wasserlösliche Schadstoffe nur langsam in tiefere Schichten verlagert.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Eintrag der Schadstoffe in das Grundwasser
- 1.3 Sanierungsverfahren
- 1.4 Aufgabenstellung und Zielsetzung
- 2 Grundlagen der Katalyse
- 2.1 Definition eines Katalysators
- 2.2 Einteilung der Katalysatoren
- 2.3 Heterogene Katalyse
- 2.3.1 Adsorption - Unterscheidung in Physisorption und Chemisorption
- 2.3.2 Bedeckungsgrad und Adsorptionsisothermen
- 2.3.3 Mechanismen zum Aufstellen von Geschwindigkeitsgleichungen
- 2.3.4 Energetische Aspekte der heterogenen Katalyse
- 3 Material und Methoden
- 3.1 Auswahl und Charakterisierung der Katalysatoren
- 3.1.1 Auswahl der Katalysatoren
- 3.1.2 Charakterisierung der eingesetzten Katalysatoren
- 3.2 Charakterisierung der Schadstoffklassen
- 3.2.1 Monozyklische aromatische Chlorkohlenwasserstoffe
- 3.2.2 PAK
- 3.2.2 PCB
- 3.2.4 Leichtflüchtige aliphatische Chlorkohlenwasserstoffe (LCKW)
- 3.3 Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung
- 3.4 Analyse der Proben mittels GC/FID bzw. GC/MS
- 3.4.1 Analyse der Proben beim Abbau von 1,2-Dichlorbenzol, Naphthalin und 4-Chlorbiphenyl mittels GC/MS
- 3.4.2 Analyse der Gasphasenproben beim Abbau von PCE mittels GC/FID
- 3.4.3 Erläuterungen zur Vorgehensweise bei der Analyse der Proben mittels GC/MS
- 3.4.4 Quantifizierung mittels externem und internem Standard
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Abbau von 1,2-Dichlorbenzol
- 4.1.1 Abbau von 1,2 Dichlorbenzol an Pd/γ-Al₂O₃
- 4.1.2 Abbau von 1,2 Dichlorbenzol an Pt/γ-Al₂O₃
- 4.1.3 Abbau von 1,2 Dichlorbenzol an Rh/γ-Al₂O₃
- 4.1.4 Abbau von 1,2 Dichlorbenzol an Ru/γ-Al₂O₃
- 4.2 Abbau von 4-Chlorbiphenyl
- 4.2.1 Abbau von 4-Chlorbiphenyl an Pd/γ-Al₂O₃
- 4.2.2 Abbau von 4-Chlorbiphenyl an Pt/γ-Al₂O₃
- 4.2.3 Abbau von 4-Chlorbiphenyl an Rh/γ-Al₂O₃
- 4.2.4 Abbau von 4-Chlorbiphenyl an Ru/γ-Al₂O₃
- 4.3 Abbau von Naphthalin
- 4.3.1 Abbau von Naphthalin an Pd/γ-Al₂O₃
- 4.3.2 Abbau von Naphthalin an Pt/γ-Al₂O₃
- 4.3.3 Abbau von Naphthalin an Rh/γ-Al₂O₃
- 4.3.4 Abbau von Naphthalin an Ru/γ-Al₂O₃
- 4.4 Abbau von PCE
- 4.4.1 Abbau von PCE an Pd/γ-Al₂O₃
- 4.4.2 Abbau von PCE an Pt/γ-Al₂O₃
- 4.4.3 Abbau von PCE an Rh/γ-Al₂O₃
- 4.4.4 Abbau von PCE an Ru/γ-Al₂O₃
- 5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
- 5.1 Vergleich der Katalysatoren
- 5.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die hydrodehalogenierenden und hydrierenden Eigenschaften verschiedener Edelmetallkatalysatoren in wässriger Lösung. Das Hauptziel besteht in der Evaluierung des Abbauverhaltens verschiedener chlorierter Kohlenwasserstoffe unter katalytischen Bedingungen. Die Arbeit trägt zum Verständnis der Anwendbarkeit solcher Katalysatoren bei der Sanierung von kontaminierten Grundwasserleitern bei.
- Katalytische Abbauprozesse von chlorierten Kohlenwasserstoffen
- Vergleichende Untersuchung verschiedener Edelmetallkatalysatoren (Pd, Pt, Rh, Ru)
- Einfluss der Katalysator-Eigenschaften auf die Abbaueffizienz
- Charakterisierung der verwendeten Katalysatoren und Schadstoffe
- Entwicklung und Anwendung analytischer Methoden (GC/MS, GC/FID)
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Kontamination von Grundwasser durch chlorierte Kohlenwasserstoffe ein. Es beschreibt die Problemstellung, die Einträge der Schadstoffe, gängige Sanierungsverfahren und definiert die Aufgabenstellung und die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit. Die Bedeutung der Entwicklung effizienter Sanierungsmethoden wird hervorgehoben, insbesondere im Hinblick auf die langfristige Gefährdung von Grundwasserressourcen durch persistent organische Schadstoffe.
2 Grundlagen der Katalyse: Dieses Kapitel liefert die notwendigen Grundlagen der Katalyse, insbesondere der heterogenen Katalyse. Es definiert den Begriff Katalysator, beschreibt verschiedene Einteilungen und detailliert die Mechanismen der heterogenen Katalyse. Besondere Aufmerksamkeit wird der Adsorption (Physisorption und Chemisorption), dem Bedeckungsgrad, Adsorptionsisothermen und den energetischen Aspekten gewidmet. Dieses Kapitel bildet die theoretische Basis für das Verständnis der experimentellen Ergebnisse.
3 Material und Methoden: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Materialien und Methoden, die in der Arbeit verwendet wurden. Es beinhaltet die Auswahl und Charakterisierung der Edelmetallkatalysatoren (Pd, Pt, Rh, Ru auf γ-Al₂O₃ Trägermaterial), die Charakterisierung der verschiedenen Schadstoffklassen (monozyklische aromatische Chlorkohlenwasserstoffe, PAKs, PCBs, LCKWs), den Versuchsaufbau, die Versuchsdurchführung sowie die analytischen Methoden (GC/FID und GC/MS) inklusive der Quantifizierung mittels externer und interner Standards. Die umfassende Beschreibung der Methodik ermöglicht die Reproduzierbarkeit der Experimente.
4 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Abbauversuche für 1,2-Dichlorbenzol, 4-Chlorbiphenyl, Naphthalin und PCE an den verschiedenen Edelmetallkatalysatoren (Pd/γ-Al₂O₃, Pt/γ-Al₂O₃, Rh/γ-Al₂O₃, Ru/γ-Al₂O₃). Die detaillierte Darstellung der einzelnen Abbauversuche ermöglicht einen direkten Vergleich der Katalysatoraktivitäten und erlaubt die Identifizierung von Trends und Zusammenhängen zwischen Katalysatormaterial und Abbaueffizienz. Die Ergebnisse werden mit Tabellen und Grafiken veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Hydrodehalogenierung, Hydrierung, Edelmetallkatalysatoren, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Grundwasser, heterogene Katalyse, Adsorption, GC/MS, GC/FID, Pd, Pt, Rh, Ru, γ-Al₂O₃, 1,2-Dichlorbenzol, 4-Chlorbiphenyl, Naphthalin, PCE.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Katalytischer Abbau chlorierter Kohlenwasserstoffe
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den katalytischen Abbau verschiedener chlorierter Kohlenwasserstoffe in wässriger Lösung mithilfe verschiedener Edelmetallkatalysatoren. Das Hauptziel ist die Evaluierung des Abbauverhaltens und die Anwendbarkeit dieser Katalysatoren zur Sanierung kontaminierter Grundwasserleiter.
Welche Katalysatoren wurden untersucht?
Die Arbeit vergleicht die Wirksamkeit von Edelmetallkatalysatoren auf Basis von Palladium (Pd), Platin (Pt), Rhodium (Rh) und Ruthenium (Ru), jeweils auf einem γ-Al₂O₃ Trägermaterial.
Welche chlorierten Kohlenwasserstoffe wurden untersucht?
Die untersuchten Schadstoffe umfassen 1,2-Dichlorbenzol, 4-Chlorbiphenyl, Naphthalin und Perchlorethylen (PCE). Die Arbeit betrachtet auch breitere Klassen wie monozyklische aromatische Chlorkohlenwasserstoffe, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und polychlorierte Biphenyle (PCB).
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Auswahl und Charakterisierung der Katalysatoren und Schadstoffe. Der Versuchsaufbau und die Versuchsdurchführung werden ebenso erläutert wie die verwendeten analytischen Methoden: Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektor (GC/FID) und Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC/MS), inklusive der Quantifizierung mittels externer und interner Standards.
Wie sind die Ergebnisse strukturiert?
Die Ergebnisse werden kapitelweise nach den untersuchten Schadstoffen (1,2-Dichlorbenzol, 4-Chlorbiphenyl, Naphthalin und PCE) und den jeweiligen Katalysatoren (Pd/γ-Al₂O₃, Pt/γ-Al₂O₃, Rh/γ-Al₂O₃, Ru/γ-Al₂O₃) dargestellt. Tabellen und Grafiken veranschaulichen die Abbaueffizienzen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Zusammenfassung vergleicht die Wirksamkeit der verschiedenen Katalysatoren und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsrichtungen. Es wird ein umfassender Vergleich der Katalysatoraktivitäten hinsichtlich des Abbaus der verschiedenen Schadstoffe präsentiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hydrodehalogenierung, Hydrierung, Edelmetallkatalysatoren, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Grundwasser, heterogene Katalyse, Adsorption, GC/MS, GC/FID, Pd, Pt, Rh, Ru, γ-Al₂O₃, 1,2-Dichlorbenzol, 4-Chlorbiphenyl, Naphthalin, PCE.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Kapitel 2 bietet eine detaillierte Einführung in die Grundlagen der Katalyse, insbesondere der heterogenen Katalyse. Es werden Konzepte wie Adsorption (Physisorption und Chemisorption), Bedeckungsgrad, Adsorptionsisothermen und energetische Aspekte der heterogenen Katalyse erläutert.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Abbauversuchen?
Kapitel 4, "Ergebnisse", bietet eine detaillierte Darstellung der einzelnen Abbauversuche für jeden Schadstoff und jeden Katalysator. Die Ergebnisse werden mit Tabellen und Grafiken veranschaulicht.
Welche Bedeutung hat die Arbeit für die Grundwassersanierung?
Die Arbeit trägt zum Verständnis der Anwendbarkeit von Edelmetallkatalysatoren bei der Sanierung von mit chlorierten Kohlenwasserstoffen kontaminierten Grundwasserleitern bei. Die Ergebnisse können zur Entwicklung effizienter Sanierungsmethoden beitragen.
- Quote paper
- Nicolai Kummer (Author), 1998, Hydrodehalogenierung und Hydrierung von (Chlor-) Kohlenwasserstoffverbindungen an verschiedenen Edelmetallkatalysatoren in wässriger Lösung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16933