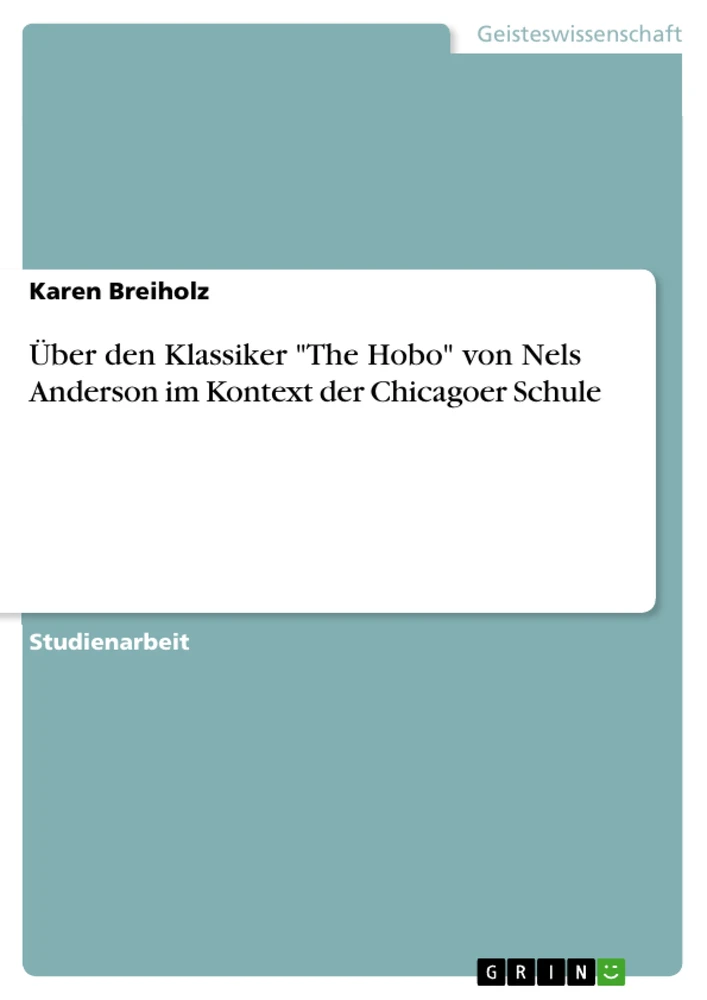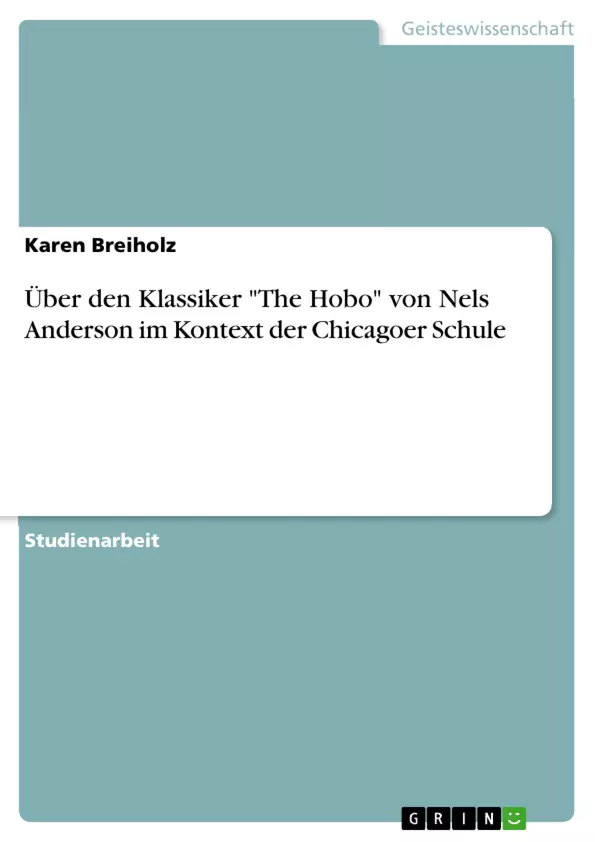Zu Ehren des 1986 verstorbenen Soziologen Nels Anderson fand im Jahr 2008 eine Forschungskonferenz mit dem Namen „25th Qualitive Analysis Conference – Qualitive 2008: The Chicago School & Beyond“ statt. Das Bemühen, den wissenschaftlichen Ansatz Andersons wiederaufleben zu lassen, ist für den heutigen Forschungsstand der Stadtanthropologie bezeichnend, wenn man sich vergegenwärtigt, dass sein erstes Buch „The Hobo. The Sociology of the Homeless Man“ bereits 1923 erstmalig publiziert wurde.
Um mit Lindner gesprochen dem „Chicago Touch“ nachzuspüren, muss man sich Andersons Stellenwert innerhalb der „Chicago School of Sociology“, in der er unter Robert Ezra Park forschend tätig war, vergegenwärtigen. Wie äußerte sich das Wirken von Andersons ethnographischem Erstlingswerk innerhalb der Chicago School und welche Aspekte machen die Verbindung zu Parks Schrift „The City“ deutlich, die er 1925 veröffentlichte?
Andersons Arbeit über amerikanische Wanderarbeiter des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, die Hobos, wird heute von Kulturanthropologen als einer der ersten Beiträge zur Stadtforschung angesehen. Insbesondere die deutsche Volkskunde, die zurückgehend auf Wilhelm Heinrich Riehl viele Jahre eine Bauernkunde, also die Erforschung des Landlebens betrieben hatte, begab sich mit der Institutionalisierung der Stadt als Forschungsraum seit den späten 1980er, frühen 1990er Jahren auf fachliches Neuland, das unter anderem auch durch die Rezeption und Aufarbeitung der Chicagoer Soziologenschule geprägt war.
Die für die frühen 1920er Jahre besondere Vorgehensweise Andersons, nämlich sich seinem Forschungssubjekt in teilnehmender Beobachtung anzunähern, gilt in der Europäischen Ethnologie nach wie vor als Pionierarbeit im Sinne der Vorbereitung der inzwischen längst etablierten qualitativen Forschungsmethoden unserer Fachdisziplin.
In „The Hobo“ beschreibt und analysiert Anderson, welche Erfahrungen er mit den Hobos machte, die er im Rahmen eines von Park angelegten Forschungsprojektes untersuchte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Basis Andersons: Parks Konzeption einer Stadtforschung
- 3 Andersons beispielhafte Großstadtstudie über den Hobo
- 3.1 Zum Vorverständnis
- 3.2 Zur Methode
- 3.3 Die Studie im Einzelnen
- 3.3.1 Ein Überblick über Hobohemia
- 3.3.2 Der Jungle
- 3.3.3 Überlebensstrategien in Hobohemia
- 3.3.4 Gründe für das Leben als Hobo
- 4 Schlussbemerkung: „The Hobo“ – Warum ein Klassiker?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Arbeit des Soziologen Nels Anderson „The Hobo. The Sociology of the Homeless Man“ im Kontext der Chicagoer Schule. Er analysiert Andersons Forschungsansatz und dessen Bedeutung für die Stadtforschung. Zudem werden die Verbindungen zu Parks Konzeption einer Stadtforschung, die in seinem Werk „The City“ beschrieben wird, untersucht.
- Die Relevanz von Andersons Arbeit „The Hobo“ für die Entwicklung der Stadtforschung
- Die Anwendung von teilnehmender Beobachtung als qualitative Forschungsmethode
- Der Vergleich von Andersons Ansatz mit der traditionellen Stadtforschung
- Die Bedeutung der Chicagoer Schule für die Entwicklung der Stadtanthropologie
- Der Einfluss von Parks Konzeption einer Stadtforschung auf Andersons Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Die Einleitung stellt den Soziologen Nels Anderson und sein Werk „The Hobo“ vor. Es wird die Bedeutung von Andersons Arbeit für die Stadtanthropologie und die Verbindung zu Parks „Chicago School of Sociology“ hervorgehoben.
2 Basis Andersons: Parks Konzeption einer Stadtforschung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Parks Konzept der Stadtforschung, welches sich in seinem Werk „The City“ niederschlägt. Park plädiert für die Erforschung des menschlichen Verhaltens im urbanen Kontext und betont die Notwendigkeit, die Stadt nicht nur als physischen Raum, sondern auch als kulturelles Phänomen zu begreifen.
3 Andersons beispielhafte Großstadtstudie über den Hobo
Dieses Kapitel analysiert Andersons Großstadtstudie über den Hobo. Es wird auf die Methoden, die Durchführung und die Ergebnisse der Studie eingegangen. Dabei werden die unterschiedlichen Typen der Wanderarbeiter, die Herausforderungen des Lebens in Hobohemia und die Gründe für das Leben als Hobo näher betrachtet.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Nels Anderson und was ist sein Werk „The Hobo“?
Nels Anderson war ein Soziologe der Chicagoer Schule; sein 1923 veröffentlichtes Werk „The Hobo“ gilt als eine der ersten bedeutenden ethnographischen Studien zur Obdachlosigkeit.
Was zeichnet die Forschungsmethode von Anderson aus?
Anderson nutzte die „teilnehmende Beobachtung“, indem er selbst als Teil der Hobo-Gemeinschaft lebte, um authentische Einblicke in deren Alltag und Kultur zu erhalten.
Was bedeutet der Begriff „Hobohemia“?
Hobohemia bezeichnet den urbanen Lebensraum und die Subkultur der Wanderarbeiter und Obdachlosen in den Großstädten, insbesondere in Chicago.
Wie hängen Anderson und Robert Ezra Park zusammen?
Anderson forschte unter Park, der mit seinem Werk „The City“ die theoretische Basis für die Stadtsoziologie der Chicagoer Schule legte.
Warum gilt „The Hobo“ heute als Klassiker?
Es gilt als Pionierarbeit der qualitativen Forschung und Stadtanthropologie, da es die Stadt erstmals als komplexen kulturellen Forschungsraum jenseits der Bauernkunde begriff.
- Citar trabajo
- Karen Breiholz (Autor), 2010, Über den Klassiker "The Hobo" von Nels Anderson im Kontext der Chicagoer Schule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169387