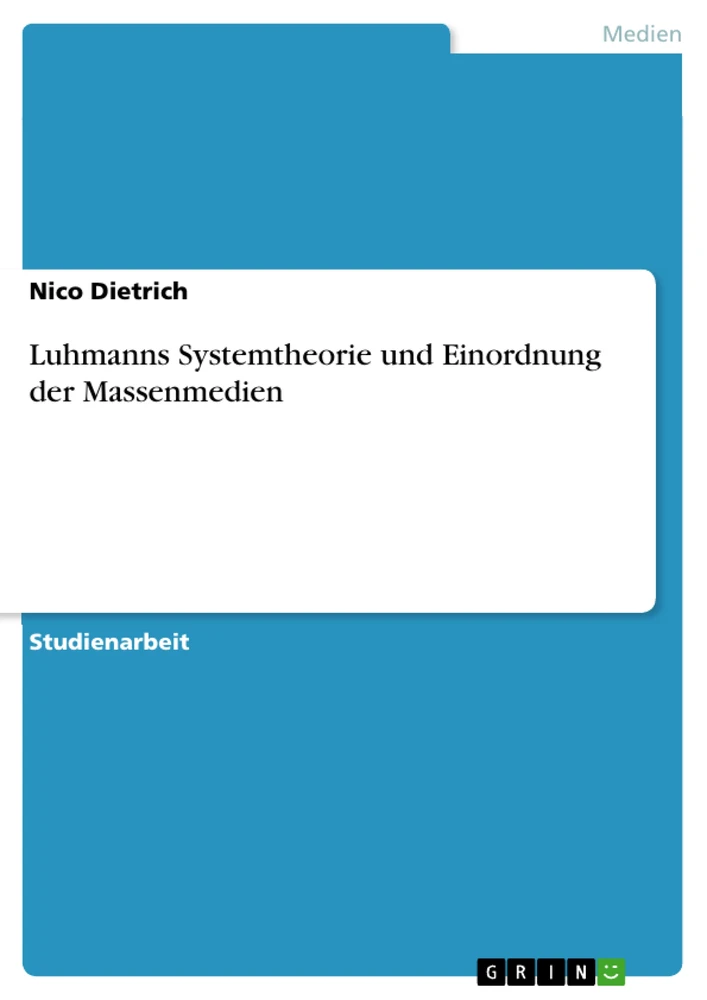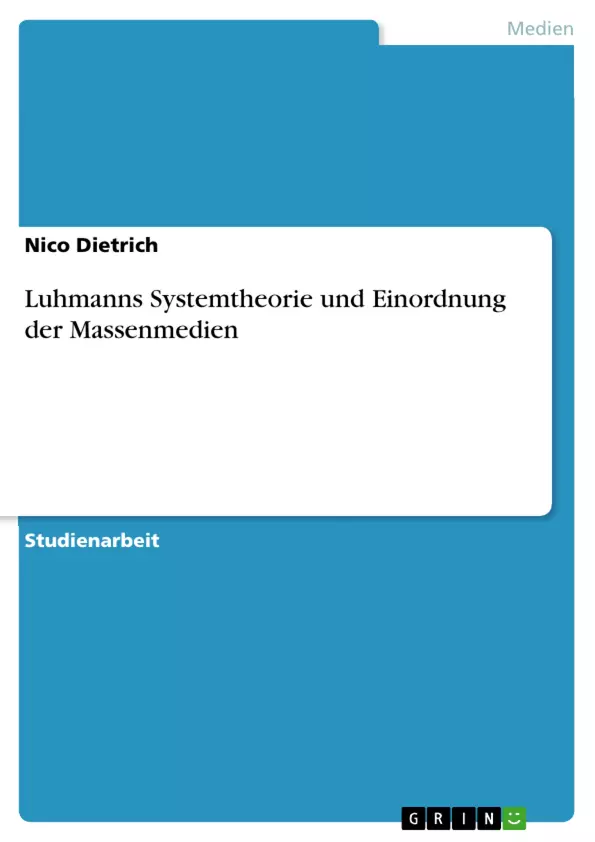„Niklas Luhmann, der Beobachter der Gesellschaft im Ausguck der Wissenschaft“ (Boehm u. Strauch 1989), gilt als der „produktivste und originellste unter den theoretischen Soziologen in der Bundesrepublik.“ (dpa 1988 nach Horster 2005, S. 193). Bekanntheit erlangte der studierte Rechtswissenschaftler vor allem durch seine Weiterentwicklung der Systemtheorie und der damit verbundenen wissenschaftlichen Debatte. Kaum eine andere Theorie erhebt den größtmöglichen Anspruch, die gesamte Gesellschaft inklusive sich selbst beschreiben zu wollen. In 29 Jahren entwickelte Luhmann eine komplexe Systemtheorie, die um einiges abstrakter und komplexer daherkommt als alle älteren Ansätze.
Geprägt von chaotischen Nachkriegserfahrungen und britischer Kriegsgefangenschaft, fand der gebürtige Lüneburger fortan Befriedigung in der Herstellung von Ordnung und strebte zunächst eine Karriere in der Verwaltung an, bevor er sich der Wissenschaft widmete. Der Ordnungssinn Luhmanns spiegelt sich in seinem Zettelkasten-System, das die Grundlage seiner immensen Produktivität birgt, wider (vgl. Berghaus 2004, S. 14). So beachtlich Luhmanns Leistung auch ist, seine Systemtheorie wurde Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen und spaltet bis heute die soziologische Welt. Jürgen Habermas, mit dem Luhmann 1971 Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie veröffentlichte, gilt als einer der größten Kritiker. Obgleich sich beide Sozialwissenschaftler auf die gleichen Ursprünge beziehen, entwickelten sie sehr verschiedene Ansätze und scheuten die gegenseitige Kritik nicht.
Die folgende Arbeit soll Niklas Luhmanns Systemtheorie näher beleuchten, zentrale Begriffe klären und zueinander in Beziehung setzen. Des Weiteren wird der Schwerpunkt auf den Massenmedien als System liegen. Der zweite Teil wird sich kritisch mit der Theorie auseinander setzen und die Einordnung der Massenmedien aus verschiedenen Perspektiven untersuchen, bevor Fazit und Ausblick die Niederschrift abrunden. Aufgrund der relativen Kürze dieser Arbeit, muss eine umfassende Abhandlung der Luhmann’schen Theorie außen vor bleiben. Beziehungen zwischen den Systemen sollen deswegen weitgehend ausgeblendet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Luhmanns Systemtheorie
- 2.1 Eine Welt aus Systemen
- 2.2 Soziale Systeme
- 2.3 Die Massenmedien – Ein System?
- 3. Kritische Betrachtung
- 4. Fazit und Ausblick
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Niklas Luhmanns Systemtheorie und untersucht die Einordnung der Massenmedien in dieses theoretische Konzept. Das Ziel ist es, die wichtigsten Elemente der Luhmannschen Systemtheorie zu erläutern, die Rolle der Massenmedien in diesem Kontext zu beleuchten und kritische Aspekte der Theorie zu diskutieren.
- Systemtheorie als umfassendes Konzept der Gesellschaft
- Die Funktion der Massenmedien in sozialen Systemen
- Kritik an Luhmanns Systemtheorie
- Die Bedeutung von Systemgrenzen und -differenzierung
- Die Rolle von Kommunikation und Beobachtung in sozialen Systemen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Einordnung der Massenmedien in Niklas Luhmanns Systemtheorie und skizziert den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 führt in die Grundzüge der Systemtheorie ein, beleuchtet die Konzepte der „Welt aus Systemen“, der sozialen Systeme und der Massenmedien als System. Kapitel 3 befasst sich kritisch mit den verschiedenen Perspektiven der Systemtheorie, insbesondere im Hinblick auf die Einordnung der Massenmedien.
Schlüsselwörter
Systemtheorie, Niklas Luhmann, Massenmedien, Kommunikation, soziale Systeme, Autopoiesis, Beobachtung, Selbstreferenz, Systemdifferenzierung, Kritik, Einordnung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Luhmanns Systemtheorie?
Luhmann beschreibt die Gesellschaft als ein Geflecht aus autopoietischen Systemen, die sich durch Kommunikation erhalten und von ihrer Umwelt abgrenzen.
Warum gelten Massenmedien als eigenständiges soziales System?
Massenmedien operieren nach einem eigenen Code (Information/Nicht-Information) und erzeugen eine spezifische Realität, die für die gesamte Gesellschaft als Beobachtungsgrundlage dient.
Was bedeutet „Autopoiesis“ in sozialen Systemen?
Autopoiesis bezeichnet die Eigenschaft von Systemen, sich selbst aus ihren eigenen Elementen (bei sozialen Systemen: Kommunikationen) immer wieder neu zu produzieren.
Wer war Niklas Luhmanns größter wissenschaftlicher Kritiker?
Jürgen Habermas gilt als einer der bedeutendsten Kritiker. Er debattierte mit Luhmann intensiv über die Grundlagen der Gesellschaftstheorie und den Stellenwert von Subjektivität.
Was ist das „Zettelkasten-System“ von Luhmann?
Es war Luhmanns Methode der Wissensorganisation, die es ihm ermöglichte, komplexe Zusammenhänge über Jahrzehnte hinweg zu vernetzen und eine enorme wissenschaftliche Produktivität zu erzielen.
- Citation du texte
- Nico Dietrich (Auteur), 2010, Luhmanns Systemtheorie und Einordnung der Massenmedien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169397