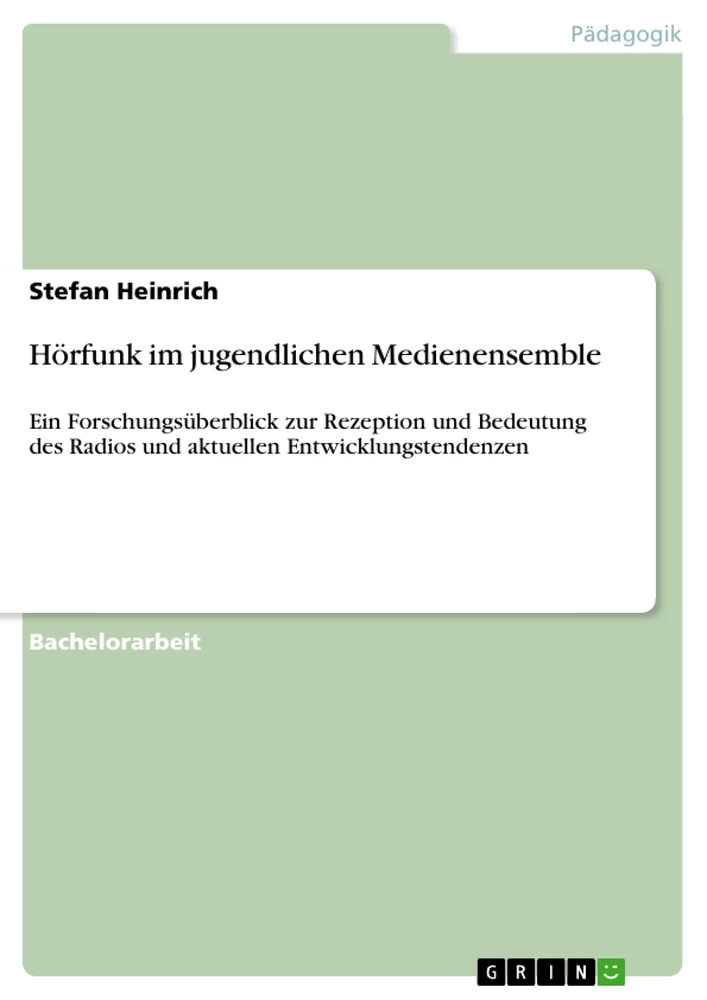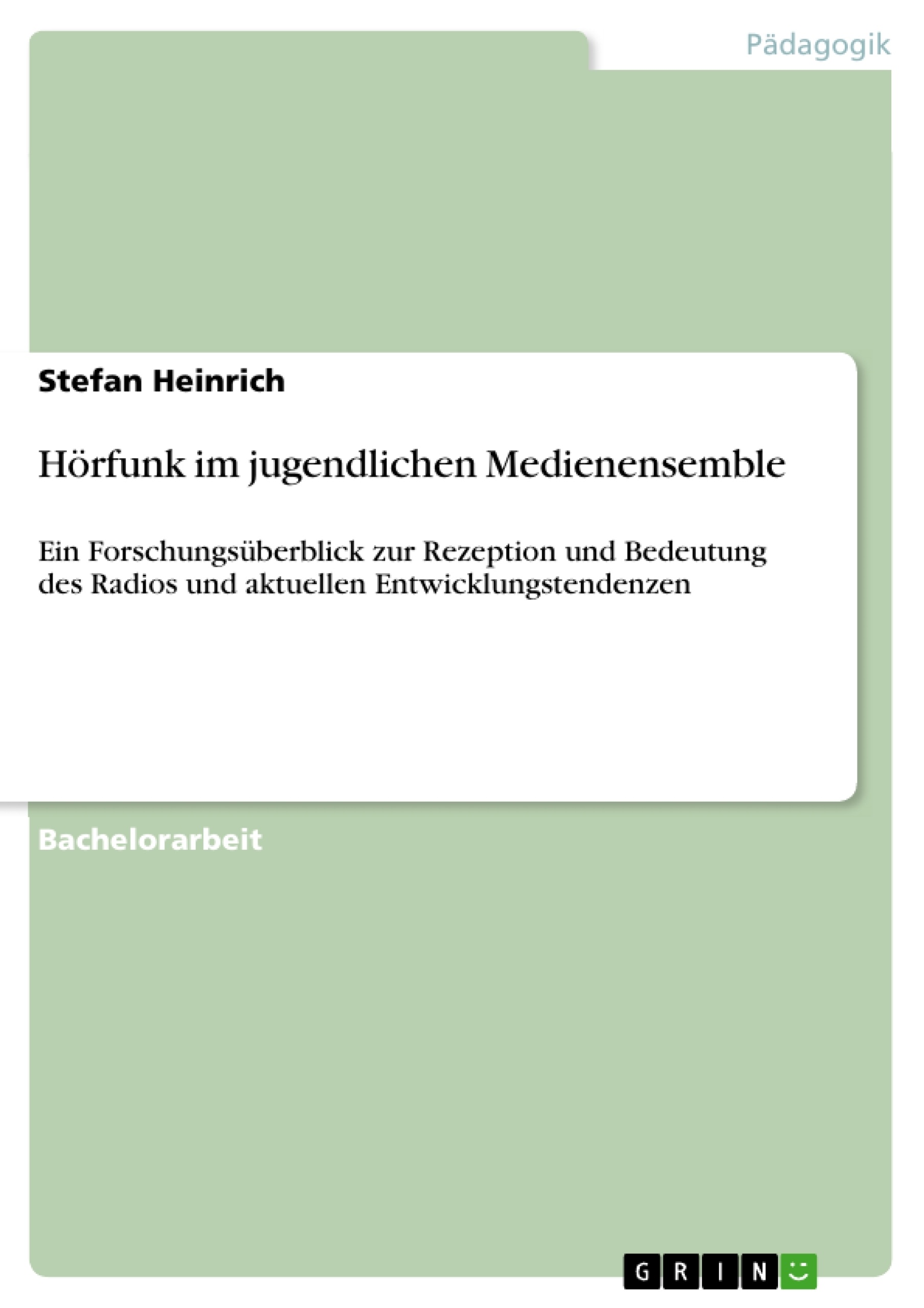Das Radio kann als erstes elektronisches Massenmedium auf eine lange Tradition als Tagesbegleiter in deutschen Haushalten zurückblicken. In seiner Bedeutung für Jugendliche nahm es eine erstaunliche Entwicklung; so war der Hörfunk unmittelbar an der jugendkulturellen Verbreitung des Rock'n'Roll beteiligt oder trug mit speziellen Jugendsendungen in den späten 1960er Jahren zur adoleszenten Identitätsbildung bei. Dennoch wurde dem Radio – spätestens seit Etablierung des audiovisuellen Rundfunkpendants – sowohl in wissenschaftlichen Publikationen als auch von außerakademischen Forschungsinstanzen nur in geringem Maße Beachtung geschenkt.
Der Hörfunk, quasi-zyklisch totgesagt, ist auch heute nicht von der medialen Bildfläche verschwunden; für Heranwachsende bietet er – nicht erst seit der verstärkten Etablierung von Jugendprogrammen in den 1990er Jahren – vielfältige Möglichkeiten. In einer Zeit facettenreicher medialer Alternativen gewinnt allerdings die Frage nach seiner Konstitution wieder an Bedeutung. Im neuen Jahrtausend sehen sich die jungen Rezipienten mit einer immer größeren Angebotsvielfalt konfrontiert, die Anbieter einem härteren intermedialen Wettbewerb ausgesetzt. Wie diese Arbeit herausstellen wird, ist das Radio für Heranwachsende vor allem als Musikmedium von Bedeutung; in dieser Funktion hat es jedoch in den letzten Jahren zahlreiche Konkurrenten hinzugewonnen. In einer immer stärker konvergenten Medienwelt bieten multifunktionale Endgeräte neue Alternativen, Musik zu hören, doch auch die Angebote selbst dehnen sich aus und lassen junge Hörer aus einer Fülle von Möglichkeiten schöpfen. Computer, MP3-Player und Internet sind für Jugendliche zu wichtigen Abspieloptionen geworden und auch das Radio macht vor dieser Entwicklung nicht Halt: mit dem Konvergenzmedium schlechthin, dem Internet, können und müssen dem Hörfunk neue Wege erschlossen werden. Doch gelingt es ihm, im Verhältnis zu neuen Musikmedien im jugendlichen Medienensemble zu bestehen? Welche Position nimmt das Radio in Zeiten eines sich kulminierend ausdifferenzierenden Marktes und zenitaler Zeitbudgets jugendlicher Medienrezeption ein?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemdarstellung
- 1.2. Ziel der Arbeit
- 1.3. Fragestellungen
- 1.4. Untersuchungsmethode
- 1.5. Erläuterungen
- 2. Institutionelle Grundlagen des Themenkomplexes
- 2.1. Parameter Hörfunk – Rundfunkforschung und Jugend
- 2.2. Parameter Jugend – Jugendforschung und Medien
- 2.3. Medienpädagogik - Zwischen den Stühlen
- 2.4. Zusammenfassung
- 3. Jugend und Hörfunk – Der gegenwärtige Forschungsstand
- 3.1. Ein Forschungsdesiderat?
- 3.1.1. Exkurs: Gewaltforschung in Bezug auf Medien und Jugendliche
- 3.1.2. Historische Einbettung der Forschungslage
- 3.2. Dauerhafte Forschungsinstanzen
- 3.2.1. Parameter Hörfunk
- 3.2.2. Parameter Jugend
- 3.2.3. Exkurs: Internetstudien
- 3.3. Charakteristika jugendlichen Hörfunkverhaltens
- 3.3.1. Aufmerksamkeit
- 3.3.2. Empfundene Glaubwürdigkeit
- 3.3.3. Information und Wortbeiträge
- 3.3.4. Bindung
- 3.4. Hörfunk in der Entwicklung Heranwachsender
- 3.4.1. Hörfunk im Übergang zum Jugendalter
- 3.4.2. Hörfunk in der Frühadoleszenz
- 3.4.3. Hörfunk in der mittleren und späten Adoleszenz
- 3.5. Jugendliche, Radio und Musik
- 3.5.1. Die Bearbeitung jugendlichen Entwicklungsbedarfs
- 3.5.2. Musik und Gefühl
- 3.6. Fazit
- 3.6.1. Teil I: Der Hörfunk als Jugendmedium
- 3.6.2. Teil II: Der Forschungsstand zum Komplex Hörfunk und Jugendliche
- 4. Jugend und Hörfunk – Entwicklungen und Trends
- 4.1. Jugendliche Hörfunknutzung - Aktuelle Tendenzen im geschichtlichen Vergleich
- 4.2. Das Radio als Musikmedium und die neuen Konkurrenten
- 4.2.1. Webradio
- 4.2.2. Personalisierte Online-Musikangebote
- 4.3. Fazit
- 5. Zusammenfassung und Folgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit zielt darauf ab, die Rezeption und Bedeutung des Radios im jugendlichen Medienensemble zu erforschen. Sie analysiert den historischen Kontext und den aktuellen Stand der Forschung sowie aktuelle Entwicklungstendenzen im Hörfunkmarkt. Die Arbeit beleuchtet insbesondere die Rolle des Radios als Musikmedium und die Herausforderungen, die durch neue digitale Musikplattformen entstehen.
- Die Rolle des Radios in der Geschichte der Jugendkultur
- Der aktuelle Forschungsstand zur Nutzung des Hörfunks bei Jugendlichen
- Die Bedeutung des Radios als Musikmedium
- Die Auswirkungen neuer digitaler Medien auf die Hörfunknutzung
- Zukünftige Entwicklungen im Hörfunkmarkt
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik des Hörfunks im jugendlichen Medienensemble ein, stellt die Problematik dar und definiert die Ziele und Fragestellungen der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die institutionellen Grundlagen des Themenkomplexes, indem es die Forschungsperspektiven von Rundfunk, Jugend und Medienpädagogik beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich dem gegenwärtigen Forschungsstand zu Jugend und Hörfunk. Es analysiert Forschungsdesiderate, historische Einbettungen und verschiedene Forschungsinstanzen. Das Kapitel untersucht auch das jugendliche Hörfunkverhalten und die Bedeutung des Hörfunks in der Entwicklung Heranwachsender. Es beleuchtet die Rolle des Hörfunks als Musikmedium und die Bedeutung von Musik für Jugendliche.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit aktuellen Entwicklungen und Trends im Hörfunkmarkt. Es analysiert die jugendliche Hörfunknutzung im geschichtlichen Vergleich und untersucht die Herausforderungen durch neue digitale Musikmedien wie Webradio und personalisierte Online-Musikangebote.
Schlüsselwörter (Keywords)
Hörfunk, Jugend, Medienrezeption, Jugendkultur, Musik, Rundfunkforschung, Medienpädagogik, Webradio, Online-Musikangebote, Entwicklungstendenzen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat das Radio heute noch für Jugendliche?
Das Radio fungiert primär als Musikmedium und Tagesbegleiter, muss sich aber gegen starke Konkurrenz wie Streaming-Dienste und MP3-Player behaupten.
Wie hat sich die Rolle des Hörfunks historisch entwickelt?
In den 1960ern war das Radio zentral für die Verbreitung von Rock'n'Roll und die Identitätsbildung; heute ist es eines von vielen Medien im digitalen Ensemble.
Was ist Webradio und warum nutzen es Jugendliche?
Webradio kombiniert klassisches Radio mit den Vorzügen des Internets (Interaktivität, Spartenkanäle) und passt so besser in die konvergente Medienwelt Heranwachsender.
Gilt das Radio als glaubwürdiges Informationsmedium?
Ja, Studien zeigen, dass das Radio für Jugendliche oft eine hohe gefühlte Glaubwürdigkeit besitzt, auch wenn es primär zur Unterhaltung genutzt wird.
Welchen Einfluss hat Musik im Radio auf die Gefühle Jugendlicher?
Musik dient der Stimmungsregulierung und hilft bei der Bearbeitung jugendtypischer Entwicklungsaufgaben und emotionaler Zustände.
- Quote paper
- Stefan Heinrich (Author), 2010, Hörfunk im jugendlichen Medienensemble, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169422