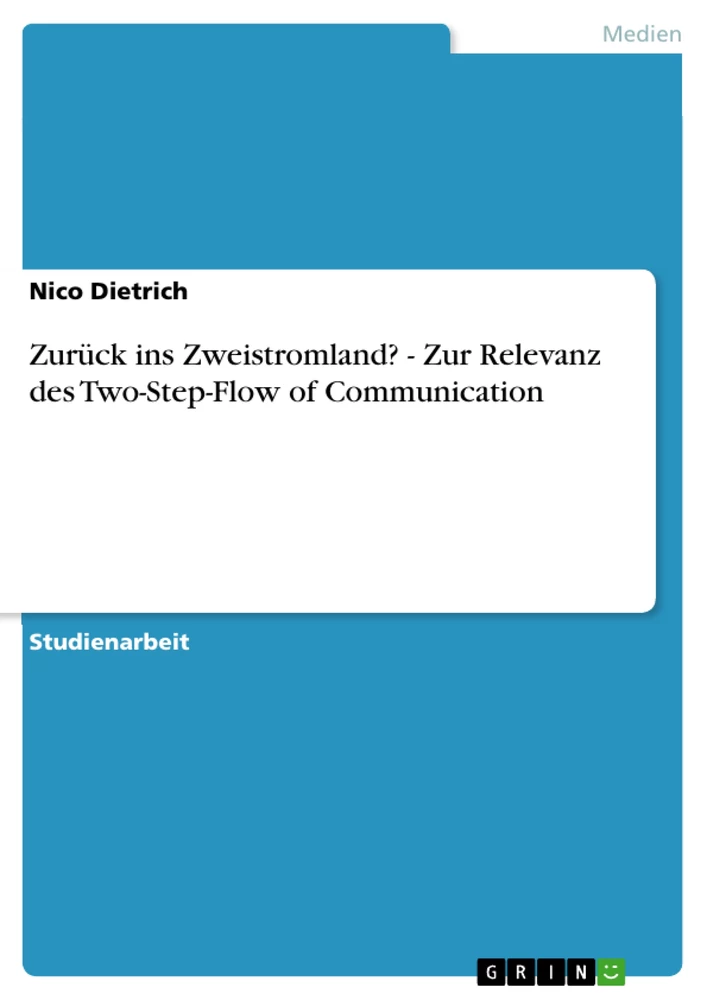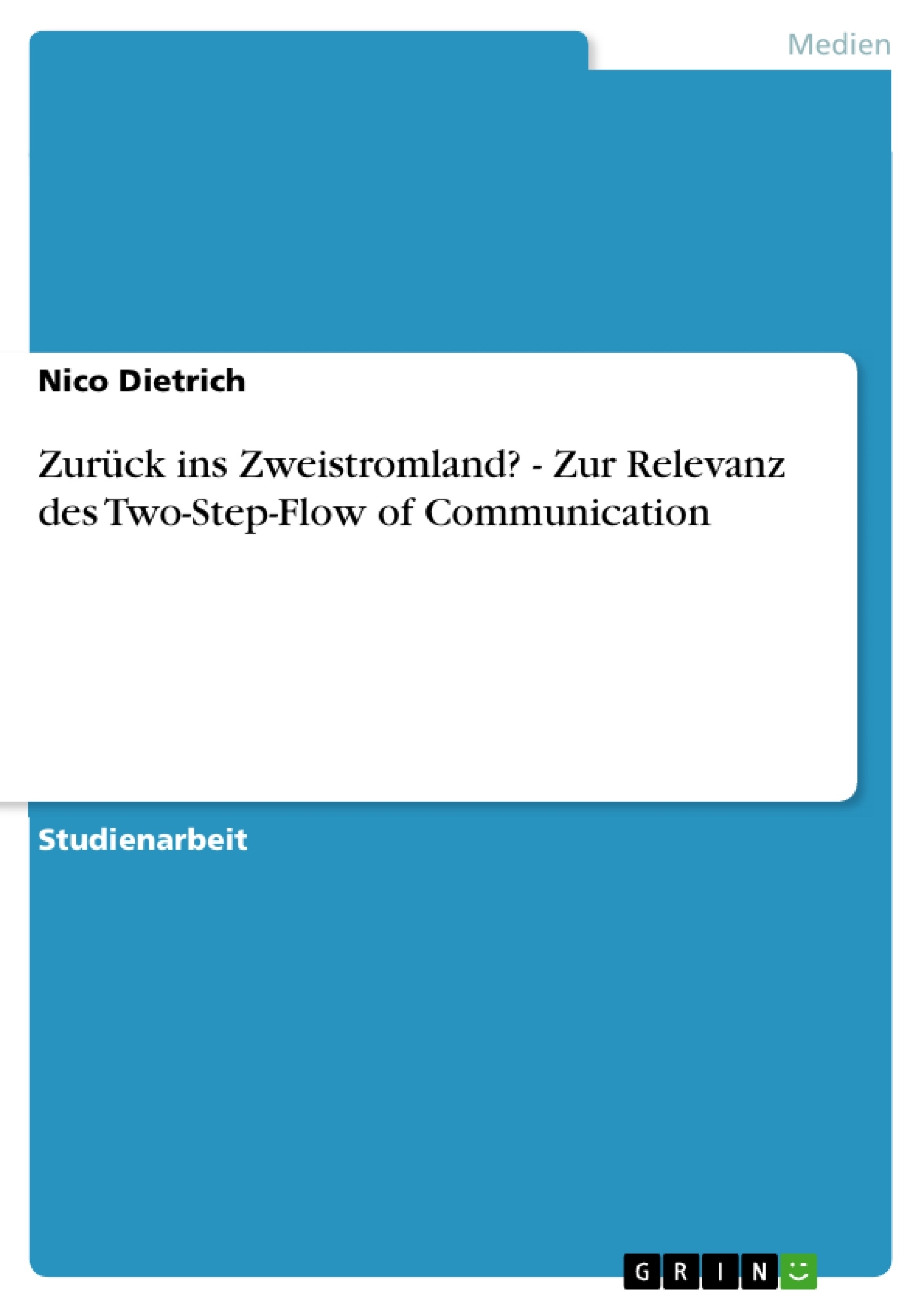Wissenschaftliche Forschung basiert in der Regel auf theoriegeleiteten Prozessen. Vorab wird abgesteckt, was untersucht werden soll, es werden zentrale Begrifflichkeiten definiert und es wird erörtert, welche Methoden zur Untersuchung eingesetzt werden sollen. Doch gelegentlich sind die Forschungsresultate aller Theorie zum Trotz dem Zufall zuzuschreiben. Bedeutende Entdeckungen wie jene der Radioaktivität durch Antoine Henri Becquerel oder des Penizillins durch Sir Alexander Fleming entstanden durch zufällige Umstände. Auch der Erfindung des Post-it-Stickers ging keine Theorie voraus. Ganz ähnlich stellt sich auch die „Entdeckung“ des Two-Step-Flow of Communication durch den gebürtigen Österreicher Paul Felix Lazarsfeld, Bernard Berelson und Hazel Gaudet dar. Eine Studie zum Wahlverhalten der Bürger einer Kleinstadt im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten legte den Grundstein für eine gänzlich neue Sichtweise auf die Wirkung der Medien. The People’s Choice gehört somit zu einer der bekanntesten und einflussreichsten Studien der Medienwirkungsforschung, obwohl die Hypothese des Zweistufenflusses eher als nachträgliche Vermutung denn als Untersuchungsgegenstand bezeichnet werden kann. In Zusammenhang mit der verminderten Medienwirkung wurde das Konzept der Meinungsführerschaft formuliert. Die Unterteilung in Meinungsführer und -folger stellt vor allem für Kommunikatoren eine nicht zu unterschätzende Erkenntnis dar.
Die vorliegende Arbeit stellt einige grundlegende Studien zum Two-Step-Flow vor. Nachfolgend werden das Phänomen der Meinungsführerschaft näher beleuchtet und vor allem die Meinungsführer selbst genauer charakterisiert, bevor die Weiterentwicklung beider Konzepte betrachtet wird. Im Anschluss stellt sich die Frage, ob – und wenn ja inwiefern – der Annahme eines zweistufigen Flusses knapp 70 Jahre nach seiner Beschreibung heute noch zuzustimmen ist. Abschließend findet sich ein Fazit samt kurzem Ausblick. Der Fokus der Arbeit liegt hauptsächlich auf den frühen Studien der 1940er und 1950er Jahre, sowie im zweiten Teil auf den neuesten Publikationen zum Thema. Der Rahmen dieser Arbeit erlaubt es mir nicht, mich in aller Ausführlichkeit mit den genannten Phänomenen zu beschäftigen. Infolgedessen werden nur die wichtigsten und meines Erachtens nach relevanten Punkte berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Zwei-Stufen-Fluss der Kommunikation
- Die frühen Studien
- Die Meinungsführer
- Weiterentwicklungen
- Two-Step-Flow früher und heute
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang: Internetquelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Relevanz des Two-Step-Flow of Communication. Sie beleuchtet die Entstehung des Konzepts, die Rolle der Meinungsführer und die Weiterentwicklung des Modells. Darüber hinaus wird untersucht, ob und inwiefern der Zwei-Stufen-Fluss in der heutigen Zeit noch relevant ist.
- Entstehung und Entwicklung des Two-Step-Flow-Modells
- Rolle der Meinungsführer in der Kommunikation
- Relevanz des Two-Step-Flow in der heutigen Zeit
- Methodische Ansätze zur Untersuchung des Two-Step-Flow
- Bedeutung des Two-Step-Flow für die Kommunikationsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Two-Step-Flow of Communication ein und beleuchtet die Bedeutung der frühen Studien. Kapitel 2 widmet sich den frühen Studien zum Two-Step-Flow, insbesondere der Decatur-Studie und The People's Choice. Die Rolle der Meinungsführer wird in Kapitel 2.2 näher beleuchtet, wobei die Charakteristika und Einflussfaktoren dieser Gruppe im Vordergrund stehen. Kapitel 2.3 beschäftigt sich mit den Weiterentwicklungen des Two-Step-Flow-Modells und den neuen Erkenntnissen in der Kommunikationsforschung. Kapitel 3 untersucht die Relevanz des Two-Step-Flow in der heutigen Zeit und diskutiert die Veränderungen in der Medienlandschaft. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsperspektiven.
Schlüsselwörter
Two-Step-Flow of Communication, Meinungsführer, Medienwirkung, Kommunikationsforschung, politische Kommunikation, Interpersonale Kommunikation, Mediennutzung, Soziale Netzwerke, Einflussfaktoren, Medienwandel, Digitalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das "Two-Step-Flow of Communication" Modell?
Es besagt, dass Medienbotschaften oft nicht direkt wirken, sondern erst über "Meinungsführer" (Opinion Leaders) an die breite Masse ("Meinungsfolger") weitergegeben werden.
Wer entwickelte den Two-Step-Flow?
Das Konzept wurde von Paul Felix Lazarsfeld, Bernard Berelson und Hazel Gaudet in den 1940er Jahren im Rahmen von Wahlstudien (The People’s Choice) entdeckt.
Was zeichnet einen Meinungsführer aus?
Meinungsführer sind Personen, die Medien intensiver nutzen, in sozialen Gruppen gut vernetzt sind und eine hohe Glaubwürdigkeit bei ihren Mitmenschen genießen.
Ist das Modell in Zeiten von Social Media noch aktuell?
Ja, die Arbeit diskutiert, dass Influencer und soziale Netzwerke die Rolle der Meinungsführer heute sogar noch verstärken und den Informationsfluss prägen.
Welche Rolle spielt interpersonale Kommunikation in diesem Konzept?
Interpersonale Kommunikation ist der entscheidende zweite Schritt, in dem Informationen gefiltert, bewertet und durch persönlichen Kontakt wirksamer werden als reine Medienbotschaften.
- Quote paper
- Nico Dietrich (Author), 2010, Zurück ins Zweistromland? - Zur Relevanz des Two-Step-Flow of Communication, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169476