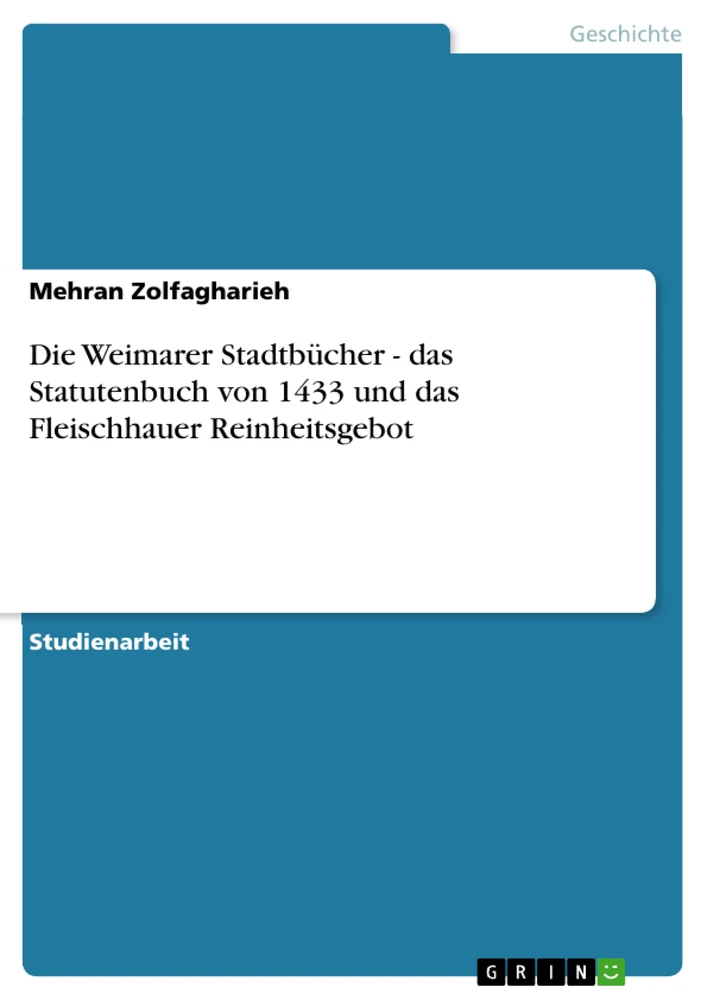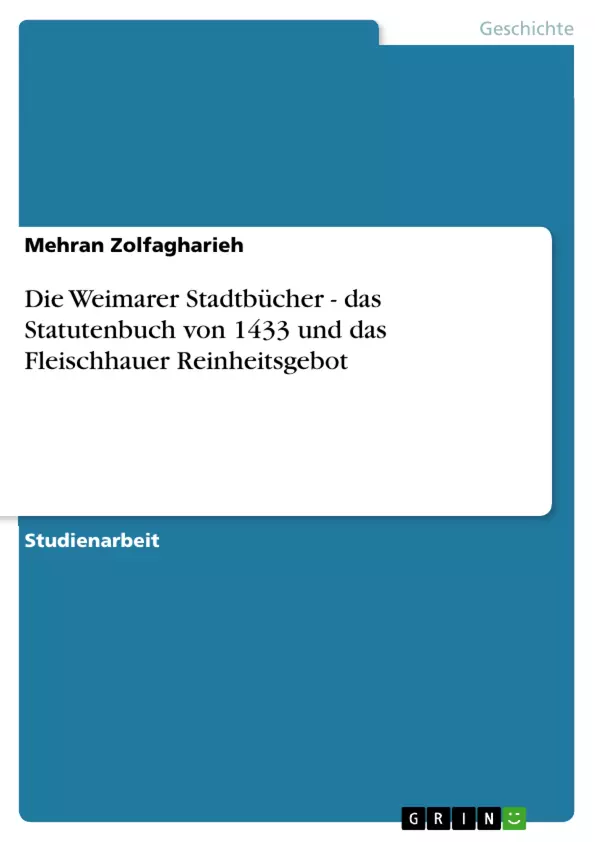Stadtbücher und Stadtchroniken sind die zwei Quellenarten der Überlieferung städtischen Lebens, die besonders wertvoll für uns sind und uns Einblicke in das Mittelalter, aber auch in die Frühe Neuzeit geben. Während Stadtchroniken meist aus „Sicht einer bürgerlichen oder auch klerikalen Person geschrieben wurden und somit nicht nur Belange der Stadt enthalten, sondern auch familiengeschichtlicher Natur“, ist bei Stadtbüchern eine Professionalität des Schreibens bemerkbar. Wohl bemerkt, ein Stadtbuch ist somit nicht die „auf Ratsordnung geführte Stadtchronik“ und es handelt sich hier nicht um einfache Geschichte der Stadt oder gar „um die großen Zusammenhänge der Weltgeschichte oder der politischen Geschichte des Heiligen Römischen Reiches“, sondern vielmehr um Normen, städtische Gesetzgebung, Ver- urteilungen, aber auch Eheschließungen und die Verleihung der Bürgerschaft u.v.m.. Diese Bücher werden nun von Schreibern der Kanzleien geschrieben im Auftrag des Stadtrates, ganz nach Max Webers Definition von Professionalisierung. Dennoch sind Stadtschreiber oftmals „selbständig aus freien Stücken zur Anlegung geschritten“. Der Anspruch auf Professionalität kam nicht von irgendwoher. Er diente der wachsenden Selbstständigkeit bzw. Autonomie gegenüber dem Stadtherren und somit der Legitimität gegenüber eben diesen auf Eigenständigkeit. Aber auch eine Verbesserung der Buchführung kann man dem Ausbau des Stadtbuchwesens verdanken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Weimar im späten Mittelalter.
- 2.1 Ein Überblick über die Weimarer Stadtgeschichte.
- 2.2 Weimars Stadtentwicklung im Mittelalter.
- 2.3 Die Verwaltung Weimars im Mittelalter.
- 2.4 Weimars kirchliche Situation im Mittelalter.
- 3. Das Statutenbuch von 1433.
- 3.1 Die Handschrift des Statutenbuches.
- 3.2 Die Schreiber des Weimarer Statutenbuches.
- 3.3 Der Inhalt des Statutenbuches
- 4. Das Fleischhauer Reinheitsgebot.
- 5. Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Weimarer Statutenbuch von 1433 und untersucht das Fleischhauer Reinheitsgebot als ein Beispiel für die städtische Gesetzgebung im späten Mittelalter. Sie befasst sich mit der Entstehung und dem Inhalt des Statutenbuches sowie der Bedeutung der Fleischhauerordnung für die Entwicklung der Stadt Weimar.
- Die Entstehung und Entwicklung der Stadt Weimar im späten Mittelalter
- Die Bedeutung der Stadtbücher für die Überlieferung städtischen Lebens
- Das Weimarer Statutenbuch von 1433 als Beispiel für städtische Gesetzgebung
- Die Fleischhauerordnung als Beispiel für die Entwicklung der Stadt Weimar
- Die Bedeutung der Fleischhauerordnung für die Qualitätssicherung von Nahrungsmitteln
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Stadtbücher und Stadtchroniken als wichtige Quellenarten der Überlieferung städtischen Lebens vor und erläutert die Besonderheiten des Weimarer Statutenbuches. Die Einleitung führt die beiden zentralen Fragestellungen der Arbeit ein: Warum wurde das Statutenbuch angefertigt und was waren die Voraussetzungen in Weimar dafür? Darüber hinaus wird die Frage nach der Moderne der Fleischhauerordnung aufgeworfen.
Kapitel 2 bietet einen umfassenden Überblick über die Weimarer Stadtgeschichte im späten Mittelalter. Es beleuchtet die Entwicklung der Stadt, die Verwaltung und die kirchliche Situation.
Kapitel 3 konzentriert sich auf das Statutenbuch von 1433, analysiert seine Handschrift und die Schreiber sowie den Inhalt.
Kapitel 4 behandelt das Fleischhauer Reinheitsgebot als Beispiel für die städtische Gesetzgebung und seine Bedeutung für die Lebensmittelqualität.
Schlüsselwörter
Stadtbücher, Stadtchroniken, Weimar, Statutenbuch, Fleischhauer Reinheitsgebot, städtische Gesetzgebung, späte Mittelalter, Lebensmittelqualität, Stadtentwicklung, Verwaltung, Kirche, Handschrift, Schreiber, Moderne.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Stadtbüchern und Stadtchroniken?
Chroniken sind oft privat oder klerikal verfasst; Stadtbücher hingegen sind professionelle Aufzeichnungen von Ratsordnungen, Gesetzen und Urteilen.
Was ist das Statutenbuch von 1433?
Ein bedeutendes Weimarer Dokument, das die städtische Gesetzgebung und Normen des späten Mittelalters festhält.
Was regelte das Fleischhauer Reinheitsgebot?
Es handelte sich um eine Ordnung zur Qualitätssicherung von Fleischprodukten, die als frühes Beispiel für Verbraucherschutz und städtische Kontrolle gilt.
Warum wurden Stadtbücher im Mittelalter immer wichtiger?
Sie dienten der wachsenden Autonomie der Städte gegenüber den Stadtherren und sorgten für eine professionellere Verwaltung und Buchführung.
Wer schrieb diese Stadtbücher?
Professionelle Stadtschreiber in den Kanzleien führten die Bücher im Auftrag des Stadtrates.
- Citar trabajo
- Mehran Zolfagharieh (Autor), 2010, Die Weimarer Stadtbücher - das Statutenbuch von 1433 und das Fleischhauer Reinheitsgebot, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169491