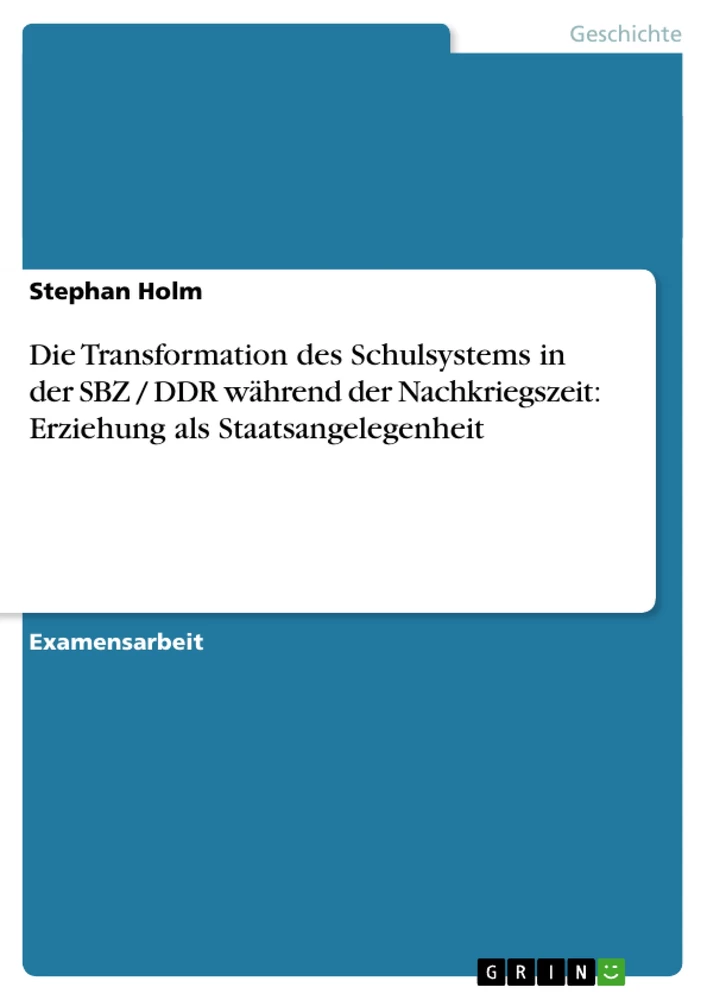Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 und der deutschen Wiedervereinigung 1990
mussten sich die Bürger der neuen Bundesländer einem Neuanfang stellen. Ihre Situation war
vergleichbar mit der Nachkriegszeit in ganz Deutschland: neue Lebensperspektiven, aber auch
eine ungewisse Zukunft! Auch das Schulsystem in den neuen Bundesländern musste eine
Transformation durchleben, die an die Umwälzungen in der SBZ und DDR während der
Nachkriegszeit erinnert. Das Thema „Bildungspolitik in der DDR“ ist mit der Wende zwar in
sich abgeschlossen, aber die Folgen sind bis heute zugegen. Jeder DDR-Bürger wurde durch
die Schule stärker geprägt, als man es sich vielleicht im Westen vorstellen kann. Wenn man
darüber nachdenkt, warum „Ossis und Wessis“ den jeweils anderen selbst nach über zwölf
Jahren der Wiedervereinigung teilweise noch als fremdartig und seltsam erleben, sollte man
auch bedenken, dass beide Seiten eine sehr unterschiedliche Schullaufbahn hinter sich haben.
Da die Jahre als Kind und Jugendlicher einen Menschen besonders stark und nachhaltig
prägen, ist es wichtig, dem Schulsystem der ehemaligen DDR besondere Aufmerksamkeit zu
schenken, wenn man als Westdeutscher die ostdeutsche Mentalität und Lebenseinstellung
verstehen will.
Neben der wirtschaftlichen Produktion war das Bildungs- und Erziehungssystem mit
dem Zweck, das Denkens jedes Einzelnen zu beeinflussen, das zweite große Hauptaktionsfeld
in der Transformationspolitik der SBZ/DDR. Das Bildungssystem der DDR erstreckt sich von
der Vorschulerziehung bis zu den Hochschulen und zur Erwachsenenqualifizierung. Im
Folgenden werde ich mich auf die Entwicklungen der allgemeinbildenden Schulen in der
SBZ/DDR während der Nachkriegszeit konzentrieren. Für die Neuordnung des Schulsystems
siedle ich die Nachkriegszeit in dem Zeitraum von 1945 bis 1961/62 an, also vom Kriegsende
bis zum Mauerbau, da es in dieser Zeitspanne des Wiederaufbaus völlig neu etabliert wurde.
Dieser Abschnitt zeichnet sich durch zahlreiche Entwicklungen und Experimente aus, die ein
völlig neues Staatssystem etablieren sollten.
Der Zeitabschnitt von 1945 bis 1949 kann als Phase der Weichenstellung betrachtet
werden. Um die unterschiedlichen Entwicklungen in der Bildungspolitik in Ost und West zu
begreifen, ist es erforderlich, sich zunächst mit den Vorgehensweisen der vier
Besatzungsmächte zu beschäftigen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Periodeneinteilung
- Die erste Phase: Weichenstellung 1945-1949
- Vorgehen der Besatzungsmächte im Vergleich
- Das Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule
- Die Neulehrer
- FDJ und Pionierorganisation
- Instrumente zur Politisierung der Schule
- Die FDJ
- Die Pionierorganisation
- Die Kirche als Konkurrenz
- Die zweite Phase: 1949-1961/62
- Krisen und Experimente
- Das Gesetz über die sozialistische Entwicklung des Schulwesens in der Deutschen Demokratischen Republik
- Die polytechnischen Oberschulen (POS)
- Politische Erziehung in einzelnen Schulfächern
- Gegenwartskunde und Staatsbürgerkunde
- Der Lehrplan für den Geschichtsunterricht
- Föderalismus und Zentralismus: BRD und DDR im Vergleich
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Transformation des Schulsystems in der SBZ/DDR während der Nachkriegszeit und untersucht die Entwicklung von der Weichenstellungsphase bis zur Etablierung eines sozialistischen Bildungssystems. Dabei werden die unterschiedlichen Handlungsweisen der Besatzungsmächte, die Rolle der SED, die Instrumentalisierung von Institutionen wie der FDJ und Pionierorganisation sowie die Bedeutung politischer Erziehung in Schulfächern beleuchtet.
- Entwicklung des Schulsystems in der SBZ/DDR von 1945 bis 1961/62
- Rolle der Besatzungsmächte und ihre Auswirkungen auf die Bildungspolitik
- Instrumentalisierung von Institutionen und Personen zur Durchsetzung des sozialistischen Ideals
- Politische Erziehung und ihre Bedeutung in der DDR
- Vergleich der Schulsysteme in der BRD und DDR
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas "Bildungspolitik in der DDR" in den Kontext der deutschen Wiedervereinigung und der unterschiedlichen Schullaufbahnen von "Ossis und Wessis" dar. Sie betont die Bedeutung des Bildungssystems als Instrument der Transformationspolitik in der SBZ/DDR und skizziert die Zeitspanne und Schwerpunkte der Hausarbeit.
- Die erste Phase: Weichenstellung 1945-1949: Dieses Kapitel analysiert die Vorgehensweise der Besatzungsmächte im Vergleich und beleuchtet die Bedeutung des "Gesetzes zur Demokratisierung der deutschen Schule". Es untersucht, wie die SED die Schulreform für die Durchsetzung ihrer politischen Ziele nutzte und wie die Entnazifizierung in der SBZ umgesetzt wurde.
- Die Neulehrer: Dieses Kapitel befasst sich mit der Instrumentalisierung von Neulehrern durch die SED und deren Rolle in der Umsetzung der sozialistischen Bildungspolitik. Es stellt dar, wie die SED neue Lehrer rekrutierte, ausbildete und deren politische Einstellung kontrollierte.
- FDJ und Pionierorganisation: Dieser Abschnitt analysiert die FDJ und Pionierorganisation als wichtige Instrumente zur Politisierung der Schule. Es zeigt, wie diese Organisationen zur Durchsetzung der sozialistischen Ideologie und zur Kontrolle der Schüler eingesetzt wurden.
- Die zweite Phase: 1949-1961/62: Dieses Kapitel beleuchtet die Etablierung des sozialistischen Schulsystems nach der Gründung der DDR. Es beschreibt die zentralen Gesetze und Reformen, die zur Einführung der polytechnischen Oberschulen (POS) führten.
- Politische Erziehung in einzelnen Schulfächern: Dieser Abschnitt untersucht, wie die SED politische Erziehung in Schulfächern wie Gegenwartskunde, Staatsbürgerkunde und Geschichtsunterricht umsetzte. Es analysiert die Inhalte und Methoden des Unterrichts und deren Auswirkungen auf die Schüler.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit konzentriert sich auf die Transformation des Schulsystems in der SBZ/DDR, die Instrumentalisierung des Bildungssystems zur Durchsetzung der sozialistischen Ideologie und die Bedeutung politischer Erziehung in der DDR. Zentrale Begriffe sind: Bildungspolitik, Sozialismus, SED, Besatzungsmächte, Entnazifizierung, Neulehrer, FDJ, Pionierorganisation, polytechnische Oberschule, Gegenwartskunde, Staatsbürgerkunde, Geschichtsunterricht, Föderalismus, Zentralismus.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde das Schulsystem in der SBZ/DDR nach 1945 transformiert?
Das Schulsystem wurde zentralisiert und nach sozialistischen Idealen umgestaltet, mit dem Ziel, das Denken der Kinder und Jugendlichen im Sinne der SED-Staatsführung zu beeinflussen.
Was war das "Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule"?
Dieses Gesetz von 1946 bildete die Grundlage für die Schulreform in der SBZ. Es schaffte das mehrgliedrige Schulsystem ab und legte den Grundstein für die Einheitsschule und die Entnazifizierung des Lehrkörpers.
Wer waren die "Neulehrer" in der DDR?
Neulehrer waren Personen, die oft aus der Arbeiterschicht stammten und in Kurzlehrgängen ausgebildet wurden, um die politisch belasteten Lehrer der NS-Zeit zu ersetzen und die sozialistische Erziehung zu garantieren.
Welche Rolle spielten die FDJ und die Pionierorganisation in der Schule?
Diese Organisationen waren Instrumente zur Politisierung des Schulalltags. Sie dienten der ideologischen Schulung, der Kontrolle der Freizeit und der Bindung der Schüler an das Staatssystem.
Was ist eine Polytechnische Oberschule (POS)?
Die POS war der Standard-Schultyp in der DDR (ab 1959), eine 10-jährige Einheitsschule, die eine enge Verbindung zwischen allgemeiner Bildung und praktischer, produktiver Arbeit in Betrieben anstrebte.
Wie unterschied sich die politische Erziehung in Ost- und Westdeutschland?
Während die BRD auf Föderalismus und pluralistische Bildung setzte, war das DDR-System streng zentralistisch und auf die Vermittlung des Marxismus-Leninismus in Fächern wie Staatsbürgerkunde ausgerichtet.
- Citar trabajo
- Stephan Holm (Autor), 2003, Die Transformation des Schulsystems in der SBZ / DDR während der Nachkriegszeit: Erziehung als Staatsangelegenheit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16952