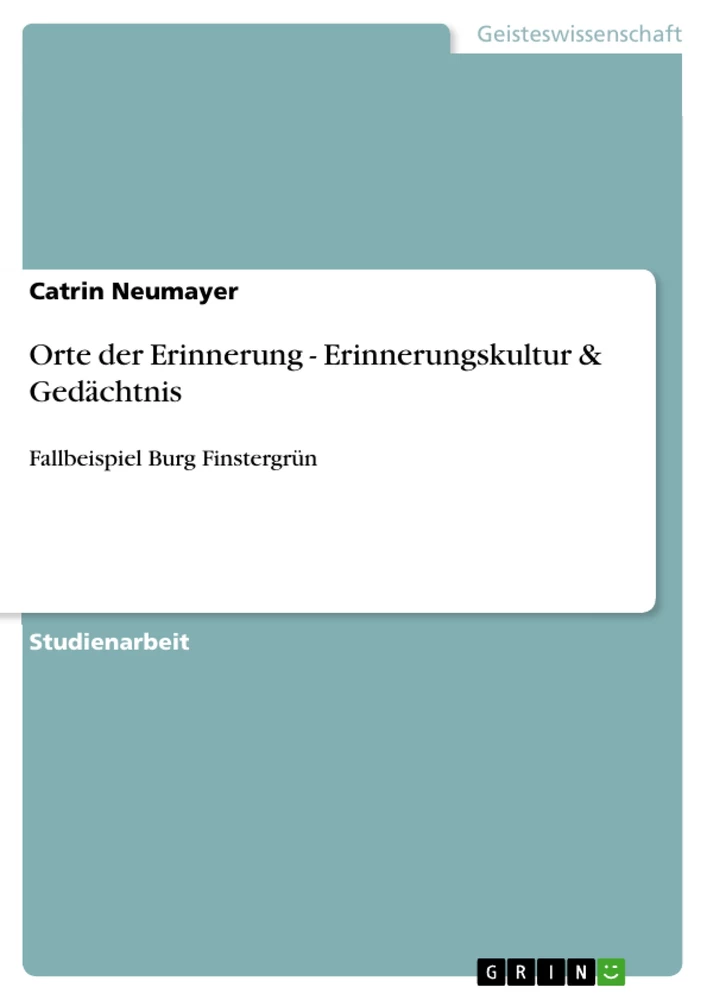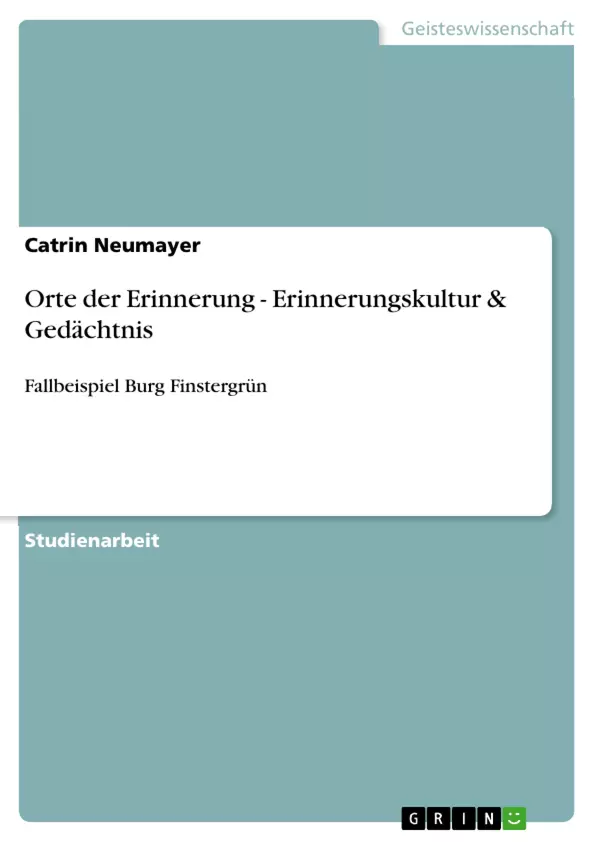Ziel dieser Arbeit ist es, die Burg Finstergrün als historisches Gebäude und als Ort
der Erinnerung zu bearbeiten. Hierbei soll die Geschichte der Burg mit den
unterschiedlichen Formen von Gedächtnis und dabei v.a. der kollektiven Erinnerung
in Zusammenhang gebracht werden und die Frage nach den Formen der Erinnerung
auf Burg Finstergrün gestellt werden. Gefragt wird folglich nach den (medialen) Trägern der Erinnerung wie Schriften, Bildern und dem Ort selbst neben Formen
von Erinnerung wie die Art des alltäglichen Gebrauchs der Erinnerung insofern, dass
die Frage nach der Art der Bewahrung des Wissens sowie der dem Ort
innewohnenden Besonderheiten gestellt wird.
Zu Beginn soll ein theoretischer Teil zum Thema Erinnerungskultur hinführen, bevor
die Geschichte der Burg ihrer Ausführlichkeit nach, der Länge der Arbeit
entsprechend prägnant dargestellt werden soll, wobei mehr auf die für die
Erinnerungskultur relevanten Aspekte, denn auf spezifische geschichtliche
Gegebenheiten eingegangen wird. Im Weiteren werden die verschiedenen
Bestimmungszwecke der Burg im Laufe ihrer Zeit im Kontext der Erinnerungskultur
angeführt. Zum Ende der Arbeit hin sollen spezifische Fragen geklärt werden bevor
abschließend ein Fazit über die Erinnerungskultur auf Burg Finstergrün gezogen
werden soll. Für die Arbeit wurden mehrere Lokalaugenscheine auf Burg
Finstergrün durchgeführt, mit den zentralen Personen der Burgverwaltung, einigen
Angestellten der Burg sowie einigen Einwohnern des Ortes Ramingstein gesprochen
und die Burg im Hinblick Zeichen und Indizien von Erinnerungskultur besichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hinwendung zur Thematik
- Definitionen
- Definition Erinnerungsort
- Gedächtnisarten
- Soziales Gedächtnis
- Individuelles Gedächtnis
- Kollektives Gedächtnis
- Kulturelles Gedächtnis
- Definitionen
- Geschichte der Burg
- Besitzer der Burg
- 17. - 18. Jahrhundert: Niedergang & Verfall der Burg
- 18. 20. Jahrhundert
- Die Burg als Erinnerungs- & Gedächtnisort
- Die Burg als historisches Gebäude
- Die Burg als Denkmal (des Ortes Ramingstein)
- Ortsbeschreibung Ramingstein
- Die Burg im Besitzt der Nationalsozialisten
- Die Burg als belebte Jugendherberge
- Die Burg als Museum
- Definition Museum
- Definition Ausstellung
- Kurzüberblick,,Die Gräfin vom Lungau""
- Rahmenbedingungen & Zeiträume der Ausstellung
- Die Bedeutung der Burg als Museum
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Burg Finstergrün als historischem Gebäude und Ort der Erinnerung. Die Geschichte der Burg soll mit den unterschiedlichen Formen von Gedächtnis, insbesondere der kollektiven Erinnerung, in Verbindung gebracht werden. Die Arbeit untersucht die Formen der Erinnerung auf Burg Finstergrün, indem sie die (medialen) Träger der Erinnerung wie Schriften, Bilder und den Ort selbst sowie Formen von Erinnerung wie die Art des alltäglichen Gebrauchs der Erinnerung beleuchtet. Darüber hinaus wird die Frage nach der Art der Bewahrung des Wissens und den dem Ort innewohnenden Besonderheiten gestellt.
- Die Burg Finstergrün als Ort der Erinnerung
- Die Geschichte der Burg und ihre Bedeutung für die kollektive Erinnerung
- Die verschiedenen Formen von Gedächtnis und ihre Rolle in der Erinnerungskultur
- Die (medialen) Träger der Erinnerung auf Burg Finstergrün
- Die Art des alltäglichen Gebrauchs der Erinnerung und die Bewahrung des Wissens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Burg Finstergrün als besonderen Schauplatz vor und skizziert die Zielsetzung der Arbeit. Sie untersucht, wie die Burg als Ort der Erinnerung fungiert und wie sich ihre Geschichte im Kontext der Erinnerungskultur darstellt.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der theoretischen Grundlage des Themas Erinnerungskultur. Hier werden Definitionen von "Erinnerungsort" und verschiedene Gedächtnisarten wie das soziale, individuelle, kollektive und kulturelle Gedächtnis erläutert.
Der dritte Teil beleuchtet die Geschichte der Burg Finstergrün, wobei der Fokus auf den für die Erinnerungskultur relevanten Aspekten liegt.
Der vierte Teil der Arbeit analysiert die Burg als Erinnerungs- und Gedächtnisort. Er untersucht verschiedene Funktionen der Burg im Laufe der Zeit, wie z.B. als historisches Gebäude, Denkmal, Jugendherberge und Museum.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Erinnerungskultur, Gedächtnis, Erinnerungsorte, kollektive Erinnerung, Geschichte der Burg Finstergrün, Orte der Erinnerung, Museum, Jugendherberge, Denkmal, soziales Gedächtnis, individuelles Gedächtnis, kulturelles Gedächtnis.
Häufig gestellte Fragen
Was macht die Burg Finstergrün zu einem Ort der Erinnerung?
Die Burg fungiert als historisches Gebäude, das durch Schriften, Bilder und seine Nutzung (z.B. als Jugendherberge oder Museum) kollektive Erinnerungen bewahrt.
Welche Gedächtnisarten werden in der Arbeit unterschieden?
Es wird zwischen sozialem, individuellem, kollektivem und kulturellem Gedächtnis differenziert, um die Bedeutung der Burg einzuordnen.
Welche Rolle spielte die Burg während der NS-Zeit?
Ein Teil der Arbeit untersucht die Burg im Besitz der Nationalsozialisten und wie diese Phase in der heutigen Erinnerungskultur reflektiert wird.
Welche Bedeutung hat die Ausstellung „Die Gräfin vom Lungau“?
Die Ausstellung ist ein Beispiel für die museale Aufarbeitung der Burggeschichte und dient als Träger von Wissen und lokaler Identität.
Wie wurde für die Arbeit recherchiert?
Es wurden Lokalaugenscheine durchgeführt sowie Gespräche mit der Burgverwaltung, Angestellten und Einwohnern von Ramingstein geführt.
- Quote paper
- MMag. Catrin Neumayer (Author), 2010, Orte der Erinnerung - Erinnerungskultur & Gedächtnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169538