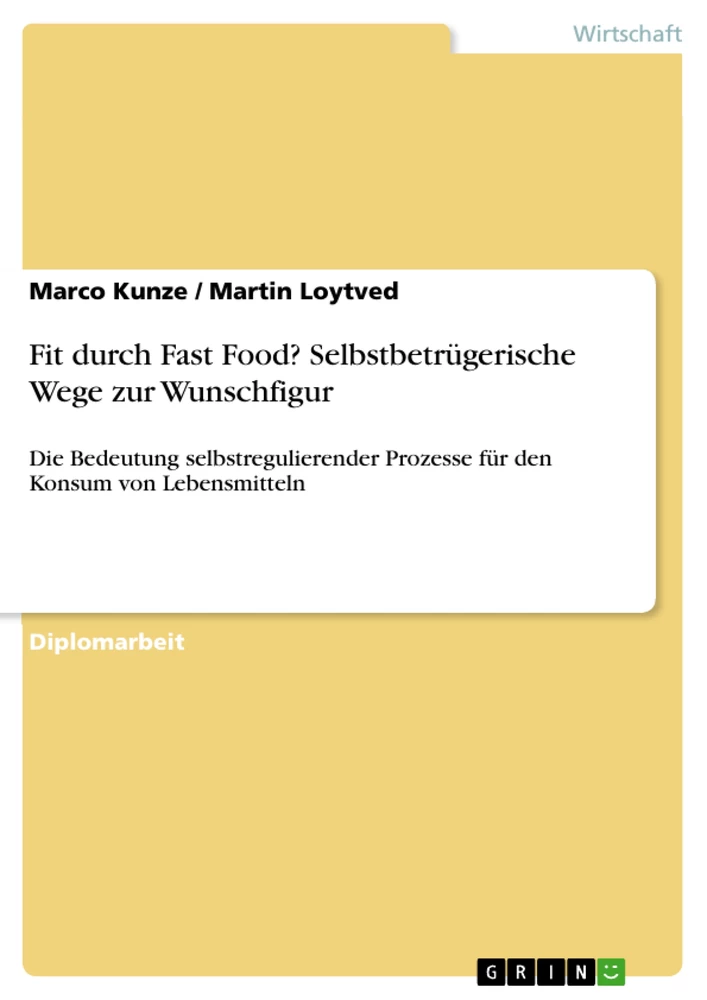Diese Arbeit betrachtet das Spannungsfeld zwischen den Verhaltensvorschriften „gesunde Ernährung“ und „sportliche Aktivität“. Aus der Perspektive eines noch recht jungen Forschungsgebiets, der Selbstregulation, sollen auf diese Weise typische Fehler und Probleme herauskristallisiert werden, um aufzuzeigen an welchen Punkten Personen, die solch eine Form der Diät verfolgen, in ihrer Zielverfolgung zusammenbrechen und vor Allem, warum dies geschieht.
Den Einstieg in diese Thematik bildet ein theoretisches Fundament, welches im Verlauf dieser Arbeit um die wichtigsten Aspekte erweitert wird um dann in einem zusammenfassenden System die Komplexität des Konstrukts Selbstregulation zu verdeutlichen.
Auf dieser Theorie aufbauend, wurde unter dem Deckmantel eines „Großen Sommer Fitness-Check“ eine empirische Untersuchung durchgeführt. Diese hat eine gesunde Ernährung in Verbindung mit körperlicher Aktivität, eben jene beiden Aspekte, die zum Erreichen einer Wunschfigur verfolgt werden müssen, aus dem Blickwinkel selbstregulierender Prozesse beobachtet.
Wie bei kaum einem anderen Thema, gibt es für die Zielerreichung der „Wunschfigur“ unzählige Mythen und Richtlinien, die allesamt versprechen, in kürzester Zeit und mit geringstem Einsatz ein Höchstmaß an Effizienz zu erzielen. Einer der in diesem Kontext wohl als mit am vernünftigsten geltende Ansatz verbindet die beiden Verhaltensvorschriften „gesunde Ernährung“ und Sport. So soll durch die gesunde Ernährung eine vollständige Nährstoffversorgung gewährleistet werden.
Bei der sportlichen Betätigung hingegen werden zum Einen Kalorien verbrannt, zum Anderen wird je nach Intensität unterschiedlich stark das Muskelwachstum gefördert. Hierbei impliziert ein größer werdender Muskel seinerseits einen gesteigerten Energie- bzw. Kalorienverbrauch, auch im Ruhezustand. Bei dieser Form der Diät ist der Fokus durchschnittlich gesehen sehr langfristig angelegt. Über einen Gewöhnungseffekt soll die Ernährung auf Dauer vollständig umgestellt werden um Rückkopplungseffekte, wie den „Jo-Jo-Effekt“ zu verhindern.
Doch wäre dies so einfach und wären alle Diätstrebende in der Lage auf jegliche Essenssünden zu verzichten, dann sähe die Gewichtsverteilung unserer Bevölkerung wohl anders aus. Schließlich sind laut einer nationalen Verzehrsstudie in Deutschland 66% der Männer und 51% der Frauen übergewichtig (Body-Maß-Index>25 kg/m²).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen der Selbstregulation
- Willpower - Selbstregulation als verbrauchbare Ressource
- Kognitive Prozesse - Selbstregulation als abrufbares Wissen
- Selbstregulation als individuelle menschliche Fähigkeit
- Einnahme einer kombinierten Sichtweise auf die Selbstregulation
- Selbstregulation als treibende Kraft menschlichen Verhaltens
- Selbstregulation und das Reflective-Impulsive System (RIM)
- Auswirkungen fehlender Selbstregulation auf das Kaufentscheidungsverhalten von Lebensmitteln und körperliche Aktivität
- Wegfall rationaler Entscheidungsfindung
- Verlust der emotionalen Kontrolle und gesteigerte Bedeutung affektiver Einflussmechanismen
- Bedingungen des Versagens von Selbstregulation beim Konsum von Lebensmitteln und bei körperlicher Aktivität
- Fehlende Standards und mangelnde Motivation im Rahmen selbstregulierender Prozesse
- Setzen von Zielen als Motivationsanker
- Monitoring als Mittel zur langfristigen Zielerreichung
- Selbstbestätigung durch erreichte Ziele
- Die Bedeutung von Stimmungsmanagement und Stimmungskongruenz für selbstregulierende Prozesse
- Fehlende Standards und mangelnde Motivation im Rahmen selbstregulierender Prozesse
- Bewusster Verzicht von Konsumenten auf interne selbstregulierende Ressourcen
- Bewusstes Aufsparen der Selbstregulation als limitierte Ressource
- Externe Kontrollmechanismen als Ersatz für interne Selbstregulation
- Zusammenfassende Darstellung der Selbstregulation als komplexes System von affektiven, emotionalen und kognitiven Prozessen
- Empirische Untersuchung
- Ziele der Studie
- Aufbau und Durchführung der Studie
- Methodisches Vorgehen
- Darstellung der Ergebnisse
- Verhaltensreaktionen der Teilnehmer
- Selbstregulation nach körperlicher Aktivität
- Der Einfluss von Spaß und empfundener Anstrengung auf den Ressourcenverbrauch der Selbstregulation
- Der Einfluss der Selbstregulation, empfundenem Spaß und gefühlter Anstrengung auf eine anschließende Lebensmittelwahl
- Der Einfluss von Zielerreichung bei körperlicher Aktivität auf das Selbstwertgefühl und eine Lebensmittelwahl
- Validität und Reliabilität der Ergebnisse
- Inhaltsvalidität
- Konstruktreliabilität
- Interne und externe Validität der Ergebnisse
- Diskussion der Ergebnisse
- Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der Selbstregulation im Kontext von Konsumverhalten und körperlicher Aktivität. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen der Selbstregulation zu beleuchten und deren Einfluss auf das menschliche Verhalten, insbesondere im Hinblick auf die Wahl von Lebensmitteln und die Teilnahme an körperlicher Aktivität, zu untersuchen. Dabei werden die Bedingungen des Versagens von Selbstregulation analysiert, die Rolle von Stimmungsmanagement und die bewusste Steuerung von Ressourcen beleuchtet.
- Theoretische Grundlagen der Selbstregulation
- Selbstregulation als treibende Kraft menschlichen Verhaltens
- Bedingungen des Versagens von Selbstregulation
- Bewusster Verzicht auf interne Selbstregulationsressourcen
- Empirische Untersuchung des Einflusses von Selbstregulation auf Konsumverhalten und körperliche Aktivität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Selbstregulation und deren Bedeutung im Kontext von Konsumverhalten und körperlicher Aktivität ein. Sie stellt die Relevanz des Themas dar und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Theoretische Grundlagen der Selbstregulation: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Selbstregulation, indem es verschiedene Modelle und Ansätze zur Erklärung der Selbstregulation als verbrauchbare Ressource, als abrufbares Wissen und als individuelle Fähigkeit vorstellt.
- Selbstregulation als treibende Kraft menschlichen Verhaltens: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Selbstregulation als treibende Kraft menschlichen Verhaltens, insbesondere im Zusammenhang mit dem Reflective-Impulsive System (RIM). Es analysiert die Auswirkungen fehlender Selbstregulation auf das Kaufentscheidungsverhalten von Lebensmitteln und die Teilnahme an körperlicher Aktivität.
- Bedingungen des Versagens von Selbstregulation beim Konsum von Lebensmitteln und bei körperlicher Aktivität: In diesem Kapitel werden die Bedingungen des Versagens von Selbstregulation im Kontext von Konsumverhalten und körperlicher Aktivität beleuchtet. Es wird untersucht, wie fehlende Standards, mangelnde Motivation und die Bedeutung von Stimmungsmanagement und Stimmungskongruenz die Selbstregulation beeinflussen können.
- Bewusster Verzicht von Konsumenten auf interne selbstregulierende Ressourcen: Dieses Kapitel analysiert die bewusste Entscheidung von Konsumenten, auf interne Selbstregulationsressourcen zu verzichten. Es beleuchtet Strategien wie das bewusste Aufsparen der Selbstregulation und den Einsatz externer Kontrollmechanismen als Ersatz für interne Selbstregulation.
- Zusammenfassende Darstellung der Selbstregulation als komplexes System von affektiven, emotionalen und kognitiven Prozessen: Dieses Kapitel bietet eine zusammenfassende Darstellung der Selbstregulation als komplexes System, das affektive, emotionale und kognitive Prozesse integriert. Es verdeutlicht die Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenen Komponenten.
- Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung, die durchgeführt wurde, um den Einfluss von Selbstregulation auf Konsumverhalten und körperliche Aktivität zu untersuchen. Es erläutert die Ziele der Studie, den Aufbau und die Durchführung sowie das methodische Vorgehen. Die Ergebnisse der Studie werden in detaillierter Form präsentiert und diskutiert.
Schlüsselwörter
Selbstregulation, Konsumverhalten, körperliche Aktivität, Lebensmittelwahl, Reflective-Impulsive System (RIM), Stimmungsmanagement, Ressourcenverbrauch, empirische Untersuchung, Validität, Reliabilität.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Selbstregulation bei Diäten?
Selbstregulation ist die Fähigkeit, Impulse (z.B. Hunger auf Fast Food) zugunsten langfristiger Ziele (Wunschfigur) zu kontrollieren. Sie wird oft als eine begrenzte, verbrauchbare Ressource angesehen.
Warum scheitern viele Menschen bei der Verfolgung einer gesunden Ernährung?
Oft liegt es am Versagen der Selbstregulation durch Stress, mangelndes Monitoring oder unrealistische Ziele. Wenn die kognitiven Ressourcen erschöpft sind, gewinnen impulsive Systeme (RIM) die Oberhand.
Wie beeinflusst Sport die anschließende Lebensmittelwahl?
Die Studie untersucht, ob Menschen nach körperlicher Anstrengung dazu neigen, sich mit ungesundem Essen zu belohnen (Selbstbetrug), weil sie das Gefühl haben, bereits genug für ihre Figur getan zu haben.
Was ist das Reflective-Impulsive System (RIM)?
Das RIM-Modell beschreibt zwei Systeme: Das reflektive System plant rational, während das impulsive System auf unmittelbare Reize reagiert. Ein Ungleichgewicht führt oft zu Fehlentscheidungen beim Essen.
Welche Rolle spielt das Stimmungsmanagement beim Abnehmen?
Essen wird oft zur Regulation negativer Stimmungen genutzt. Werden keine alternativen Strategien zum Stimmungsmanagement gelernt, bricht die Selbstregulation bei emotionaler Belastung zusammen.
- Quote paper
- Marco Kunze (Author), Martin Loytved (Author), 2009, Fit durch Fast Food? Selbstbetrügerische Wege zur Wunschfigur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169736