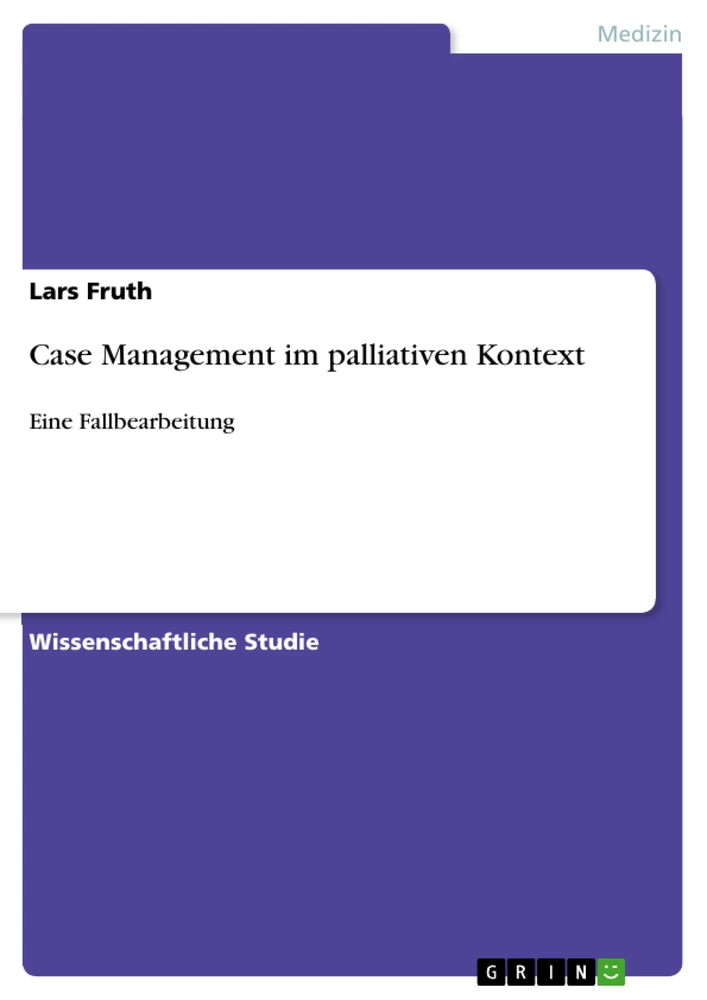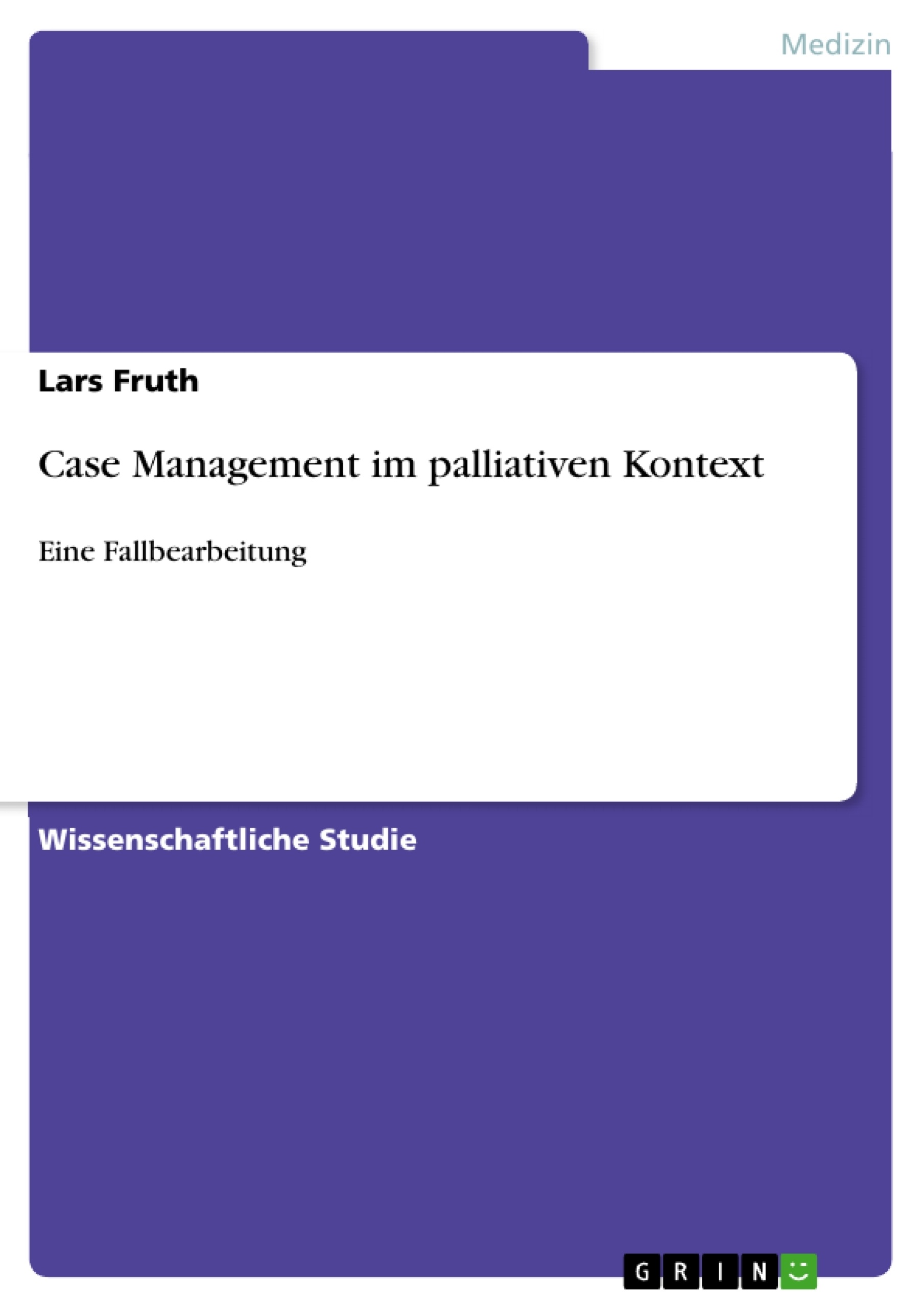Ein wesentliches Problem, das die Entwicklung des deutschen Gesundheitssystems kennzeichnet, ist die zunehmende Chronifizierung von Erkrankungen. Oft werden Krankheiten manifest, es tritt eine steigende Morbidität bei sinkender Mortalität ein. Diese Entwicklung wird in den Gesundheitswissenschaften als „double aging“ bezeichnet. In den Kreis der chronischen Erkrankungen treten mit zunehmender Inzidenz auch einige maligne Tumorentitäten. Betrachtet man das Vorkommen der häufigsten Krebserkrankungen, so lässt sich ein Großteil derer im fortgeschrittenen Alter ausmachen. Krebs kann somit auch als eine Alterserkrankung beschrieben werden.
Durch das steigende Lebensalter tritt Krebs häufiger auf und korreliert damit mit der demographischen Entwicklung. Optimierte Therapien machen ein Überleben einer Krebserkrankung im Durchschnitt wahrscheinlicher (5-Jahres-Überlebensrate). Dennoch ist das Leben mit einer Karzinomerkrankung durch langwierige Therapien, einen häufigen Wechsel von Progredienz und Remission, soziale und psychische Veränderungen - meist sind es Negativverläufe - und oftmals durch finale Krankheitsphasen gekennzeichnet.
Die Herausforderung des Gesundheitssystems besteht nun darin, den an Krebs Erkrankten die notwendigen Hilfestellungen zukommen zu lassen und zugänglich zu machen. Da die Auswirkungen einer Krebserkrankung auf alle Lebensbereiche mannigfaltig sind, sind zahlreiche Aspekte der medizinischen, pflegerischen, sozialen, psychologischen und rehabilitativen Versorgung zu berücksichtigen. Da im stationären Setting Tumorpatienten oft als „Wiederkehrer“ und verstärkt in einem finalen Stadium Ihrer Erkrankung versorgt werden müssen, kann ein spezialisiertes Case Management als Instrument zu einer verbesserten Steuerung der Hilfemöglichkeiten installiert werden. Hier lassen sich die Stärken eines Case Managements auf der individualisierten Fallebene nachzeichnen und die Prozessoptimierung auf Systemebene in Bezug auf maximale interdisziplinäre Kooperation herausstellen.
Diese Arbeit zeigt die Schnittstellenproblematik auf, die im Rahmen einer palliativen Versorgung zwischen dem stationären und ambulanten Setting besteht und entwirft Lösungsmöglichkeiten durch gezielte Case Management-Prozesse. Geht es doch schließlich um die würdevolle Versorgung eines Patienten in seiner letzten Lebensphase. Ein immer noch ressourcenreiches Gesundheitssystem sollte dies leisten können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Fallbeispiel
- 2.1 Fallbeschreibung Herr H.
- 2.2 Krankheitsverlaufskurve
- 3. Analyse der Schnittstellen- und Versorgungsprobleme
- 3.1 Diskontinuität / Desintegration und deren Folgen
- 3.2 Medikalisierung / Desintegration und palliative Ethik
- 4. Case Management als Lösungsstrategie
- 4.1 Zielsetzungen
- 4.2 Methodik des Case Managements
- 5. Entwicklung eines Versorgungsplanes
- 5.1 Versorgungsplan
- 6. Zusammenfassende Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Problematik der Schnittstellen und Versorgungsprobleme im palliativen Kontext, insbesondere im Bereich der onkologischen Versorgung. Ziel ist es, die Herausforderungen aufzuzeigen, die sich aus der zunehmenden Chronifizierung von Erkrankungen und der komplexen Versorgung von Palliativpatienten ergeben. Die Arbeit analysiert die Desintegration im Gesundheitswesen und die daraus resultierenden Folgen für die Patienten. Darüber hinaus werden die Möglichkeiten des Case Managements als Lösungsstrategie vorgestellt.
- Desintegration im palliativen Kontext
- Schnittstellenproblematik zwischen stationärer und ambulanter Versorgung
- Case Management als Instrument zur Steuerung der Versorgung
- Entwicklung eines Versorgungsplanes
- Würdevolle Versorgung von Patienten in der letzten Lebensphase
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und beleuchtet die Entwicklung des deutschen Gesundheitssystems im Kontext der zunehmenden Chronifizierung von Erkrankungen. Es wird die Bedeutung der palliativen Versorgung im Umgang mit Krebserkrankungen und die Herausforderungen des Gesundheitssystems in diesem Bereich aufgezeigt. Kapitel 2 präsentiert ein Fallbeispiel, das die Komplexität der Versorgung onkologisch Erkrankter verdeutlicht. Die Fallbeschreibung und die Krankheitsverlaufskurve des Patienten Herr H. illustrieren die vielfältigen Probleme, die sich in der Praxis ergeben können. Kapitel 3 analysiert die Schnittstellen- und Versorgungsprobleme, die sich aus der Diskontinuität und Desintegration im Gesundheitswesen ergeben. Es werden die Folgen der Medikalisierung und die Bedeutung der palliativen Ethik in diesem Zusammenhang diskutiert. Kapitel 4 stellt das Case Management als Lösungsstrategie für die Herausforderungen der palliativen Versorgung vor. Es werden die Zielsetzungen und die Methodik des Case Managements erläutert. Kapitel 5 beschreibt die Entwicklung eines Versorgungsplanes, der die individuellen Bedürfnisse des Patienten berücksichtigt und eine optimale Versorgung sicherstellt. Kapitel 6 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet eine Schlussbetrachtung.
Schlüsselwörter
Palliativmedizin, Case Management, Schnittstellenproblematik, Desintegration, Versorgungsplan, Chronifizierung, onkologische Versorgung, ambulante Palliativversorgung (SAPV), Komplexbehandlung, interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Case Management im palliativen Kontext?
Case Management ist ein Instrument zur Koordination und Steuerung der vielfältigen Hilfsangebote (medizinisch, pflegerisch, sozial), um eine würdevolle Versorgung am Lebensende sicherzustellen.
Warum ist die Schnittstelle zwischen Krankenhaus und ambulanter Versorgung problematisch?
Oft kommt es zu Diskontinuität in der Betreuung, wenn Informationen verloren gehen oder die ambulante Versorgung (z.B. SAPV) nicht rechtzeitig organisiert wird.
Was bedeutet der Begriff „Double Aging“?
„Double Aging“ bezeichnet die demografische Entwicklung einer steigenden Anzahl älterer Menschen bei gleichzeitig steigender Lebenserwartung, was zu einer Zunahme chronischer und onkologischer Erkrankungen führt.
Wie hilft ein Versorgungsplan dem Palliativpatienten?
Ein individueller Versorgungsplan bündelt alle notwendigen Maßnahmen, berücksichtigt ethische Wünsche des Patienten und vermeidet unnötige Krankenhaus-Wiederaufnahmen.
Welche Rolle spielt die interdisziplinäre Zusammenarbeit?
Sie ist essenziell, da Palliativpatienten komplexe Bedürfnisse haben, die nur durch das Zusammenwirken von Ärzten, Pflegekräften, Psychologen und Sozialarbeitern erfüllt werden können.
- Citar trabajo
- Lars Fruth (Autor), 2011, Case Management im palliativen Kontext, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169792