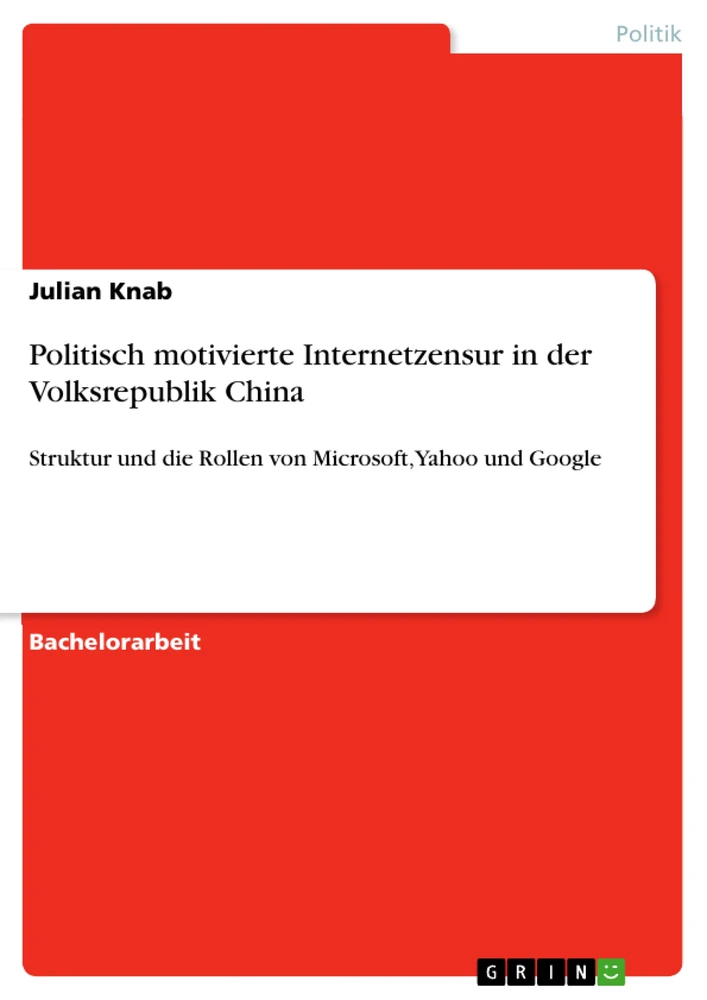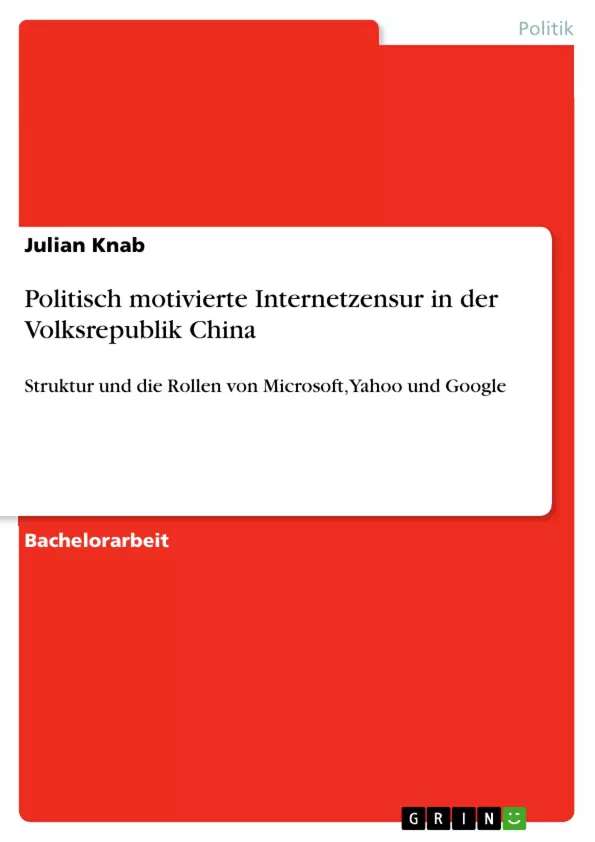In vorliegender Arbeit wird der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen der informationspolitische Spagat zwischen Meinungsfreiheit und Regulierung im chinesischen Internet mit sich bringt. Hierzu wird zunächst der juristische Rahmen der positiven Rechtsnormen sowie der mit dem Internet betraute chinesische Behördenapparat entschlüsselt, um im Folgenden konkrete Praktiken der Webzensur im Reich der Mitte aufzuzeigen. Hieraus werden drei grundlegende Prinzipien der chinesischen Internetzensur abgeleitet: die Schaffung universeller Auffangtatbestände, der grundsätzliche Vorrang von Staats- vor Individualinteressen sowie ein enormes Maß an Bürokratisierung.
Darüber hinaus wird die Rolle der amerikanischen IT-Konzerne Microsoft, Yahoo und Google beleuchtet, welche in der Vergangenheit im Versuch, den chinesischen Markt zu erschließen, tragende Rollen in der behördlichen Durchsetzung der Zensur einnahmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Thematische Hinführung
- 1.2 Literaturbericht
- 2. Theoretischer Zugang
- 2.1 Grundlagen der Menschenrechte
- 2.2 Kodifizierung der Menschenrechte
- 2.3 Kategorisierung von Internetzensur
- 3. Strukturelle Grundlagen der Internetzensur
- 3.1 Grundlagen des politischen Systems
- 3.2 Juristische Grundlagen
- 3.3 Behördenapparat
- 4. Durchführung der Internetzensur
- 4.1 Project Golden Shield
- 4.2 Sonstige Formen der Internetzensur
- 4.3 Umgehensmöglichkeiten
- 5. Die Rollen von Google, Yahoo und Microsoft
- 5.1 Microsoft
- 5.2 Yahoo
- 5.3 Google
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des Spannungsverhältnisses zwischen Meinungsfreiheit und staatlicher Regulierung im chinesischen Internet. Sie beleuchtet die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen der Internetzensur in China und analysiert die Rolle großer amerikanischer IT-Konzerne bei deren Durchsetzung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, wie das chinesische System versucht, ein antidemokratisches System mit den Möglichkeiten des Internets zu vereinen.
- Die rechtlichen Grundlagen der Internetzensur in China
- Der chinesische Behördenapparat und seine Rolle bei der Internetzensur
- Konkrete Praktiken der Webzensur in China
- Die Rolle amerikanischer IT-Konzerne (Microsoft, Yahoo, Google)
- Der Spagat zwischen Meinungsfreiheit und staatlicher Kontrolle im chinesischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat von George Bernard Shaw über Zensur und stellt den Kontext für die Untersuchung der Internetzensur in China dar. Sie führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung des Zugangs zum Internet in einem autoritären System wie dem chinesischen. Die Arbeit fokussiert sich auf den Widerspruch zwischen dem Bestreben nach wirtschaftlicher Öffnung und der Aufrechterhaltung eines antidemokratischen Systems. Der Literaturbericht skizziert die Herausforderungen bei der Informationsbeschaffung über die chinesische Internetzensur und nennt wichtige Quellen.
2. Theoretischer Zugang: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse fest. Es beleuchtet die ideengeschichtlichen Wurzeln der Menschenrechte und deren Relevanz im Kontext der Meinungsfreiheit. Es wird klargestellt, dass die Arbeit nicht die universelle Gültigkeit der Menschenrechte debattiert, sondern diese als Referenzrahmen nutzt. Das Kapitel beschreibt auch das Kategorisierungsschema der OpenNet Initiative, welches zur Analyse der chinesischen Webzensur verwendet wird.
3. Strukturelle Grundlagen der Internetzensur: Dieses Kapitel untersucht die strukturellen Grundlagen der Internetzensur in China. Es analysiert das politische System, die juristischen Rahmenbedingungen und den Behördenapparat, welche die Zensur ermöglichen und unterstützen. Es beleuchtet wie die politische Ideologie und das hierarchische Staatswesen die Zensurpraktiken beeinflussen und rechtfertigen.
4. Durchführung der Internetzensur: Dieses Kapitel beschreibt die konkreten Methoden der Internetzensur in China. Es behandelt das "Project Golden Shield" und andere Formen der Zensur, sowie Strategien zur Umgehung der Zensur. Es wird die Vielfalt der Zensurmethoden erörtert und deren Effektivität analysiert.
5. Die Rollen von Google, Yahoo und Microsoft: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der drei großen amerikanischen IT-Konzerne Microsoft, Yahoo und Google im Kontext der chinesischen Internetzensur. Es beleuchtet, wie diese Unternehmen versucht haben, den chinesischen Markt zu erschließen, und welche Kompromisse sie dabei eingegangen sind. Es wird untersucht, inwiefern diese Unternehmen zur Durchsetzung der staatlichen Zensur beigetragen haben.
Schlüsselwörter
Internetzensur, China, Meinungsfreiheit, Menschenrechte, politisches System, Rechtsnormen, Behördenapparat, IT-Konzerne, Project Golden Shield, Webzensur, Informationskontrolle, OpenNet Initiative.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Internetzensur in China
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Internetzensur in China. Sie analysiert das Spannungsverhältnis zwischen Meinungsfreiheit und staatlicher Regulierung im chinesischen Internet, beleuchtet die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen und die Rolle großer amerikanischer IT-Konzerne bei der Durchsetzung der Zensur. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verbindung zwischen dem antidemokratischen System Chinas und den Möglichkeiten des Internets.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen der Internetzensur in China, die Rolle des chinesischen Behördenapparates, konkrete Praktiken der Webzensur, die Beteiligung amerikanischer IT-Konzerne (Microsoft, Yahoo, Google) und den Spagat zwischen Meinungsfreiheit und staatlicher Kontrolle im chinesischen Kontext.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und erläutert den Kontext. Kapitel 2 (Theoretischer Zugang) legt die theoretischen Grundlagen, insbesondere die Menschenrechte und die Kategorisierung von Internetzensur, dar. Kapitel 3 (Strukturelle Grundlagen der Internetzensur) analysiert das politische System, die juristischen Rahmenbedingungen und den Behördenapparat Chinas. Kapitel 4 (Durchführung der Internetzensur) beschreibt konkrete Methoden wie "Project Golden Shield" und Strategien zur Umgehung der Zensur. Kapitel 5 (Die Rollen von Google, Yahoo und Microsoft) untersucht die Rolle der genannten IT-Konzerne bei der Durchsetzung der chinesischen Internetzensur.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Internetzensur, China, Meinungsfreiheit, Menschenrechte, politisches System, Rechtsnormen, Behördenapparat, IT-Konzerne, Project Golden Shield, Webzensur, Informationskontrolle, OpenNet Initiative.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Literaturbericht, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen, ein Kapitel zu den strukturellen Grundlagen der Internetzensur, ein Kapitel zur Durchführung der Internetzensur und ein Kapitel zur Rolle der amerikanischen IT-Konzerne. Zusätzlich gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des Spannungsverhältnisses zwischen Meinungsfreiheit und staatlicher Regulierung im chinesischen Internet und analysiert die Rolle der beteiligten Akteure, insbesondere der großen amerikanischen IT-Konzerne.
- Quote paper
- Julian Knab (Author), 2010, Politisch motivierte Internetzensur in der Volksrepublik China, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169989