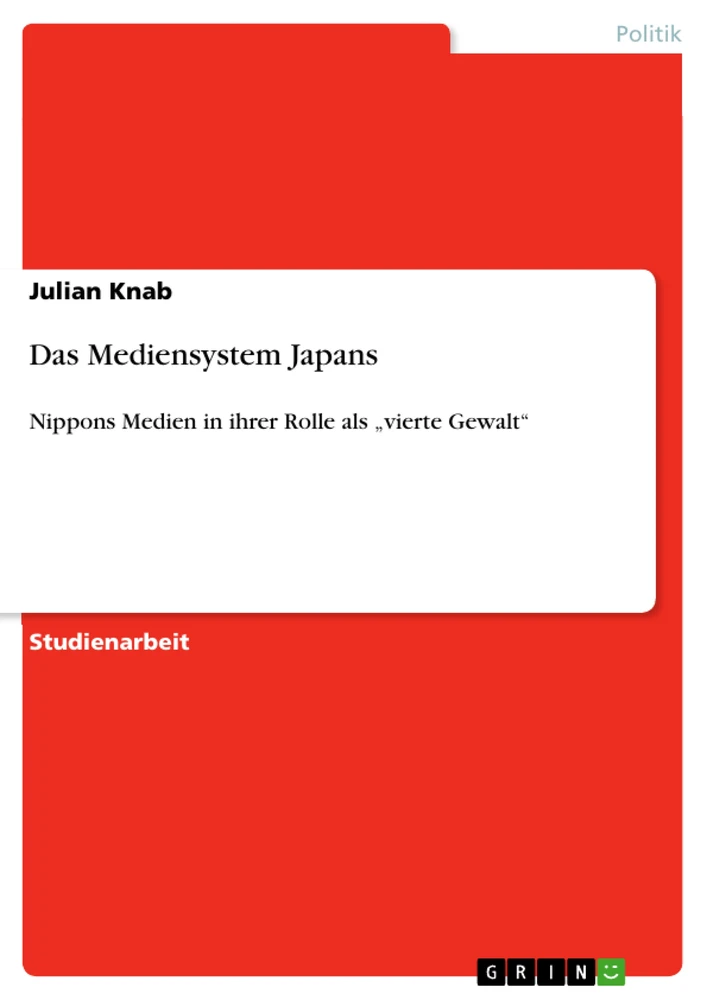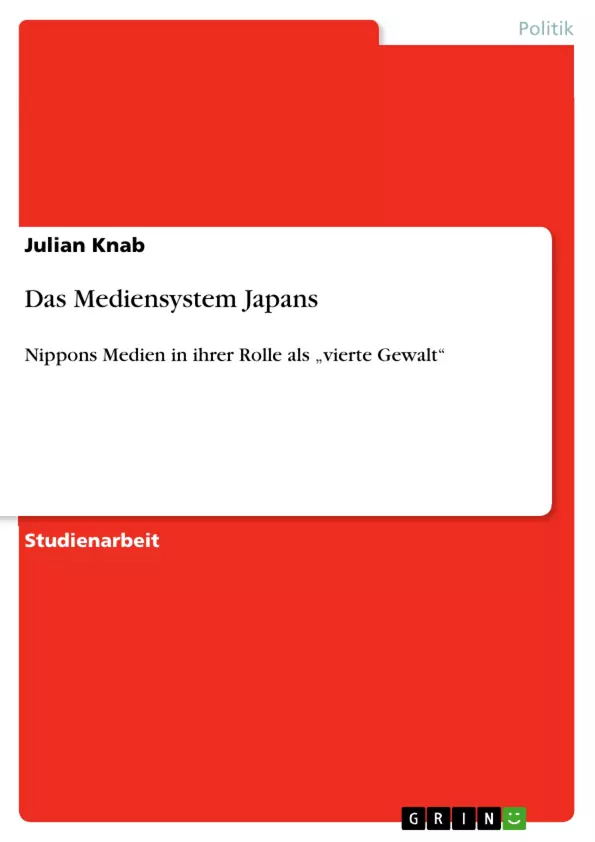Während man in Deutschland die relativ langen Regierungszeiten der Bundeskanzler Adenauer oder Kohl bereits als Ära bezeichnet, wurde das moderne Japan zwischen 1955 und 2009 fast ausschließlich von dessen Liberaldemokratischen Partei (LDP) regiert. Angesichts dieses Phänomens ist insbesondere die Frage nach der Rolle der Medien, welche in Demokratien oft als „vierte Gewalt“ bezeichnet werden, zu stellen. Dies ist im Falle Japan von besonderem Interesse, da sich das Land bis heute als vorderster Pionier im TV-Sektor präsentiert und darüber hinaus Heimat der fünf größten Tageszeitungen der Welt ist.
In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob bzw. inwiefern die Verfasstheit des japanischen Mediensystems einen entscheidenden Einfluss auf den jahrzehntelangen Machterhalt der LDP hatte. Zu diesem Zwecke wird zunächst dessen quantitative Struktur analysiert um im Folgenden die verschiedenen Arten der Berichterstattungen qualitativ zu untersuchen. Ebenfalls geprüft wird die Erfüllung der klassischen Medienfunktionen (Information, Artikulation & Kritik) sowie darüber hinaus eine Einordnung in das Grundmuster politische r Kommunikation nach Gellner vorgenommen.
Diese Arbeit zeigt, dass die Wahlerfolge der LDP in ganz entscheidender Weise von der unkritischer und selbstzensierender Berichterstattung eines paternalistisch-hierarchsichen Mediensystems getragen wurden. Wichtigster Faktor hierbei ist Japans einzigartiges System der Presseclubs, dessen monopolistische Struktur es der LDP erlaubt, den journalistischen Informationsfluss zu steuern und negative Berichterstattung nahezu vollkommen zu unterdrücken.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- 1.1: Der Forschungsgegenstand
- 1.2: Forschungsfrage und Zielsetzung
- 1.3: Methodik und Vorgehensweise
- 1.4: Aufbau der Arbeit
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
- 2.1: Das Konzept der Politik
- 2.2: Politische Entscheidungen
- 2.3: Politische Strukturen
- Kapitel 3: Empirische Analyse
- 3.1: Fallstudie A
- 3.2: Fallstudie B
- 3.3: Vergleichende Analyse
- Kapitel 4: Diskussion
- 4.1: Ergebnisse der Analyse
- 4.2: Implikationen für die Theorie
- 4.3: Limitationen der Studie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, das Konzept der Politik und deren Strukturen zu analysieren. Sie untersucht, wie politische Entscheidungen getroffen werden und wie diese von politischen Strukturen beeinflusst werden. Die empirische Analyse konzentriert sich auf zwei Fallstudien, die im Anschluss vergleichend betrachtet werden.
- Konzept der Politik und deren Strukturen
- Politische Entscheidungen
- Fallstudienanalyse
- Vergleichende Analyse
- Implikationen für die Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein, indem es den Forschungsgegenstand, die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit definiert. Es erläutert außerdem die Methodik und Vorgehensweise der Arbeit sowie den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
Das zweite Kapitel bietet einen Überblick über die relevanten theoretischen Grundlagen, die für die Analyse der Politik und deren Strukturen relevant sind. Es geht auf das Konzept der Politik, politische Entscheidungen und politische Strukturen ein.
Kapitel 3: Empirische Analyse
Das dritte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Analyse, die auf zwei Fallstudien basiert. Es stellt die einzelnen Fallstudien vor und führt eine vergleichende Analyse durch, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
Kapitel 4: Diskussion
Das vierte Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Analyse und ihre Implikationen für die Theorie. Es geht auch auf Limitationen der Studie ein und bietet Anknüpfungspunkte für weitere Forschung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der Politikwissenschaft, wie z. B. Politik, politische Entscheidung, politische Struktur, Fallstudie, vergleichende Analyse und Theoriebildung. Die Arbeit integriert empirische Forschungsergebnisse, um theoretische Erkenntnisse zu vertiefen und neue Einblicke in das komplexe Zusammenspiel von Politik und Strukturen zu gewinnen.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss haben japanische Medien auf den Machterhalt der LDP?
Das Mediensystem trug durch unkritische und selbstzensierende Berichterstattung maßgeblich dazu bei, dass die LDP über Jahrzehnte an der Macht blieb.
Was ist das Besondere am japanischen System der Presseclubs?
Die monopolistische Struktur der Presseclubs erlaubt es der Politik, den Informationsfluss zu steuern und negative Berichterstattung fast vollständig zu unterdrücken.
Erfüllen japanische Medien ihre Funktion als „vierte Gewalt“?
Die Arbeit zeigt, dass klassische Medienfunktionen wie Kritik und Artikulation in Japan durch paternalistisch-hierarchische Strukturen eingeschränkt sind.
Warum sind japanische Tageszeitungen so bedeutend?
Japan beherbergt die fünf größten Tageszeitungen der Welt, was dem Printsektor eine enorme, aber oft regierungsnahe Reichweite verleiht.
Was wird unter „selbstzensierender Berichterstattung“ verstanden?
Journalisten vermeiden kritische Themen oft proaktiv, um den Zugang zu Informationen innerhalb der exklusiven Presseclubs nicht zu gefährden.
Wie werden politische Entscheidungen in Japan beeinflusst?
Die Arbeit analysiert politische Strukturen und Fallstudien, um das Zusammenspiel zwischen politischer Macht und medialer Begleitung aufzuzeigen.
- Quote paper
- Julian Knab (Author), 2009, Das Mediensystem Japans, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169995