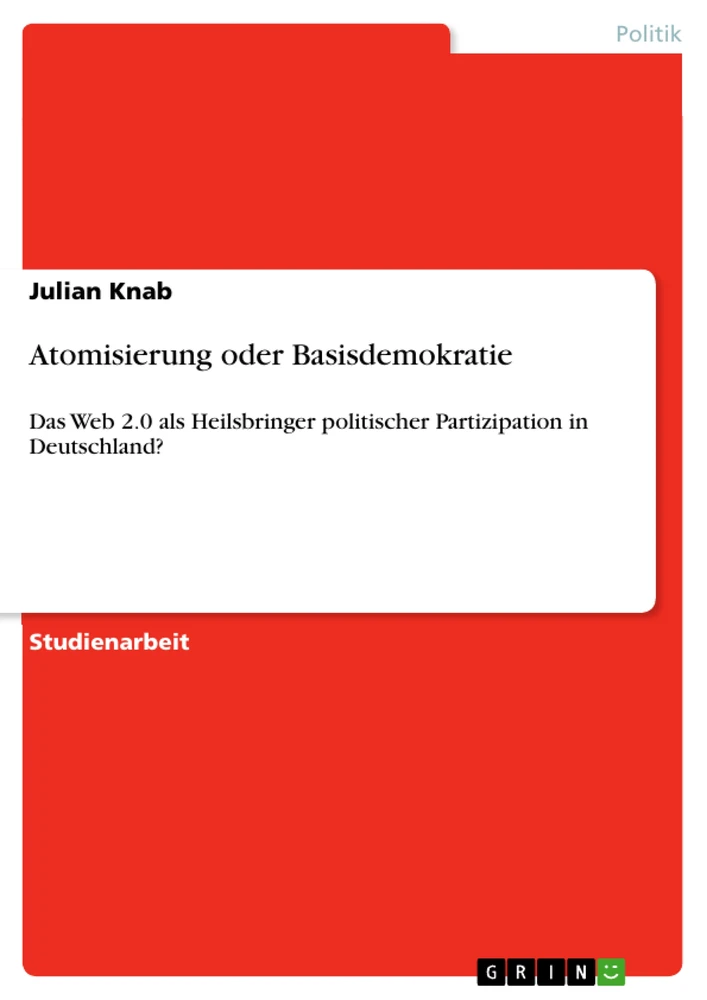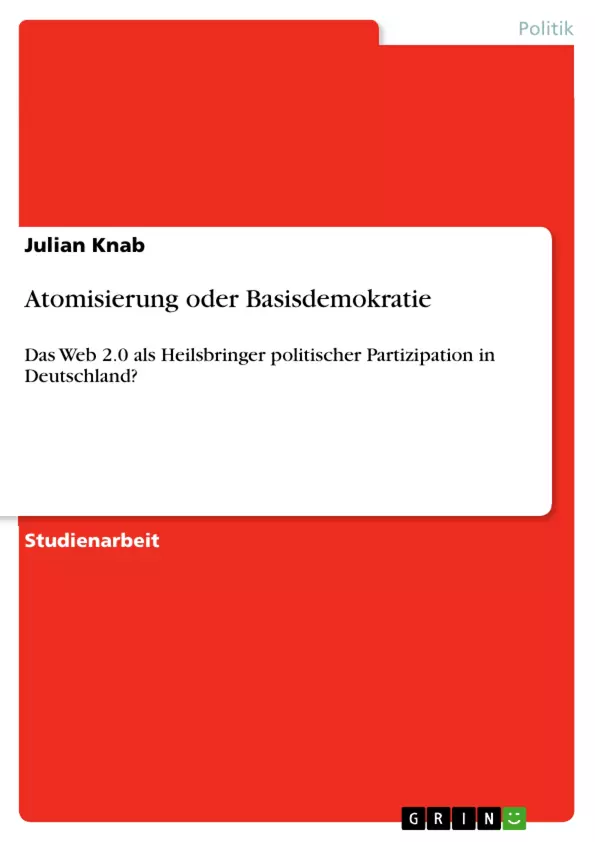In Zeiten politischer Grabenkämpfe um die „Mitte“ der Gesellschaft, deren Gunst die beiden großen Volksparteien durch politische Annäherung an die Wählerschichten der jeweils anderen zu erreichen versuchen lässt sich eine zunehmende Loslösung von ideologischen Fundamenten sowie die Tendenz zur Besetzung politischer Themen aus rein wahltaktischen Beweggründen beobachten. Ein solches System der rationalen, Stimmen-maximierenden Parteien zeigt dabei Parallelen zur Demokratietheorie Anthony Downs’. Dabei weist im Speziellen dessen „paradox of voting“ unter Annahme einer ebensolchen Kosten/Nutzen-Abwägung seitens der Bürger auf eine zu erwartende Wahlbeteiligung von null Prozent hin. Praktisch ist selbige in der Bundesrepublik seit den 70er Jahren rückläufig und erreichte bei der Wahl zum 16. Deutschen Bundestag im Jahr 2005 mit 77,7% ihren historischen Tiefststand. Zur Beseitigung des sich hieraus ergebenden, für einen Verfassungsstaat dessen Selbstverständnis nach nicht tragbaren Legitimationsdefizits ist man sich dabei über Parteigrenzen hinweg einig und postuliert die Förderung politischer Partizipation breiter Gesellschaftsschichten. Zu beachten ist dabei, dass ebendieses Konzept weit über die Ausübung des aktiven Stimmrechts hinausgeht und sich dabei in beispielsweise „autonomen“ Kreisen sogar im bewussten Fernbleiben vom Wahllokal äußern kann. Vielmehr stehen dabei engere Einbindung der Bürger in den politischen Prozess sowie die Stärkung von Bürgerinitiativen im Fokus.
Die vorliegende Arbeit soll dabei die Rolle des Internets, insbesondere des Phänomens „Web 2.0“, als möglichen Katalysator politischer Partizipation in Deutschland examinieren. Hierzu sollen zunächst anhand verschiedener Theorien die Möglichkeiten digitaler Partizipation, gleichzeitig aber auch die Gefahr eines gesamtgesellschaftlichen Bruchs zwischen „On- und Offlinern“ (Digital Divide) aufgezeigt werden. In einem dann zweiten Schritt solle der digitale status quo der Bundesrepublik anhand empirischer Studien überprüft werden, um im Folgenden zu einer wirklichkeitsgetreuen Beurteilung des Partizipation-fördernden Charakters des Mediums Internet zu gelangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Zugang
- 2.1. Politische Partizipation
- 2.2. Das Web 2.0
- 2.3. E-Democracy, E-Government & Digitale Demokratie
- 2.4. Net-Empowerment & Reinforcementthese
- 2.5. Theorie des Digital Divide
- 3. Empirische Untersuchung
- 3.1 Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2008
- 3.1.1. Methodik
- 3.1.2. Studienergebnisse
- 3.2. Emmer, Seifert & Vowe 2006
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Internets, insbesondere des Web 2.0, als potenziellen Katalysator für politische Partizipation in Deutschland. Sie analysiert die Möglichkeiten und Grenzen digitaler Partizipation anhand verschiedener Theorien und empirischer Studien. Ziel ist eine realistische Einschätzung des partizipationsfördernden Charakters des Internets.
- Politische Partizipation im digitalen Zeitalter
- Das Web 2.0 und seine Auswirkungen auf politische Prozesse
- Konzepte der E-Democracy, E-Government und digitalen Demokratie
- Theorie des Digital Divide und Net-Empowerment
- Empirische Befunde zur Online-Partizipation in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext sinkender Wahlbeteiligung in Deutschland und die daraus resultierende Notwendigkeit, die politische Partizipation zu fördern. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Rolle des Web 2.0 als Katalysator für politische Partizipation in Deutschland und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die zunehmende Loslösung von ideologischen Fundamenten in der politischen Landschaft und die Wahltaktik der Parteien werden als Ausgangspunkt diskutiert, wobei das "Paradox of Voting" von Anthony Downs als theoretischer Bezugspunkt dient. Die Arbeit beabsichtigt, die Möglichkeiten und Herausforderungen der digitalen Partizipation zu untersuchen, insbesondere im Hinblick auf die Gefahr eines Digital Divide.
2. Theoretischer Zugang: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in den Begriff der politischen Partizipation, definiert das Web 2.0 und präsentiert verschiedene Konzepte der elektronischen Bürgerbeteiligung (E-Democracy, E-Government, Digitale Demokratie). Es werden Theorien zum Einfluss des Internets auf politische Partizipation diskutiert, darunter die Net-Empowerment-These und die Theorie des Digital Divide. Der Fokus liegt auf der Erweiterung des Partizipationsbegriffs über die bloße Wahlbeteiligung hinaus und auf den limitierenden Faktoren Zeit und Raum. Die Arbeit verweist auf die Notwendigkeit, den zeitlichen und räumlichen Aufwand für Partizipation zu senken und das Bewusstsein für effektive Partizipation zu stärken.
3. Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel präsentiert empirische Befunde zu Online-Partizipation in Deutschland. Es analysiert die ARD/ZDF-Onlinestudie 2008, einschliesslich ihrer Methodik und Ergebnisse, und bezieht weitere Studien, wie die von Emmer, Seifert & Vowe (2006) ein. Der Abschnitt untersucht den aktuellen Stand der digitalen politischen Partizipation in Deutschland auf Grundlage empirischer Daten, um die These der partizipationsfördernden Wirkung des Internets zu überprüfen. Die Ergebnisse der Studien sollen eine fundierte Beurteilung ermöglichen.
Schlüsselwörter
Politische Partizipation, Web 2.0, E-Democracy, E-Government, Digitale Demokratie, Digital Divide, Net-Empowerment, Online-Partizipation, Wahlbeteiligung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Rolle des Web 2.0 für politische Partizipation in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Internets, insbesondere des Web 2.0, als potenzieller Katalysator für politische Partizipation in Deutschland. Sie analysiert die Möglichkeiten und Grenzen digitaler Partizipation anhand verschiedener Theorien und empirischer Studien und zielt auf eine realistische Einschätzung des partizipationsfördernden Charakters des Internets ab.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die politische Partizipation im digitalen Zeitalter, die Auswirkungen des Web 2.0 auf politische Prozesse, Konzepte der E-Democracy, E-Government und digitalen Demokratie, die Theorie des Digital Divide und Net-Empowerment sowie empirische Befunde zur Online-Partizipation in Deutschland.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit bezieht verschiedene Theorien ein, darunter das "Paradox of Voting" von Anthony Downs, die Net-Empowerment-These und die Theorie des Digital Divide. Sie erweitert den Partizipationsbegriff über die bloße Wahlbeteiligung hinaus und berücksichtigt limitierende Faktoren wie Zeit und Raum.
Welche empirischen Studien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die ARD/ZDF-Onlinestudie 2008 (inklusive Methodik und Ergebnisse) und die Studie von Emmer, Seifert & Vowe (2006), um den aktuellen Stand der digitalen politischen Partizipation in Deutschland zu untersuchen und die These der partizipationsfördernden Wirkung des Internets zu überprüfen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Einleitung, Theoretischer Zugang, Empirische Untersuchung und Fazit. Die Einleitung beschreibt den Kontext sinkender Wahlbeteiligung und die Forschungsfrage. Der theoretische Zugang definiert zentrale Begriffe und präsentiert relevante Theorien. Die empirische Untersuchung analysiert die genannten Studien. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Politische Partizipation, Web 2.0, E-Democracy, E-Government, Digitale Demokratie, Digital Divide, Net-Empowerment, Online-Partizipation, Wahlbeteiligung, Deutschland.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist eine realistische Einschätzung des partizipationsfördernden Charakters des Internets bezüglich der politischen Partizipation in Deutschland. Die Arbeit untersucht, ob und wie das Web 2.0 die politische Beteiligung der Bürger fördert und welche Herausforderungen dabei bestehen.
- Citation du texte
- Julian Knab (Auteur), 2009, Atomisierung oder Basisdemokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170003