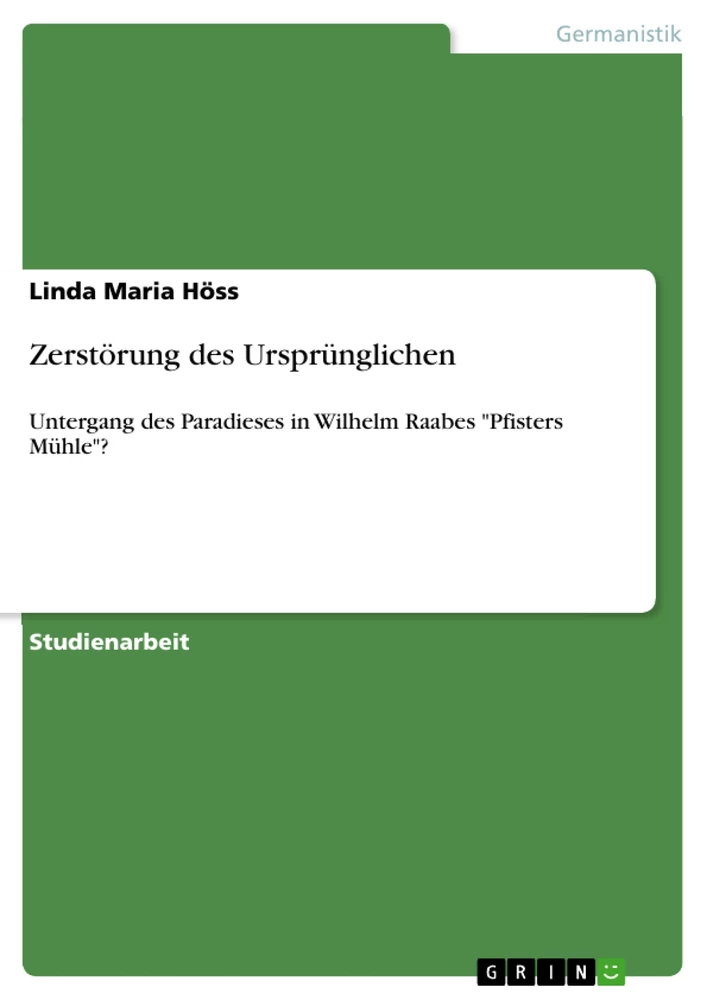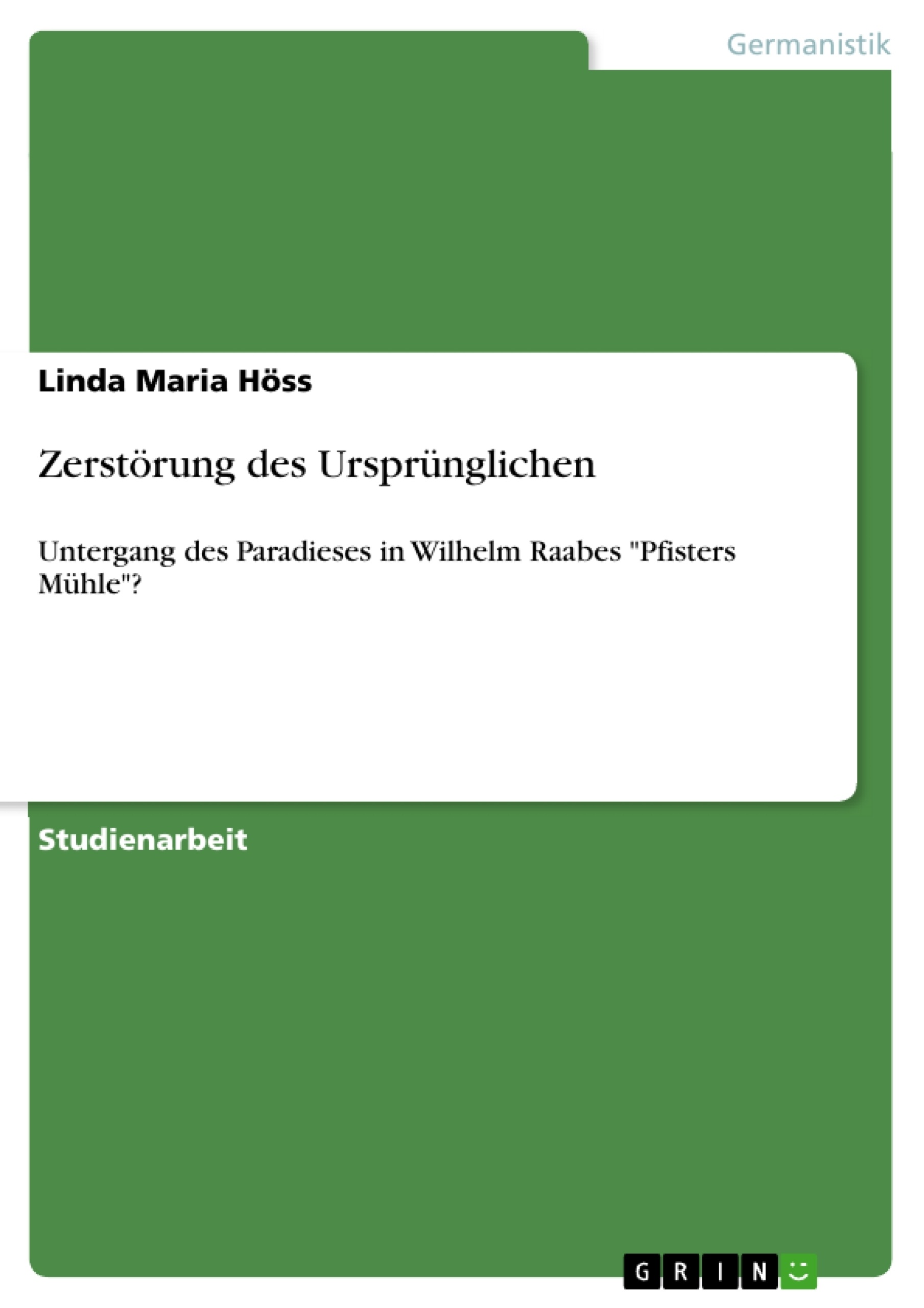Wilhelm Raabe erzählt in Pfisters Mühle die folgenschwere Veränderung des Landschaftsbildes wie auch der natürlichen Lebensbedingungen für Mensch und Tier durch die aufkommende industrielle Entwicklung. Die Mühle des alten Pfisters ist Schauplatz dieses gesellschaftlichen Umbruchs. Eine Zuckerrübenfabrik aus Krickerode leitet verunreinigte, industrielle Abfälle in den Mühlbach ein. Dies hat zur Folge, dass der ehemals so frische und lebendige Bach zu einer tötenden Kloake verkommt. Die Fische im Bach sterben. Das Mühlrad kann sich nicht mehr drehen, denn der zähflüssige Schlamm blockiert das Rad. Der alte Pfister strebt einen Prozess gegen die Zuckerrübenfabrik an, den er auch gewinnt. Schlussendlich ist die alte, traditionsreiche Mühle trotz aller Bemühungen dem Untergang geweiht. An ihrer Stelle soll eine Fabrik errichtet werden. Der gesellschaftliche Fortschritt bemächtigt sich allem, was den anwachsenden Effizienzkriterien nicht entspricht. Der alte Pfister verkauft sein Vätererbe und stirbt, er hat jeglichen Lebenswillen verloren. Das Spannungsverhältnis zwischen Natur und Kultur wird deutlich: Der Mensch greift im Zuge seines stetigen Strebens nach beständiger Weiterentwicklung in die unberührte Natur ein. Aus einer symbiotischen Lebensweise, wie sie der alte Pfister im Einklang mit der Natur führt, entwickelt sich ein Verdrängungswettkampf – durch den Menschen eingefordert. Das zweite Kapitel der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich – zunächst aus philosophischer Perspektive – mit eben diesem Spannungsverhältnis zwischen Natur und Kultur. Es soll geklärt werden, als was ‚Natur‘ zu verstehen ist und wie sich das Naturbild in Pfisters Mühle zusammensetzt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Was war und ist Natur?
- 2.1 Der Naturbegriff in Pfisters Mühle
- 3.0 Das Naturbild des Mütterlichen und Guten
- 3.1 Abwesenheit des Mütterlichen
- 4.0 Pfisters Mühle: Paradiesische Idylle?
- 4.1 Wasser als Urbild der Idylle
- 4.2 Der Garten Eden
- 5.0 Destruktion der Idylle
- 5.1 Idylle als ein, Ort' des Vergänglichen
- 5.2 Verwirkte Idylle: Zerstörung der ursprünglichen Natur
- 5.3 Krise des Paradieses: der Sündenfall
- 6.0 Schlussfolgerungen: Untergang des Guten und Schönen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit untersucht die Darstellung des Untergangs des Paradieses in Wilhelm Raabes Roman „Pfisters Mühle“. Der Fokus liegt auf der Destruktion der ursprünglichen Natur durch die aufkommende Industrialisierung und die damit verbundenen Veränderungen des Landschaftsbildes und der Lebensbedingungen von Mensch und Tier.
- Das Spannungsverhältnis zwischen Natur und Kultur
- Die Entwicklung des Naturbegriffs in der Moderne
- Die Rolle der Idylle als verklärtes Naturbild
- Der Einfluss der Industrialisierung auf die Lebenswelt
- Die Ambivalenz des Fortschritts
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik des Romans „Pfisters Mühle“ ein und beleuchtet den Konflikt zwischen Natur und Kultur im Kontext der Industrialisierung. Kapitel 2 analysiert den Wandel des Naturbegriffs in der Moderne und die Bedeutung der ursprünglichen Natur im Roman. Kapitel 3 befasst sich mit der Rolle der Abwesenheit des Mütterlichen und der Verbindung zwischen Natur und Gutem im Roman. In Kapitel 4 wird das Konzept der Idylle in „Pfisters Mühle“ untersucht, wobei der Fokus auf der Funktion von Wasser als Urbild der Idylle und dem Paradies-Topos liegt. Kapitel 5 beleuchtet die Motive, die das Bild der Idylle umkehren oder gar auflösen, und analysiert die Folgen der Destruktion der ursprünglichen Natur.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Natur, Kultur, Idylle, Industrialisierung, Fortschritt, Paradies, Destruktion, Umweltschutz, Lebensbedingungen, Mütterlichkeit, Vergänglichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Wilhelm Raabes Roman „Pfisters Mühle“?
Der Roman thematisiert die Zerstörung einer traditionellen Mühle und der umgebenden Natur durch die industrielle Verschmutzung einer Zuckerrübenfabrik.
Wie wird das Spannungsverhältnis zwischen Natur und Kultur dargestellt?
Natur wird als ursprüngliche Idylle und Lebensraum gezeigt, der durch den rücksichtslosen Fortschritt der Kultur (Industrie) verdrängt und zerstört wird.
Welche Rolle spielt das Wasser im Roman?
Wasser dient als Urbild der Idylle. Die Verwandlung des frischen Bachs in eine „tötende Kloake“ symbolisiert den Sündenfall durch die Industrialisierung.
Was symbolisiert der „alte Pfister“?
Er steht für die alte, symbiotische Lebensweise im Einklang mit der Natur, die den neuen Effizienzkriterien der Moderne nicht mehr standhalten kann.
Gibt es im Roman eine Hoffnung auf Rettung der Natur?
Trotz eines gewonnenen Prozesses gegen die Fabrik ist die Mühle dem Untergang geweiht, was die Unaufhaltsamkeit des industriellen Fortschritts unterstreicht.
Welche philosophischen Aspekte werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht den Naturbegriff der Moderne und die Idylle als Ort des Vergänglichen im Kontext des gesellschaftlichen Umbruchs.
- Citation du texte
- Linda Maria Höss (Auteur), 2010, Zerstörung des Ursprünglichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170030