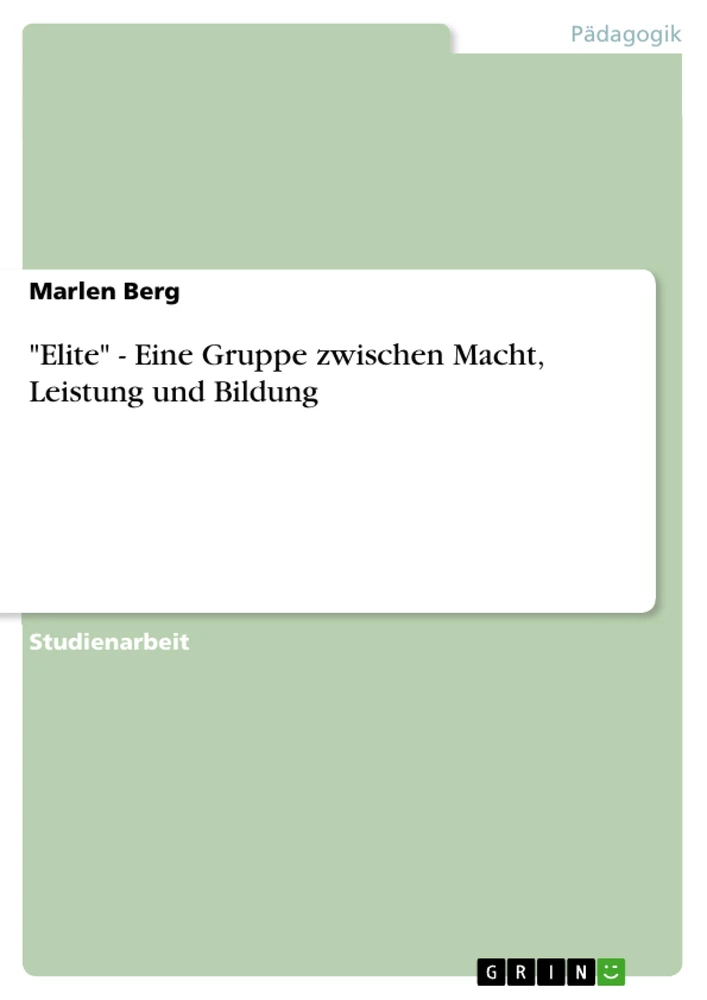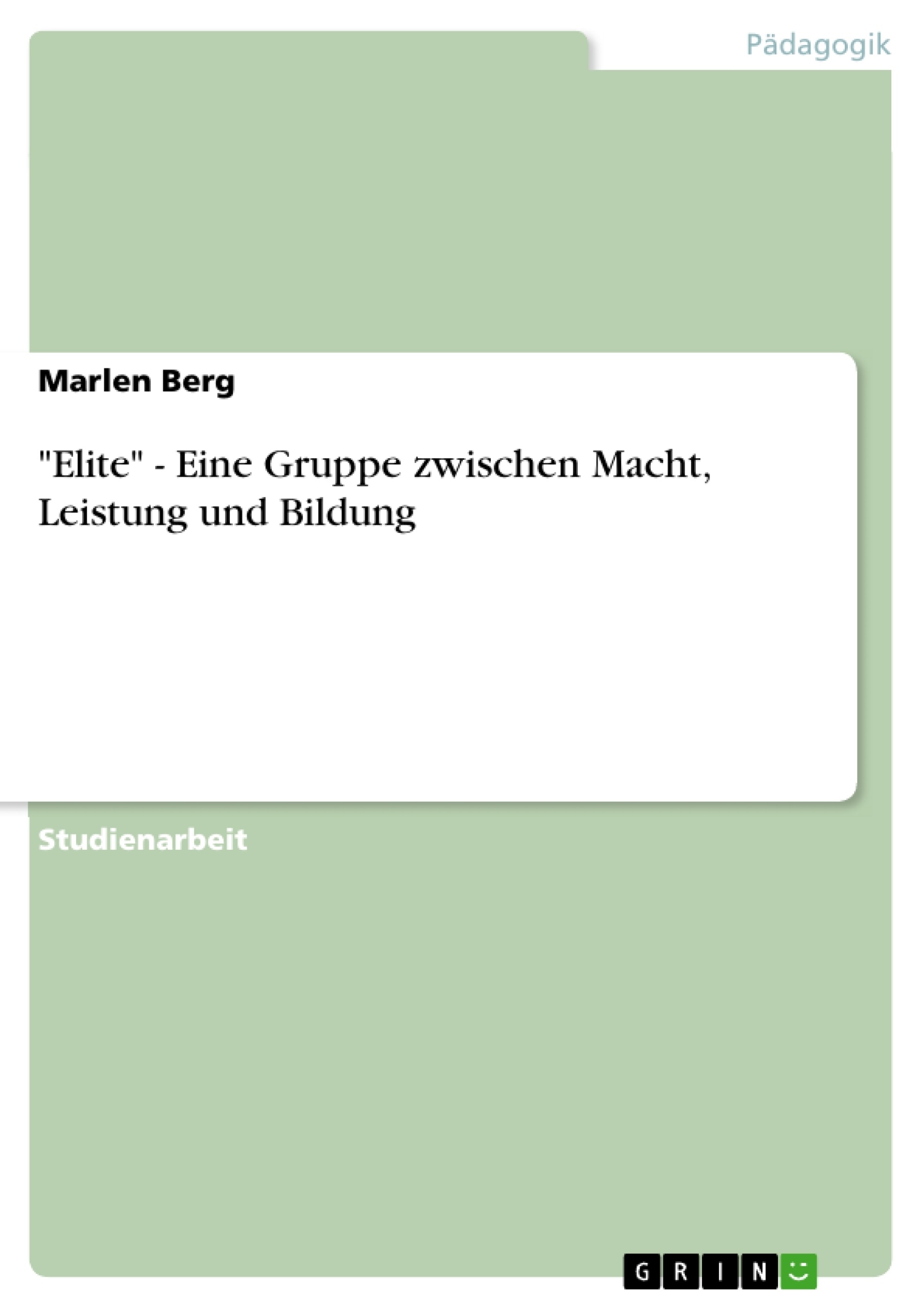Egal ob während der Abiturzeit, des Studiums oder des beruflichen Lebensweges; zu verschiedenen Zeitpunkten kann ein Jeder auf den Begriff „Elite“ treffen. Bildungs-, Wirtschafts- und politische Kreise stellen sogenannte „Eliten“ und werfen dadurch die Frage auf, was darunter zu verstehen ist und wer sich dazu zählen kann. Bei genauer Betrachtung wird ersichtlich, dass „Elite“ sogar im privaten Raum Einzug gefunden hat (→ Elitepartner.de). Der Terminus erlebt eine wahre Renaissance und Ausbreitung im nationalen Raum. Es stellen sich die Fragen: Wer sind die Eliten des 21. Jahrhunderts und wie haltbar ist der Begriff noch? Diesbezüglich werde ich zu Beginn meiner Arbeit eine Definition anführen. Weiterhin möchte ich erste Probleme aufzeigen, die im Zusammenhang mit „Elite“ auftreten und Gründe für die Ablehnung dieser Gruppierung darstellen.
Noten und herausragende schulische und studentische Leistungen werden als Einfluss- und Aufstiegsfaktor genannt und erwecken den Anschein, dass jedem die Möglichkeiten offen stehen Spitzenpositionen zu erwerben (Meritokratie). Speziell im internationalen Kontext gewinnt der Terminus an Bedeutung und zwingt Deutschland sich dem weltweiten Vergleich zu stellen. Folglich gilt es zu untersuchen, ob die Bezeichnung „Elite“ als ein Güte- oder Qualitätsmerkmal zu verstehen und wie berechtigt die Klassifizierung ist. In diesem Zusammenhang untersuche ich die Selektionskriterien für die Zugehörigkeit. Hierbei lieg der Fokus auf der Herkunft, dem Bildungsgrad und dem (erwünschten) Habitus der „Elitegruppen“.
Abschließend wende ich mich der Frage nach dem Geschlecht der Eliten zu, denn bei ersten Überlegungen werden einem selten weibliche Elite-Zugehörigen ins Gedächtnis gerufen. Besonders als Frau, angehende Hochschulabsolventin und als ehrenamtliche Helferin in der geschlechtsspezifischen Kinder- und Jugendarbeit fühle ich mich durch diese Thematik angesprochen. Im Sinne der Chancengleichheit der Geschlechter lohnt es sich die prozentuale Verteilung von Männern und Frauen zu betrachten und nach Gründen für diese zu suchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- „Elite“ – Ein Begriff mit Unstimmigkeiten
- Die Selektionskriterien der „Eliten“
- Habitus
- Leistung
- Bildung
- „Elite“ ist männlich!
- Fazit
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Begriff „Elite“ und seine Relevanz im 21. Jahrhundert. Sie setzt sich zum Ziel, die Definition des Begriffs zu beleuchten, die Unstimmigkeiten in seiner Verwendung zu analysieren und die Kriterien für die Zugehörigkeit zu „Elitegruppen“ zu untersuchen.
- Die Definition und Bedeutung des Begriffs „Elite“
- Die Herausforderungen und Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung des Begriffs „Elite“
- Die Selektionskriterien für die Zugehörigkeit zu „Elitegruppen“, insbesondere Herkunft, Bildung und Habitus
- Die geschlechtsspezifische Unterrepräsentanz von Frauen in „Elitepositionen“
- Die Rolle von Leistung und Bildung im Kontext von „Elitegruppen“
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Begriffs „Elite“ im Bildungswesen, der Wirtschaft und der Politik heraus und führt in die Problemstellungen ein, die im Zusammenhang mit dem Begriff entstehen.
„Elite“ – Ein Begriff mit Unstimmigkeiten
Dieser Abschnitt beleuchtet die Vielschichtigkeit des Begriffs „Elite“ und die Schwierigkeiten, die mit seiner Definition und Verwendung verbunden sind. Es werden verschiedene Synonyme und Interpretationen des Begriffs diskutiert.
Die Selektionskriterien der „Eliten“
Dieses Kapitel untersucht die Kriterien, die für die Zugehörigkeit zu „Elitegruppen“ maßgeblich sind. Der Fokus liegt dabei auf den Merkmalen „Habitus“, „Leistung“ und „Bildung“. Die Bedeutung dieser Kriterien für die Rekrutierung und den Aufstieg in „Elitegruppen“ wird anhand verschiedener Beispiele erläutert.
„Elite“ ist männlich!
Dieser Abschnitt widmet sich dem Thema der geschlechtsspezifischen Unterrepräsentanz von Frauen in „Elitepositionen“. Die Arbeit beleuchtet die Ursachen für diese Ungleichheit und diskutiert die Rolle von Bildung, Karrierewegen und traditionellen Geschlechterrollen in diesem Kontext.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Erforschung des Begriffs „Elite“ in den Bereichen Bildung, Wirtschaft und Politik. Sie untersucht die Definition, die Rekrutierungskriterien und die soziale Konstruktion von „Elitegruppen“. Darüber hinaus werden die Geschlechterungleichheit in der „Elite“ und die Bedeutung von Bildung, Leistung und Habitus als Selektionskriterien analysiert.
Häufig gestellte Fragen
Wer gehört zur „Elite“ des 21. Jahrhunderts?
Die Arbeit untersucht Eliten in Politik, Wirtschaft und Bildung und stellt fest, dass die Zugehörigkeit heute oft über Leistung, Bildungstitel und einen bestimmten Habitus definiert wird.
Was bedeutet der Begriff „Habitus“ im Elite-Kontext?
Nach Pierre Bourdieu beschreibt Habitus das Auftreten, den Lebensstil und die Verhaltensweisen einer Person, die oft unbewusst signalisieren, ob jemand zu einer sozialen Gruppe dazugehört.
Ist die Auswahl der Eliten wirklich meritokratisch?
Obwohl das Leistungsprinzip (Meritokratie) betont wird, zeigt die Arbeit, dass die soziale Herkunft nach wie vor ein entscheidender Filter für den Zugang zu Spitzenpositionen ist.
Warum sind Frauen in Elitepositionen unterrepräsentiert?
Gründe liegen in traditionellen Geschlechterrollen, strukturellen Barrieren in Karrierewegen und der männlichen Prägung vieler Elite-Netzwerke.
Welche Rolle spielt die Bildung bei der Elite-Selektion?
Bildungstitel fungieren als „Eintrittskarten“. In Deutschland gewinnt dabei der internationale Vergleich und der Besuch bestimmter Exzellenz-Universitäten an Bedeutung.
- Arbeit zitieren
- Marlen Berg (Autor:in), 2011, "Elite" - Eine Gruppe zwischen Macht, Leistung und Bildung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170067