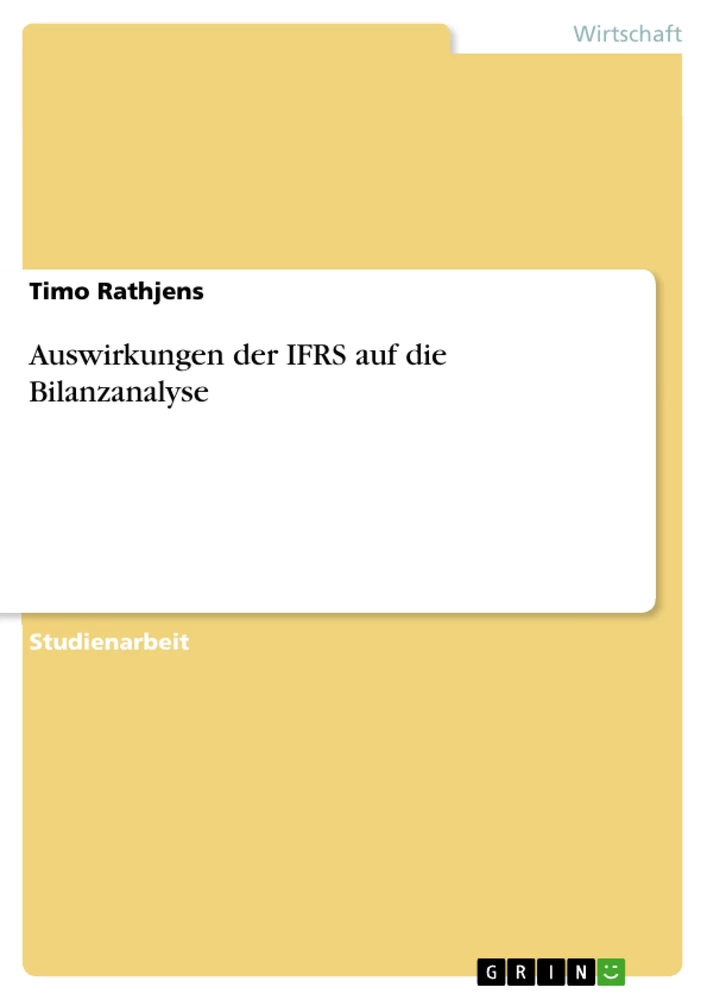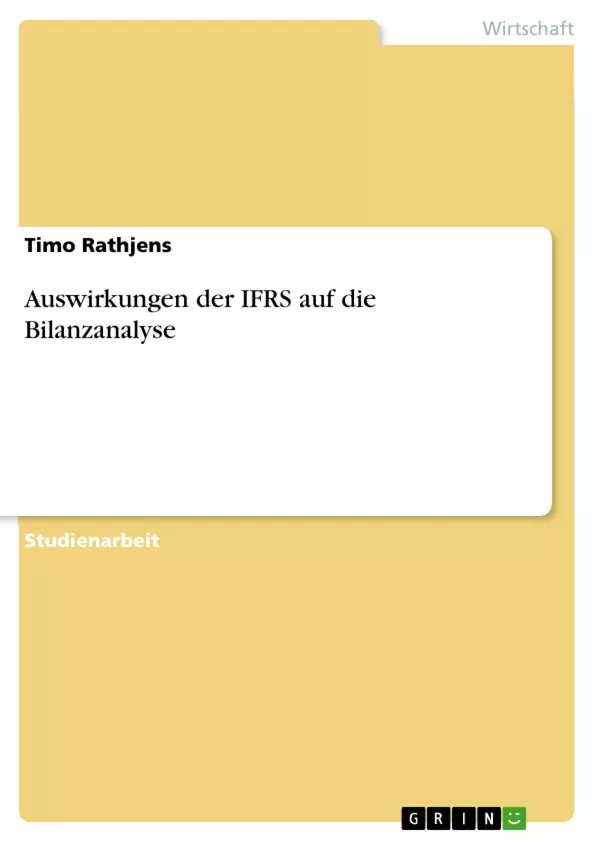Die International Financial Reporting Standards (IFRS) sind nunmehr seit 2005 für kapitalmarktorientierte Konzerne in Deutschland verpflichtender Standard zur Veröffentlichung ihrer Abschlüsse. Dies erforderte zunächst parallele Buchführungen in den betroffenen Unternehmen, da auch nach den IFRS vergleichende Zahlen aus dem Vorjahr zwingend im Geschäftsbericht anzugeben sind und erleichternde Vorschriften nach IFRS 1.22 fehlten. Untersuchungen aus der Zeit bis 2005, wie sich die daraus entstehenden Unterschiede quantitativ äußerten, konnten daher präzise Ergebnisse liefern. Das Ergebnis war eine Erhöhung der Aktiva und der Bilanzsumme, sowie einer damit einhergehenden Erhöhung des Konzernergebnisses.
Das, für Geschäftsjahre ab 2010 beginnend, umgesetzte Bilanzrechtsmodernisie-rungsgesetz (BilMoG) sollte zu einer Annäherung deutscher Rechnungslegungsstandards an die IFRS führen. Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen dies auf die Größen einzelner Bilanzpositionen und Bilanzkennzahlen hat. Gerade vor dem Hintergrund der Finanzkrise gab es zum Regierungsentwurf des BilMoG durchaus kritische Stimmen aus der Wissenschaft.
In dieser Arbeit sollen die Unterschiede zwischen dem HGB nach BilMoG und den IFRS dargestellt werden. Grundlage ist die Konzernbilanz der Deutschen Post AG zum 31.12.2010. Sie ist erstellt nach den IFRS und wird in die Maßstäbe transferiert, die ihr auf Konzernebene nach Handelsrecht zugrunde liegen würde. Hierbei werden ausgewählte aktive Bilanzpositionen hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Ansatz- und Bewertungsmethoden dargestellt und –sofern eine verlässliche Annahme erstellt werden kann- korrigiert. Abschließend werden die sich daraus resultierenden Bewegungen in der Bilanz, der GuV-Rechnung, sowie einzelner Bilanzkennzahlen bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung HGB und IFRS
- Handelsgesetzbuch (HGB)
- International Financial Reporting Standard (IFRS)
- Umwandlung der IFRS-Bilanz in die Maßstäbe nach deutschem Handelsrecht
- Grundlagen
- Posten Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte unter den Immateriellen Vermögenswerten
- Posten Firmenwerte unter den Immateriellen Vermögenswerten
- Posten Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien
- Posten Langfristige finanzielle Vermögenswerte, Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte und kurzfristige finanzielle Vermögenswerte
- Posten Aktive latente Steuern, Passive latente Steuern
- Posten Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte
- Darstellung ausgesuchter Kennzahlen
- Grundlagen
- Kennzahlenermittlung
- Kennzahlenbewertung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Auswirkungen der International Financial Reporting Standards (IFRS) auf die Bilanzanalyse. Sie untersucht die Unterschiede zwischen dem Handelsgesetzbuch (HGB) nach Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) und den IFRS, indem sie die Konzernbilanz der Deutschen Post AG zum 31.12.2010 als Grundlage verwendet. Die Arbeit korrigiert ausgewählte aktive Bilanzpositionen hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Ansatz- und Bewertungsmethoden und bewertet die sich daraus ergebenden Bewegungen in der Bilanz, der GuV-Rechnung sowie einzelner Bilanzkennzahlen.
- Unterschiede zwischen HGB nach BilMoG und IFRS
- Auswirkungen der IFRS-Anwendungen auf die Bilanzanalyse
- Bewertung der Bilanzpositionen und Kennzahlen
- Analyse der Konzernbilanz der Deutschen Post AG
- Korrektur von Bilanzpositionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der IFRS-Anwendungen in Deutschland ein und stellt die Relevanz der Untersuchung dar. Kapitel 2 definiert die Begrifflichkeiten des HGB und der IFRS. Kapitel 3 analysiert die Umwandlung der IFRS-Bilanz in die Maßstäbe nach deutschem Handelsrecht, wobei verschiedene Bilanzpositionen hinsichtlich ihrer Ansatz- und Bewertungsmethoden untersucht werden. Kapitel 4 erläutert die Darstellung ausgesuchter Kennzahlen und deren Bewertung.
Schlüsselwörter
IFRS, HGB, Bilanzanalyse, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), Deutsche Post AG, Konzernbilanz, Kennzahlen, Ansatz- und Bewertungsmethoden, Immaterielle Vermögenswerte, Finanzinvestitionen, Aktive latente Steuern, Passive latente Steuern, Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen HGB und IFRS in der Bilanzanalyse?
Während das HGB (nach BilMoG) stärker vom Vorsichtsprinzip geprägt ist, zielen die IFRS auf die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen für Investoren ab, was oft zu höheren Bilanzsummen und Konzernergebnissen führt.
Welche Auswirkungen hat die IFRS-Umstellung auf die Bilanzsumme?
Untersuchungen zeigen, dass die Anwendung von IFRS in der Regel zu einer Erhöhung der Aktiva und der Bilanzsumme sowie zu einem höheren ausgewiesenen Konzernergebnis führt.
Was war das Ziel des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG)?
Das BilMoG sollte die deutschen Rechnungslegungsstandards (HGB) an die internationalen Standards (IFRS) annähern, ohne das bewährte HGB-System vollständig aufzugeben.
Welches Unternehmen dient als Fallbeispiel in der Arbeit?
Als Grundlage für den Vergleich dient die Konzernbilanz der Deutschen Post AG zum Stichtag 31.12.2010.
Welche Bilanzpositionen werden speziell untersucht?
Untersucht werden unter anderem selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte, Firmenwerte, als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien sowie aktive und passive latente Steuern.
- Quote paper
- Timo Rathjens (Author), 2011, Auswirkungen der IFRS auf die Bilanzanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170124