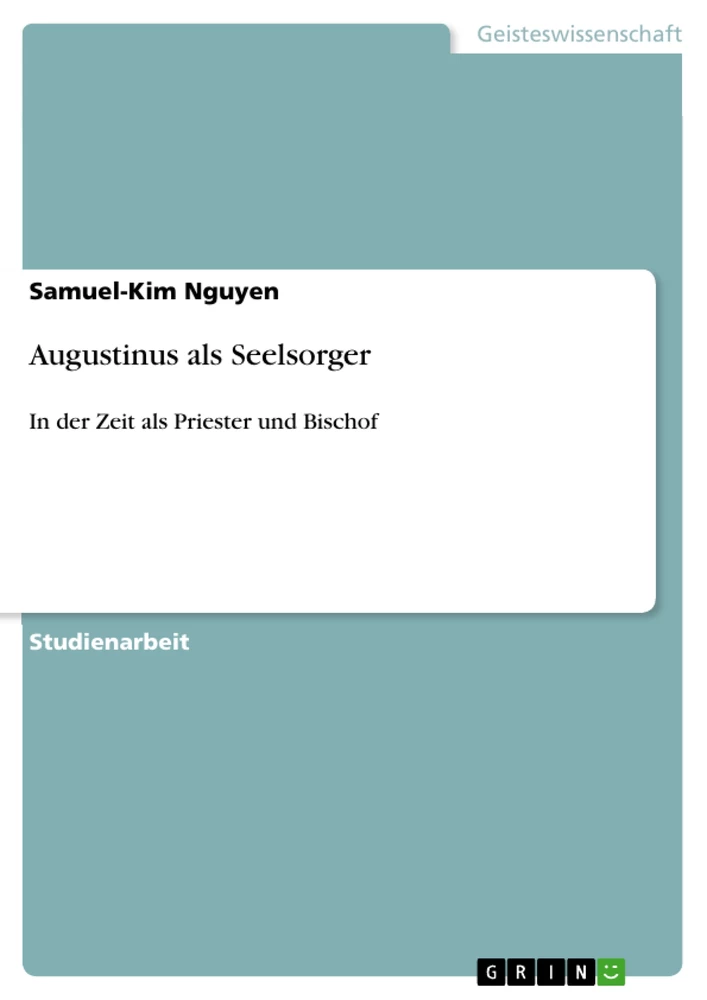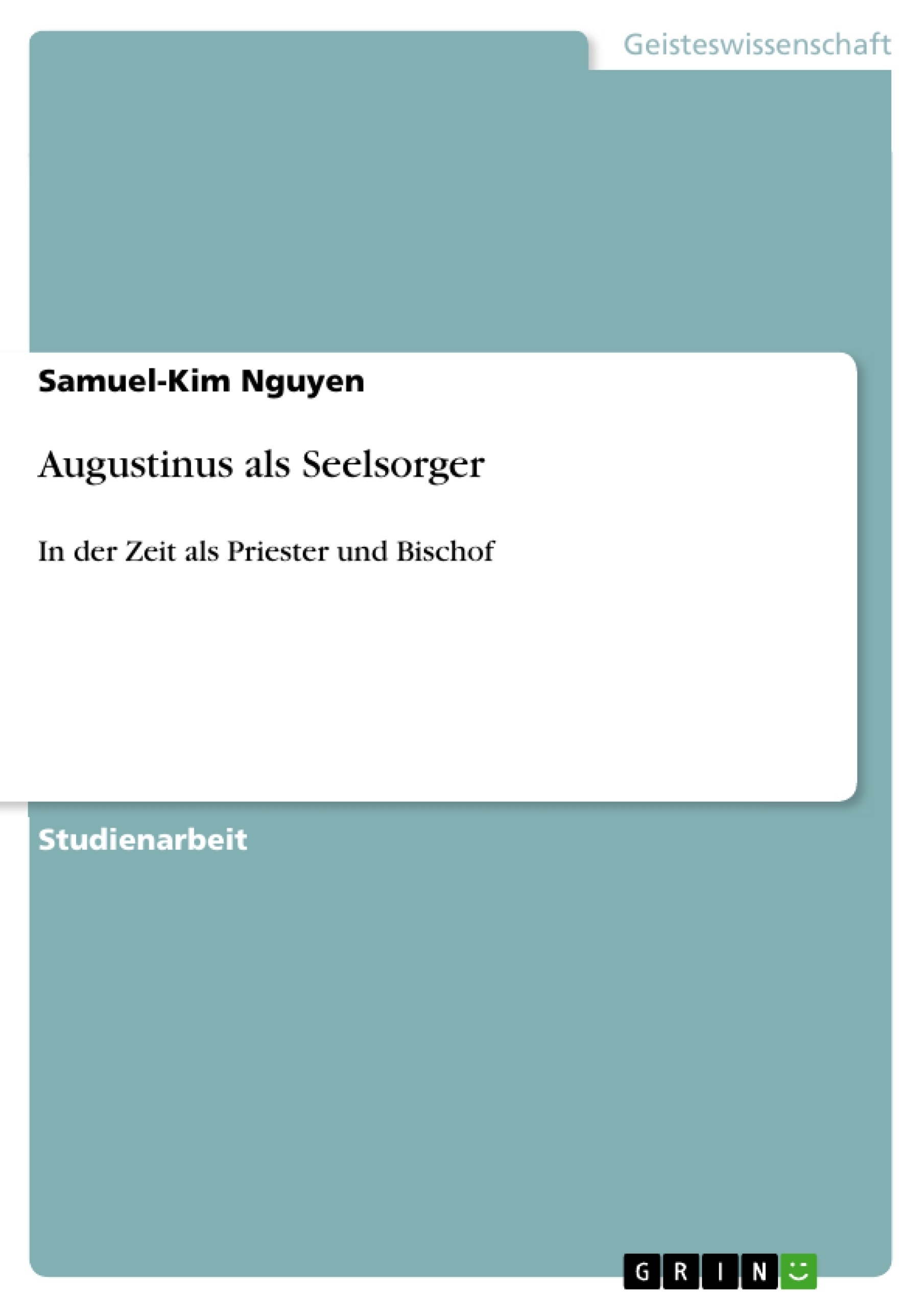„Vobis enim sum episcopus, vobiscum sum Christianus.” (AUGUSTINUS, Sermones 340, 1 (PL 38, 1483)), so beschreibt Bischof Augustinus von Hippo in einer Predigt das Bischofsamt. Dieses Zitat eröffnet eine Spannung zwischen dem einfachen „Christ sein“ und der verantwortungsvollen, seelsorgerischen Aufgabe für die Menschen da zu sein, sie zu leiten und zu begleiten.
Da die Forschung über das Leben und Wirken des Augustinus ausgebildet ist, ist es relativ leicht Übersichten und Biographien zu finden. Schwieriger ist es, die Tätigkeit nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, der Seelsorge, zu untersuchen.
Nachdem im ersten Schritt eine Übersicht über den Empfang der Weihen gegeben werden soll, wird in einem zweiten Schritt die Frage, wie Seelsorge überhaupt beschrieben werden kann eine Rolle spielen. Dabei soll auf die zeitliche Veränderung, Entwicklung und Bedeutung des Begriffes eingegangen und eine mögliche Bedeutung für eine Einschätzung zu Augustinus geklärt werden
In einem ausführlicheren Teil werden die Aufgabenfelder und Tätigkeiten des Augustinus in seiner seelsorgerischen Funktion beschrieben und analysiert. Im Überblick soll die Richterfunktion, die „audientia episcopalis“, des Augustinus als ein Bestand der Seelsorge untersucht werden.
Als Literatur und Quellen dienen unter anderem die Standardwerke von van der Meer und Brown sowie verschiedene Briefe, Predigten und Werke Augustinus‘. Die Schwierigkeit liegt dabei in der Fülle der unterschiedlichen Quellen, da sich Augustinus zur Seelsorge in vielen seiner Werke äußert. In dieser Hausarbeit wird versucht werden, wichtige und grundlegende Ansichten und Verhaltensgrundzüge des Kirchenlehrers darzustellen.
Wichtig ist bei der Untersuchung stets die Unterscheidung zwischen den Ansichten und Gedanken Augustinus‘, die er in seinen Werken beschreibt und dem historischen Verhalten, wie wir es aus anderen Quellen, aber auch in Augustins eigenen Schriften finden.
Frederik van der Meer, einer der bekanntesten Augustinus-Biografen, überschreibt sein Werk mit dem Titel „Augustinus der Seelsorger“. Wie Augustinus sein Seelsorger-Sein umsetzte, welche Schwerpunkte er setzte und wie er selber darüber dachte sind zentrale Fragestellungen dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Weihen
- Die Priesterweihe
- Die Bischofsweihe
- Der Seelsorgebegriff
- Philosophischer Hintergrund
- Kirchengeschichtlicher Hintergrund
- Gegenwart
- Seelsorge und Verkündigung bei Augustinus
- Situation in der Kirche von Hippo Regius
- Die Antworten Augustinus'
- Predigt-, Katechese- und Verkündigungsdienst
- Kampf gegen die Manichäer und Donatisten
- Verhalten zu den Armen
- Organisation der Gemeinde und der Diözese
- Richterfunktion
- Audientia episcopalis
- Richtertätigkeit
- Befähigung Augustinus'
- Ansichten Augustinus‘
- Gesetz
- Gerechtigkeit
- Richteramt
- Wahrheitsfindung
- Urteilen
- Beispiel aus der Tätigkeit Augustinus'
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der seelsorgerischen Tätigkeit des Kirchenvaters Augustinus von Hippo. Sie untersucht, wie Augustinus als Priester und später als Bischof die Aufgaben der Seelsorge in seiner Zeit wahrgenommen hat. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung des Seelsorgebegriffs und der konkreten Umsetzung in den verschiedenen Aufgabenfeldern Augustinus', insbesondere der Richterfunktion.
- Die Entwicklung des Seelsorgebegriffs im historischen Kontext
- Die Seelsorgetätigkeiten Augustinus' als Priester und Bischof
- Die Rolle der Verkündigung und des Kampfes gegen Häresien in Augustinus' Seelsorge
- Die Bedeutung der Richterfunktion in der Seelsorge Augustinus'
- Die Ansichten Augustinus' über Gesetz, Gerechtigkeit und Wahrheitsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über die Forschungslage zu Augustinus und die Schwerpunkte der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet Augustinus' Priester- und Bischofsweihe, wobei die Besonderheiten und Herausforderungen dieser Ereignisse hervorgehoben werden. Kapitel 3 widmet sich dem Seelsorgebegriff und seiner Entwicklung im historischen Kontext, wobei philosophische, kirchengeschichtliche und zeitgenössische Aspekte betrachtet werden. Kapitel 4 analysiert Augustinus' Seelsorgepraxis, insbesondere seine Predigt-, Katechese- und Verkündigungsarbeit sowie seinen Umgang mit Häresien und Armen. Kapitel 5 untersucht die Organisation der Gemeinde und der Diözese, wobei die Richterfunktion Augustinus' im Fokus steht. In diesem Kapitel werden seine Ansichten über Gesetz, Gerechtigkeit, Wahrheitsfindung und Urteilen beleuchtet. Abschließend werden in den Schlussbemerkungen die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Augustinus von Hippo, Seelsorge, Bischofsamt, Priesterweihe, Bischofsweihe, Verkündigung, Predigt, Katechese, Manichäer, Donatisten, Richterfunktion, Audientia episcopalis, Gesetz, Gerechtigkeit, Wahrheitsfindung, Urteilen.
Was war Augustinus' Verständnis vom Bischofsamt?
Augustinus sah sich als "Bischof für die Menschen" und "Christ mit den Menschen", was die Spannung zwischen seiner Leitungsfunktion und seiner persönlichen Gläubigkeit beschreibt.
Was ist die "audientia episcopalis"?
Es handelt sich um die bischöfliche Gerichtsbarkeit, bei der Augustinus als Richter in zivilen Streitfällen fungierte, was er als Teil seiner seelsorgerischen Pflicht ansah.
Welche Rolle spielte die Verkündigung in seiner Seelsorge?
Predigt und Katechese waren zentrale Werkzeuge, um die Gemeinde in Hippo Regius zu leiten und sie gegen Häresien wie den Manichäismus oder Donatismus zu stärken.
Wie dachte Augustinus über Gerechtigkeit und Urteilen?
Augustinus strebte nach einer Wahrheitsfindung, die auf göttlichem Gesetz und christlicher Barmherzigkeit basierte, auch wenn ihn die Last des Richteramtes oft bedrückte.
Welche Quellen werden zur Untersuchung seiner Tätigkeit herangezogen?
Die Arbeit stützt sich auf Briefe, Predigten und Werke Augustinus' sowie auf Standardbiographien von Forschern wie Peter Brown oder van der Meer.