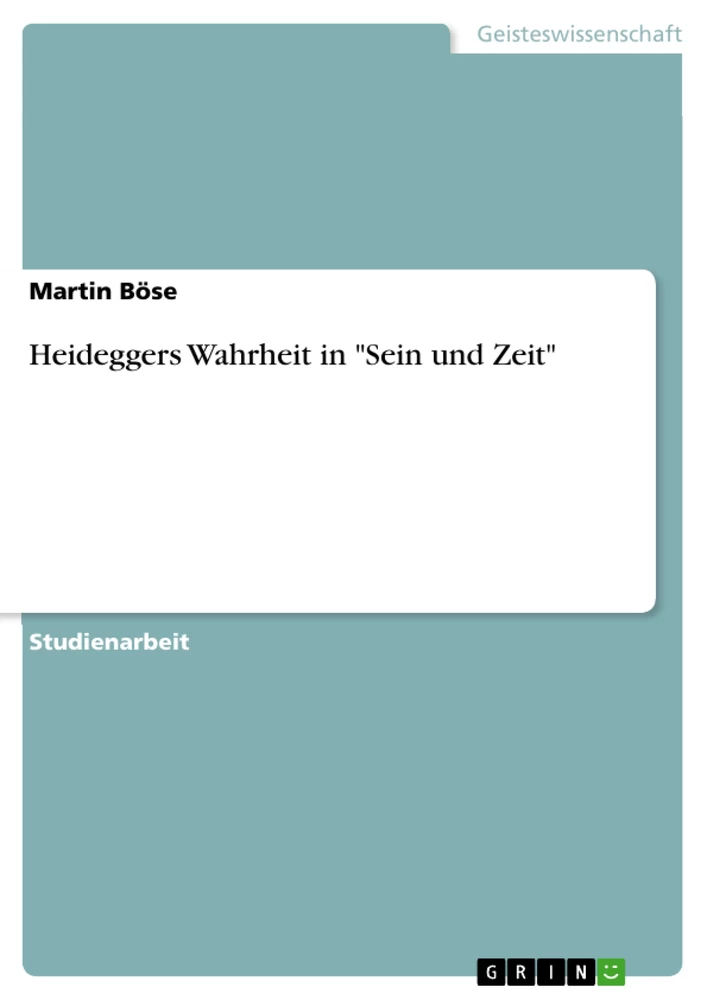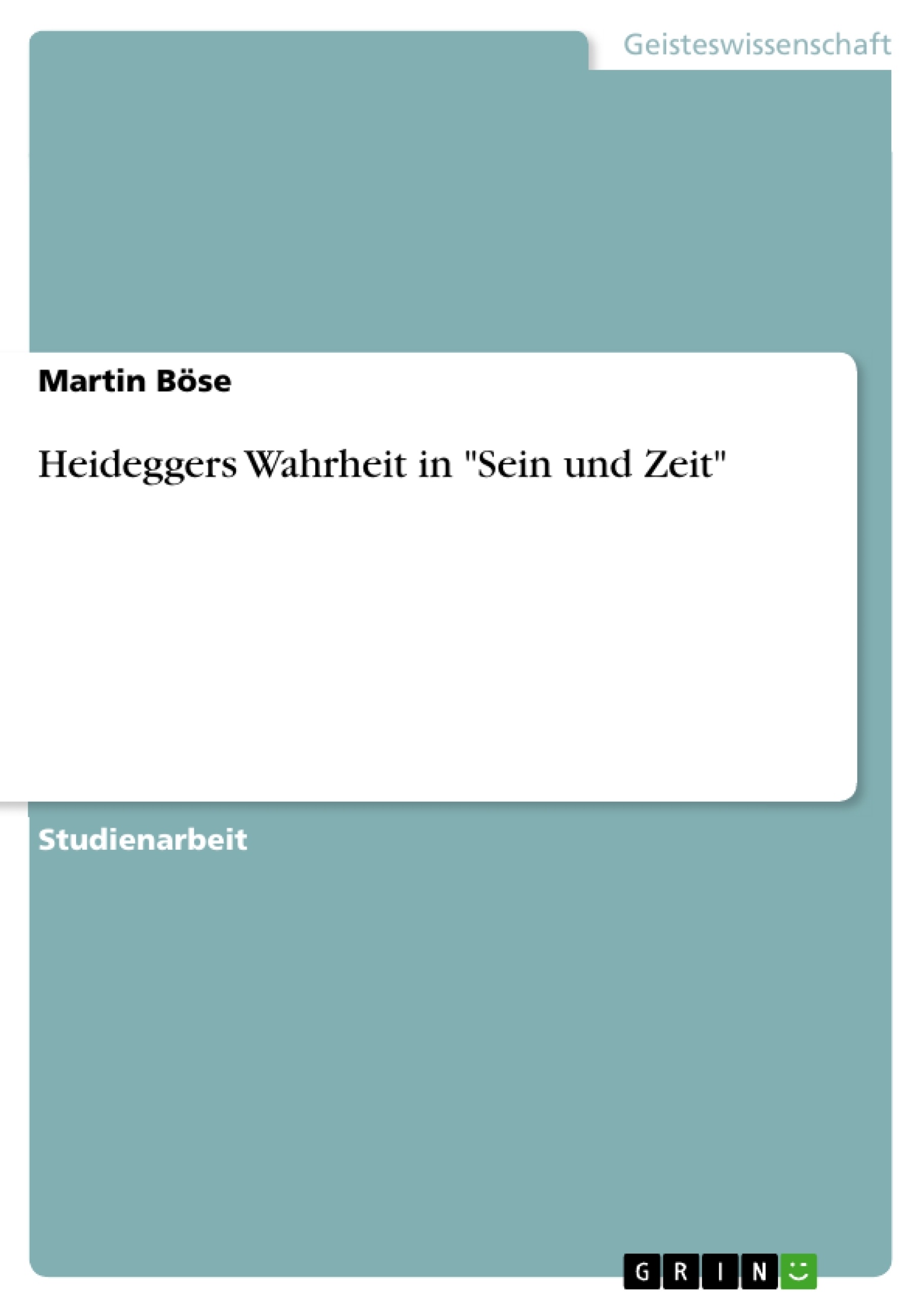1. Einleitung
In dieser Arbeit soll der Wahrheitsbegriff Heideggers dargestellt werde. Die Hauptpunkte der Untersuchung sollen die §§43 „Dasein, Weltlichkeit und Realität“ und 44 „Dasein, Erschlossenheit und Wahrheit“ sein. Um diese Paragraphen durchdringen zu können ist es aber nötig einige vorgängige Paragraphen aus „Sein und Zeit“ näher zu beleuchten. Denn Heidegger entwickelt in diesen das Fundament seiner Untersuchung zur Wahrheit. Das Verständnis der zu untersuchenden Abschnitte hängt so stark mit den vorgängig untersuchten Begrifflichkeiten zusammen, dass dieses Vorgehen unbedingt angezeigt ist.
So werden nacheinander die Paragraphen zwölf „Die Vorzeichnung des In-der-Welt-seins aus der Orientierung am In-Sein als solchem“, dreizehn „Die Exemplifizierung des In-Seins an einem fundiertem Modus. Das Welterkennen.“, §27 „Das alltägliche Selbstsein und das Man“, §29 „Das Da-sein als Befindlichkeit“, §31. „Das Da-sein als Verstehen“, §32. „Verstehen und Auslegung“, §33. „Die Aussage als abkünftiger Modus der Auslegung“ §34. „Da-sein und Rede. Die Sprache“, §35. „Das Gerede“, §36. „Die Neugier“, §37. „Die Zweideutigkeit“, §38. „Das Verfallen und die Geworfenheit“, §41. „Das Sein des Daseins als Sorge“ dargestellt. Die Grundbegriffe, ‚In-der-Welt-sein’, ‚Befindlichkeit’, ‚Verstehen’, ‚Auslegung’ und ‚Aussage’ scheinen zunächst nicht erklärungsbedürftig, jedoch erhalten sie in der heideggerschen Verwendung andere Konnotationen und Bedeutungen, die den Leser zu einer näheren Betrachtung ‚zwingen’. Ebenso verhält es sich mit den uneigentlichen Seinsweisen dem ‚Gerede’, der ‚Neugier’ und der ‚Zweideutigkeit’.
Wenn diese erste Aufgabe abgeschlossen ist, kann mit der Darstellung der Paragraphen §43 „Dasein, Weltlichkeit und Realität“ und §44. „Dasein, Erschlossenheit und Wahrheit“ fortgefahren werden. Am Ende soll eine kurze Zusammenfassung des Ergebnisses stehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundbegriffe
- 2.1 Das In-der-Welt-sein
- 2.2 Das Welterkennen
- 2.3 Das alltägliche Selbstsein und das Man
- 2.4 Die Befindlichkeit
- 2.5 Das Verstehen
- 2.6 Die Auslegung
- 2.7 Die Aussage als abkünftiger Modus der Auslegung
- 2.8 Da-sein und Rede. Die Sprache
- 2.9 Die Sorge
- 3. Die uneigentlichen Seinsformen des Daseins
- 3.1 Das Gerede
- 3.2 Die Neugier
- 3.3 Die Zweideutigkeit
- 3.4 Das Verfallen und die Geworfenheit
- 4. Wahrheit und Realität
- 4.1 §43 Dasein, Weltlichkeit und Realität
- 4.2 §44. Dasein, Erschlossenheit und Wahrheit
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Heideggers Wahrheitsbegriff in „Sein und Zeit“, fokussiert auf die Paragraphen 43 und 44. Die Zielsetzung ist die Darstellung von Heideggers Wahrheitsverständnis, basierend auf einer Analyse der grundlegenden Begriffe und Seinsweisen des Daseins. Dies erfordert die Untersuchung vorangehender Paragraphen, um das Fundament seiner Argumentation zu verstehen.
- Heideggers Verständnis von Dasein und Sein
- Die Rolle der Weltlichkeit im Dasein
- Der Begriff der Wahrheit bei Heidegger
- Die Analyse der "uneigentlichen" Seinsweisen
- Das Verhältnis von Dasein, Erschlossenheit und Wahrheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Analyse von Heideggers Wahrheitsbegriff in "Sein und Zeit," speziell in den Paragraphen 43 und 44. Es wird argumentiert, dass ein Verständnis dieser Paragraphen eine vorherige Auseinandersetzung mit den zentralen Begriffen und Konzepten des Werks erfordert, da Heidegger seine Argumentation auf früher eingeführten Konzepten aufbaut. Die Einleitung skizziert den methodischen Aufbau der Arbeit, welcher eine schrittweise Erläuterung der relevanten Paragraphen vorsieht, beginnend mit den grundlegenden Begriffen und Seinsweisen.
2. Grundbegriffe: Dieses Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis von Heideggers Philosophie. Es beleuchtet zentrale Begriffe wie "In-der-Welt-sein", "Welterkennen", "Befindlichkeit", "Verstehen" und "Auslegung". Diese Begriffe werden nicht nur definiert, sondern auch in ihrem Kontext zueinander und in Bezug auf die Seinsweise des Daseins erläutert. Der Fokus liegt auf der Darstellung der spezifischen Bedeutung dieser Begriffe im Rahmen von Heideggers Ontologie, wobei gezeigt wird, wie sie von den gängigen Interpretationen abweichen und eine neue Perspektive auf das menschliche Sein eröffnen. Die Kapitel verdeutlicht, dass das "In-der-Welt-sein" nicht als räumliche Beziehung verstanden werden darf, sondern als Seinsverfassung des Daseins.
3. Die uneigentlichen Seinsformen des Daseins: Das Kapitel behandelt verschiedene „uneigentliche“ Seinsweisen des Daseins, wie "Gerede", "Neugier" und "Zweideutigkeit". Es wird analysiert, wie diese Seinsweisen das authentische Sein des Daseins behindern und in ein „Verfallen“ führen. Die Geworfenheit des Daseins und seine existentiale Sorge werden in diesem Zusammenhang diskutiert, um zu zeigen, wie das Dasein in seiner Weltlichkeit verhaftet ist und dennoch die Möglichkeit zur Authentizität besitzt. Heidegger verdeutlicht, wie die alltägliche Existenz durch oberflächliche Kommunikation, unreflektierte Neugier und die Vermeidung von Entscheidungen geprägt ist. Die Analyse dieser uneigentlichen Seinsweisen dient als Kontrast zum authentischen Sein.
Schlüsselwörter
Heidegger, Sein und Zeit, Wahrheitsbegriff, Dasein, In-der-Welt-sein, Weltlichkeit, Realität, Erschlossenheit, Befindlichkeit, Verstehen, Auslegung, uneigentliche Seinsweisen, Gerede, Neugier, Zweideutigkeit, Verfallen, Geworfenheit, Sorge.
Häufig gestellte Fragen zu Heidegger's "Sein und Zeit" (Kapitel 43 & 44)
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über Martin Heideggers Werk "Sein und Zeit", fokussiert auf die Kapitel 43 und 44. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Zielsetzung und der behandelten Themen, Kapitelzusammenfassungen und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf Heideggers Wahrheitsbegriff und dessen Kontext innerhalb seiner Ontologie.
Welche Kapitel werden behandelt?
Das Dokument behandelt hauptsächlich die Kapitel 43 und 44 von Heideggers "Sein und Zeit", welche sich mit Dasein, Weltlichkeit, Realität und Wahrheit befassen. Um diese Kapitel zu verstehen, werden jedoch vorherige Kapitel und grundlegende Begriffe ausführlich erläutert. Das Inhaltsverzeichnis umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Grundbegriffen (In-der-Welt-sein, Befindlichkeit, Verstehen etc.), ein Kapitel zu uneigentlichen Seinsformen (Gerede, Neugier, Zweideutigkeit) und ein abschließendes Fazit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind Heideggers Verständnis von Dasein und Sein, die Rolle der Weltlichkeit im Dasein, der Begriff der Wahrheit bei Heidegger, die Analyse der "uneigentlichen" Seinsweisen des Daseins und das Verhältnis von Dasein, Erschlossenheit und Wahrheit. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Paragraphen 43 und 44 im Kontext der gesamten Argumentationslinie Heideggers.
Was sind die zentralen Begriffe in Heideggers Philosophie laut diesem Dokument?
Zentrale Begriffe sind Dasein, Sein, In-der-Welt-sein, Weltlichkeit, Realität, Erschlossenheit, Befindlichkeit, Verstehen, Auslegung, uneigentliche Seinsweisen (Gerede, Neugier, Zweideutigkeit), Verfallen, Geworfenheit und Sorge. Das Dokument erklärt diese Begriffe und ihre Beziehungen zueinander innerhalb des Kontextes von Heideggers Ontologie.
Wie werden die "uneigentlichen Seinsweisen" des Daseins beschrieben?
Die "uneigentlichen Seinsweisen" wie Gerede, Neugier und Zweideutigkeit werden als hinderliche Faktoren für das authentische Sein des Daseins beschrieben. Sie führen zu einem "Verfallen" und verhindern ein reflektiertes und verantwortliches Dasein. Die Geworfenheit des Daseins und die existentiale Sorge werden in diesem Zusammenhang diskutiert.
Welche Zielsetzung verfolgt dieses Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, Heideggers Wahrheitsverständnis in "Sein und Zeit" (Paragraphen 43 und 44) darzustellen. Dies geschieht durch eine Analyse der grundlegenden Begriffe und Seinsweisen des Daseins. Das Verständnis der vorherigen Kapitel ist essenziell, um die Argumentation in den Paragraphen 43 und 44 zu erfassen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Die Schlüsselwörter umfassen: Heidegger, Sein und Zeit, Wahrheitsbegriff, Dasein, In-der-Welt-sein, Weltlichkeit, Realität, Erschlossenheit, Befindlichkeit, Verstehen, Auslegung, uneigentliche Seinsweisen, Gerede, Neugier, Zweideutigkeit, Verfallen, Geworfenheit, Sorge. Diese Wörter repräsentieren die zentralen Konzepte und Begriffe, die im Dokument behandelt werden.
- Citar trabajo
- Martin Böse (Autor), 2011, Heideggers Wahrheit in "Sein und Zeit", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170268