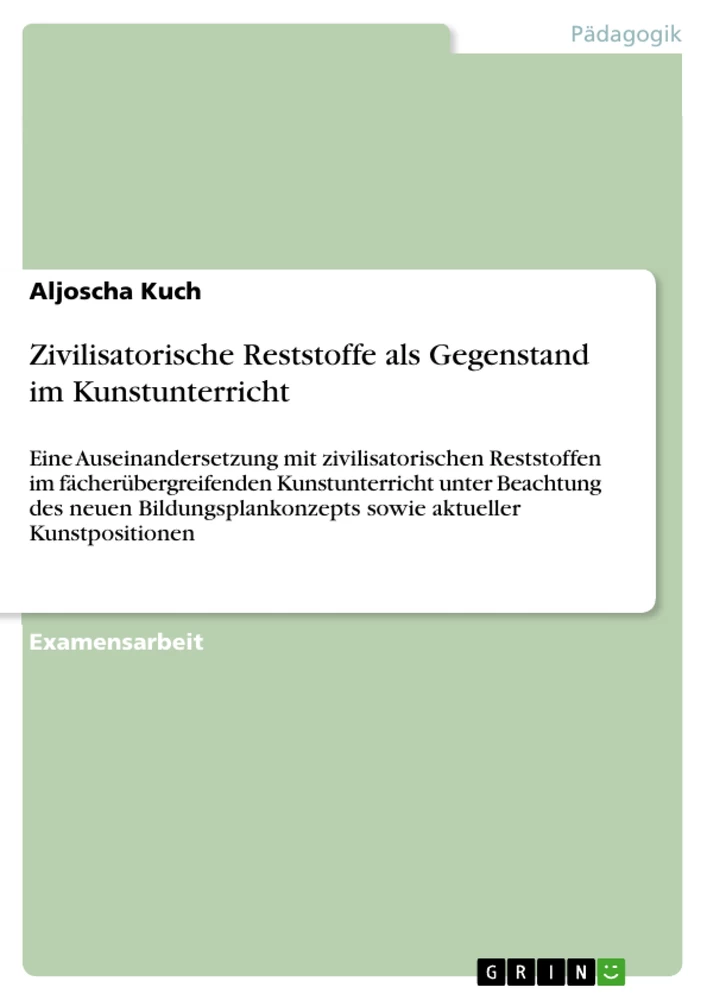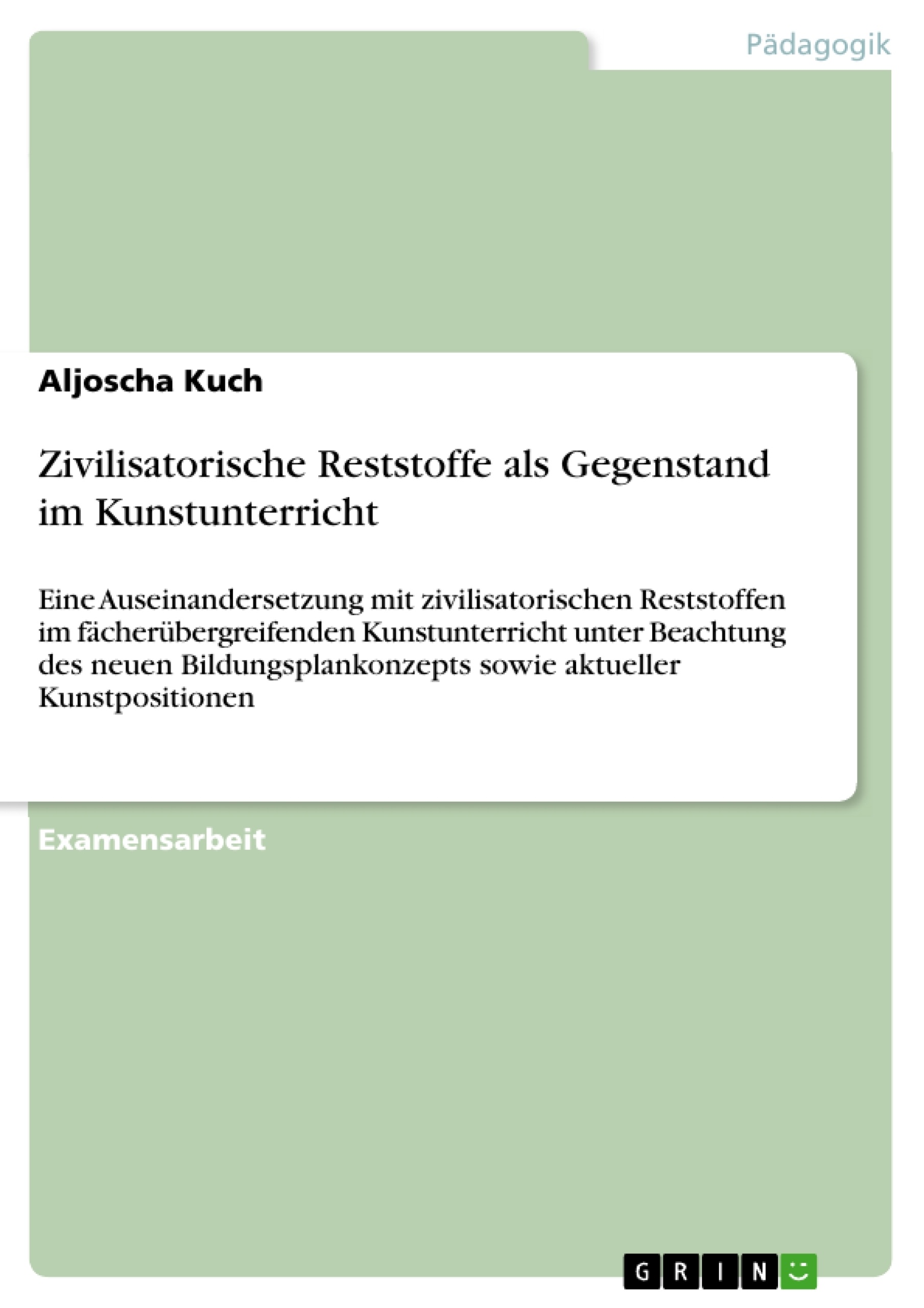Diese Arbeit möchte unter der Prämisse des neuen Bildungsplans (GS: Natur und Kultur) eine Brücke bauen, innerhalb des neu entstehenden Bereichs einer Verschmelzung von Kunst mit Heimat- und Sachunterricht bzw. Biologie und der daraus resultierenden Ökologieverantwortung.
Die Intention zu diesem Thema kam mir in Westafrika – Dakar. Durch die ethnologische Relation anderer Lebensweisen und speziell dem Umgang mit Abfall entdeckte ich eine neue Faszination für das einfache Leben und dem direkten Lebensweltbezug unseres Handelns. Die großen Unterschiede im Lebensstandard und der Rechte der Bevölkerung zusammen mit dem Wissen um die Ungerechtigkeit des globalen Welthandels entwickelten bei mir den Wunsch eine neue Sensibilität für unseren (zu) hohen Lebensstandard herauszuarbeiten.
Ich möchte in dieser Arbeit deduktiv vorgehen, damit die erarbeitet Basis für immer neue Konkretionen und Situationen verwendet werden kann. Dadurch ergibt sich allerdings eine aufwendige, theoretische, hermeneutisch geprägte Arbeit, um einen ausreichend umfassenden allgemeinen Rahmen und überblickenden Standpunkt zu gewährleisten. Ich hoffe, dass mir das durch Auswertung sowohl rechts- und wirtschaftswissenschaftlicher Werke der Recyclingindustrie, soziologischer und christlich-ethischer Auseinandersetzungen als auch durch die Sondierung der Kunstgeschichte und aktueller Künstlerpositionen einigermaßen gelungen ist.
Ich möchte die Chance wahrnehmen, rechtzeitig Konzepte für einen gelingenden, anspruchsvollen Unterricht im Rahmen des neuen Bildungsplankonzepts zu bieten.
Dabei steht an erster Stelle die umfangreiche Auseinandersetzung mit dem gewählten Problembereich zivilisatorischer Reststoffe.
Die phänomenologische Auseinandersetzung mit Müll im weiteren Sinne, also mit Recyclingverfahren und Umgang mit Müll in unserer Gesellschaft, soll eine Betrachtung darüber sein, gängige Alltagsprozesse und Tätigkeitsprinzipien, die in einer intakten modernen Gesellschaft nötig sind, für den Kunstunterricht zu nutzen und deren Gehalt für künstlerische Produktion fruchtbar zu machen. Weiter geht es darum, diese Alltagsmechanismen im Künstlerhandeln aktueller Künstler wiederzufinden, und nicht zuletzt die kunstpädagogische Praxis zu reflektieren und auf ihre Verbindung hin zu und auf ihren Nutzen für die Lebenswelt der Kinder und späteren Gestalter unserer Gesellschaft zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort - Einleitung
- 1 Zivilisatorische Reststoffe - Symptom und Herausforderung unserer Gesellschaft
- 1.1 Definitionen
- 1.2 Phänomenologie
- 1.3 Das Recyceln
- 1.4 Das Sammeln
- 1.5 Das Werfen und das Knüllen
- 1.6 Umwelterziehung durch Müllsensibilisierung
- 2 Der Aspekt Abfall in der Kunst
- 2.1 Der Aspekt Abfall in Kunstgeschichtlichem Rückblick
- 2.2 Der Aspekt Abfall in der aktuellen Kunst
- 3 Elemente kunstpädagogischer Arbeit zum Thema Abfall
- 3.1 Basiselement Ästhetik
- 3.2 Basiselement Wissenschaft und Kunst
- 3.3 Basiselement Handwerk
- 3.4 Basiselement soziale Verantwortung
- 3.5 Basiselement Philosophieren
- 3.6 Basiselement Spiel
- 3.7 Abschließender Gedanke
- 4 Konzeption einer Lerneinheit zum Thema Abfall im Sinne des neuen Lehrplans der Grundschule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, im Kontext des neuen Bildungsplans für die Grundschule (Natur und Kultur) eine Brücke zwischen Kunst, Heimat- und Sachunterricht sowie Biologie zu schlagen und die damit verbundene ökologische Verantwortung zu beleuchten. Die Arbeit untersucht die Bedeutung zivilisatorischer Reststoffe im Kunstunterricht und erörtert die Möglichkeiten, die sich aus dem Umgang mit Abfall für die künstlerische Produktion ergeben.
- Definition und Phänomenologie von zivilisatorischen Reststoffen
- Recyclingverfahren und die Rolle von Müll in unserer Gesellschaft
- Die Bedeutung von Abfall in der Kunstgeschichte und aktuellen Kunstpositionen
- Kunstpädagogische Ansätze und ihre Relevanz für den Umgang mit Abfall im Unterricht
- Die Entwicklung einer Lerneinheit zum Thema Abfall, die den neuen Bildungsplan der Grundschule berücksichtigt
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die Definition und Phänomenologie von zivilisatorischen Reststoffen, wobei die rechtliche, handlungspraktische, zeitliche und räumliche Dimension sowie die Materialität von Abfall im Fokus stehen. Es werden verschiedene Recyclingverfahren und der Umgang mit Müll in unserer Gesellschaft untersucht.
Kapitel 2 erkundet die Bedeutung von Abfall in der Kunst, sowohl im historischen Kontext als auch in aktuellen Kunstpositionen. Es werden verschiedene Künstler und ihre Werke vorgestellt, die Abfall als Material oder Thema verwenden.
Kapitel 3 analysiert verschiedene kunstpädagogische Ansätze und deren Relevanz für den Umgang mit Abfall im Unterricht. Es werden die Basiselemente Ästhetik, Wissenschaft und Kunst, Handwerk, soziale Verantwortung, Philosophieren und Spiel beleuchtet.
Kapitel 4 skizziert die Konzeption einer Lerneinheit zum Thema Abfall im Sinne des neuen Bildungsplans der Grundschule. Es werden die Rahmenbedingungen, die Materialbeschaffung und die Organisation der Lerneinheit sowie eine konkrete Unterrichtseinheit vorgestellt.
Schlüsselwörter
Zivilisatorische Reststoffe, Abfall, Müll, Recycling, Kunst, Kunstgeschichte, Kunstpädagogik, Bildungsplan, Grundschule, Ökologie, Umwelterziehung, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung.
- Quote paper
- M.A. Aljoscha Kuch (Author), 2003, Zivilisatorische Reststoffe als Gegenstand im Kunstunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170388