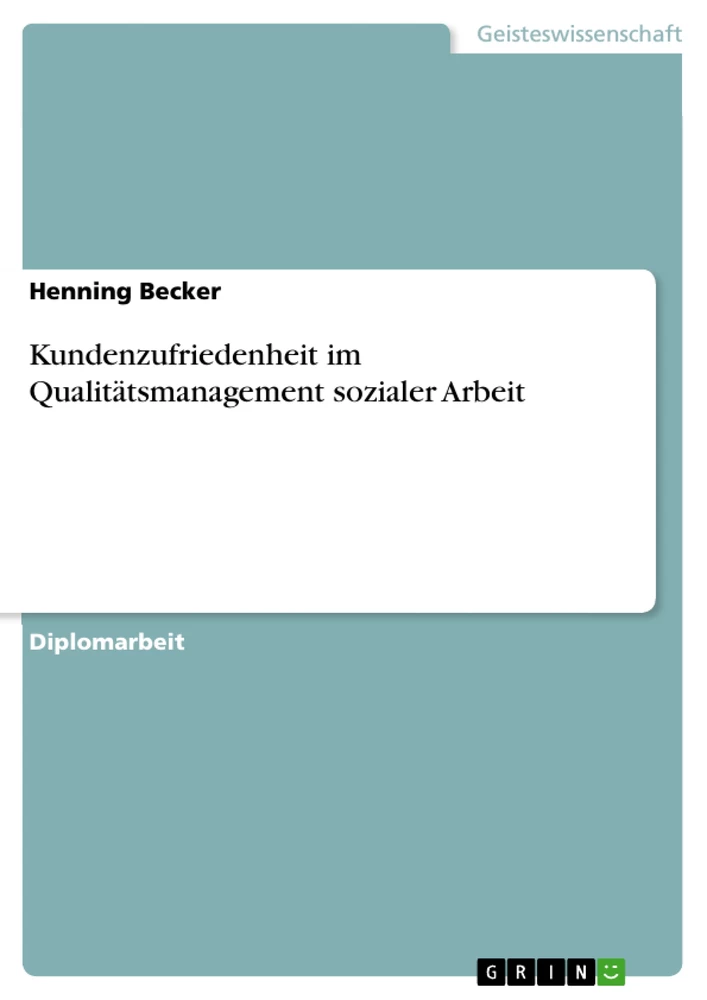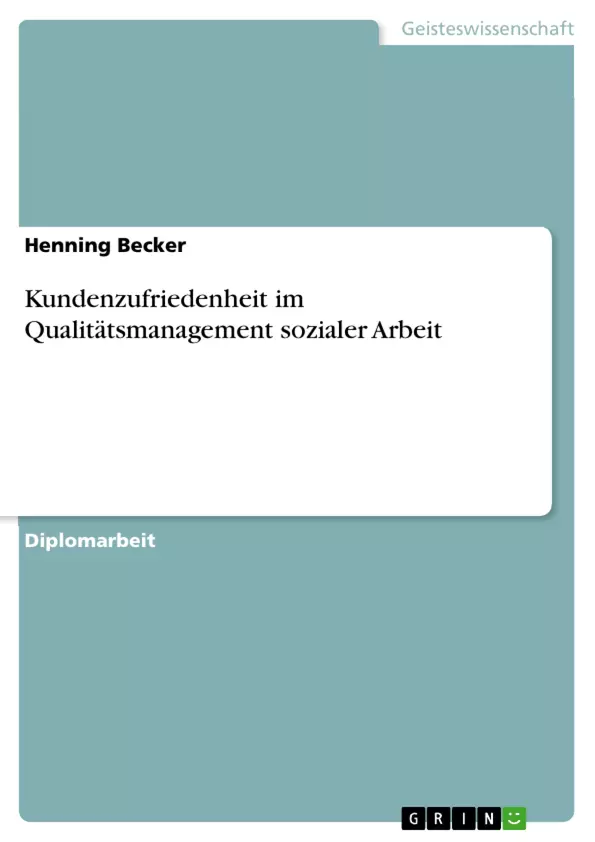„Der Kunde ist König“ oder „Der Klient steht im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns“. Wie oft liest man diese oder ähnlich lautende Formulierungen in Unternehmensphilosophien oder sog. Leitbildern? Sehr häufig. Derart wohlklingende Sätze wurden schon immer propagiert – sowohl im unternehmerischen Bereich als auch in der sozialen Arbeit.
Dennoch kam vor einigen Jahrzehnten ein „Schlagwort“ auf, das die Bedeutung des Kunden weiter verstärkte. Die Rede war vom Qualitätsmanagement. Von nun an sollte die gesamte Qualität der Arbeit noch mehr als vorher einer Person zugute kommen: dem Kunden. Alle Arbeitsprozesse galt es, nach ihm und seinen Bedürfnissen auszurichten.
Anfang der 90er Jahre erhielt diese Diskussion auch in der sozialen Arbeit Einzug und mit ihr viele verschiedene Ansätze, die die vermeintlich zentrale Rolle des Klienten festigen sollten. Bei diesen Annahmen kommt jedoch die Frage auf: Wurde vorher etwa nicht kundenfreundlich gearbeitet? Diese Frage muss verneint werden. Und dennoch erhielt mit der Qualitätsdebatte in der sozialen Arbeit auch die Kundendiskussion eine neue Dimension. In Anlehnung an die in Leitbildern propagierte Klienten- bzw. Kundenzentriertheit wurde erwartet, dass mit Qualitätsmanagement auch im sozialen Bereich Strukturen und Prozesse kundenfreundlicher gestaltet werden und die Arbeit verstärkt dem Klienten zugute kommt. Aus den Erfordernissen, effektiver und effizienter zu arbeiten, wurde das Bestreben abgeleitet, die gesamte Arbeit am Klienten „neu“ auszurichten. Der Begriff „Kundenzufriedenheit“ erlebt seitdem Hochkonjunktur. Doch wie sieht es mit der Umsetzung derart wohlklingender Sätze aus? Werden entsprechende Äußerungen tatsächlich gelebt? Ist der Kunde der sozialen Arbeit wirklich König bzw. steht der Klient tatsächlich im Mittelpunkt des Denkens und Handelns? Es ist Anliegen dieser Arbeit, diesen Fragen nachzugehen. Insbesondere ist zu klären, welchen Stellenwert der „königliche“ Kunde einnimmt und welche Bedeutung das Schlagwort „Kundenzufriedenheit“ in der sozialen Arbeit hat. Ebenfalls ist die Frage zu beantworten, welchen Stellenwert der „zufriedene“ Kunde in der sozialen Arbeit überhaupt hat. Es soll so überprüft werden, inwiefern Aussagen über die vermeintlich „neue“ kundenzentrierte Arbeit Gültigkeit besitzen und welche Position der Klient in der sozialen Arbeit tatsächlich einnimmt. Die Arbeit enthält wissenschaftliche Anteile als auch praktische Forschungsanteile.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Dienstleistungen und Kunden
- 2.1 Der Begriff der Dienstleistung
- 2.2 Der Begriff des Kunden
- 3. Qualitätsmanagement (Grundlagen, Definitionen)
- 3.1 Qualität und Qualitätsmanagement
- 3.2 Leitbilder und Werthaltungen
- 3.3 Dokumentation von Schlüsselprozessen
- 3.4 Evaluation
- 3.4.1 Externe Evaluation
- 3.4.2 Interne Evaluation
- 3.4.3 Externe und interne Evaluation im Vergleich
- 3.5 Zusammenfassung
- 4. Kundenzufriedenheit in der sozialen Arbeit
- 4.1 Kundengruppen und ihre Interessen
- 4.2 Wie „mächtig“ sind die einzelnen Kundengruppen?
- 4.3 Kundenzufriedenheit - alles nur ein Mythos?
- 4.4 Kundenzufriedenheit in ausgewählten Feldern der sozialen Arbeit
- 4.4.1 Kundenzufriedenheit im Job-Center
- 4.4.2 Kundenzufriedenheit in einem Jugendwohnheim
- 4.4.3 Kundenzufriedenheit im Betreuten Wohnen für Senioren
- 4.4.4 Zusammenfassung
- 4.5 Kundenzufriedenheit durch Aushandlung
- 4.5.1 Die Bedeutung der internen Positionierung
- 4.5.2 Die Ermittlung der Klientenperspektive
- 4.5.3 Die Konkretisierung von Qualitätsvorstellungen
- 4.6 Zusammenfassung
- 5. QM-Konzepte
- 5.1 DIN EN ISO 9000ff
- 5.2 Total Quality Management (TQM)
- 5.3 European Foundation for Quality Management (EFQM)
- 5.4 Service Assessment (ServAs)
- 5.5 Zusammenfassung
- 6. Kundenbefragungen
- 6.1 Befragungsarten und Befragungstechniken
- 6.2 Konzipierung einer Umfrage
- 6.3 Durchführung einer Umfrage
- 6.4 Auswertung einer Umfrage
- 6.5 Umgang mit Umfrageergebnissen
- 6.6 Wiederholung einer Umfrage
- 6.7 Zusammenfassung
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Kundenzufriedenheit im Kontext des Qualitätsmanagements in der sozialen Arbeit. Ziel ist es, die Bedeutung von Kundenzufriedenheit in der sozialen Arbeit zu beleuchten und die Herausforderungen bei der Umsetzung kundenorientierter Prozesse zu analysieren.
- Bedeutung von Kundenzufriedenheit in der sozialen Arbeit
- Herausforderungen bei der Umsetzung kundenorientierter Prozesse
- Verschiedene Ansätze des Qualitätsmanagements
- Methoden zur Erhebung der Kundenzufriedenheit
- Praxisbeispiele aus verschiedenen Feldern der sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und beleuchtet die Bedeutung von Kundenzufriedenheit im Kontext der Entwicklung des Qualitätsmanagements in der sozialen Arbeit. Kapitel zwei beschäftigt sich mit dem Begriff der Dienstleistung und des Kunden in der sozialen Arbeit. Kapitel drei erläutert die Grundlagen des Qualitätsmanagements und geht auf verschiedene Ansätze und Methoden ein. Kapitel vier untersucht die Bedeutung von Kundenzufriedenheit in der sozialen Arbeit und beleuchtet verschiedene Aspekte der Kundenzufriedenheit in unterschiedlichen Feldern der sozialen Arbeit. Kapitel fünf stellt verschiedene QM-Konzepte vor und analysiert deren Anwendbarkeit in der sozialen Arbeit. Kapitel sechs behandelt Kundenbefragungen als Instrument zur Erhebung der Kundenzufriedenheit. Das abschließende Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Kundenzufriedenheit, Qualitätsmanagement, soziale Arbeit, Dienstleistungen, Kunden, Evaluation, QM-Konzepte, Kundenbefragungen, Klientenperspektive, Praxisbeispiele, Effektivität, Effizienz.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Kundenzufriedenheit in der Sozialen Arbeit?
Es beschreibt das Bestreben, soziale Dienstleistungen konsequent an den Bedürfnissen der Klienten auszurichten, oft im Rahmen des Qualitätsmanagements.
Ist der Klient in der Sozialen Arbeit wirklich "König"?
Die Arbeit hinterfragt kritisch, ob Leitbilder zur Kundenzentriertheit in der Praxis tatsächlich gelebt werden oder ob "Kundenzufriedenheit" teilweise ein Mythos bleibt.
Welche QM-Konzepte finden in sozialen Einrichtungen Anwendung?
Genannt werden unter anderem DIN EN ISO 9000ff, Total Quality Management (TQM), EFQM und Service Assessment (ServAs).
Wie kann Kundenzufriedenheit gemessen werden?
Durch systematische Kundenbefragungen, interne und externe Evaluationen sowie die Dokumentation von Schlüsselprozessen.
Welche Felder der Sozialen Arbeit werden als Beispiele genannt?
Die Untersuchung betrachtet Job-Center, Jugendwohnheime und das betreute Wohnen für Senioren.
- Quote paper
- Henning Becker (Author), 2007, Kundenzufriedenheit im Qualitätsmanagement sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170554