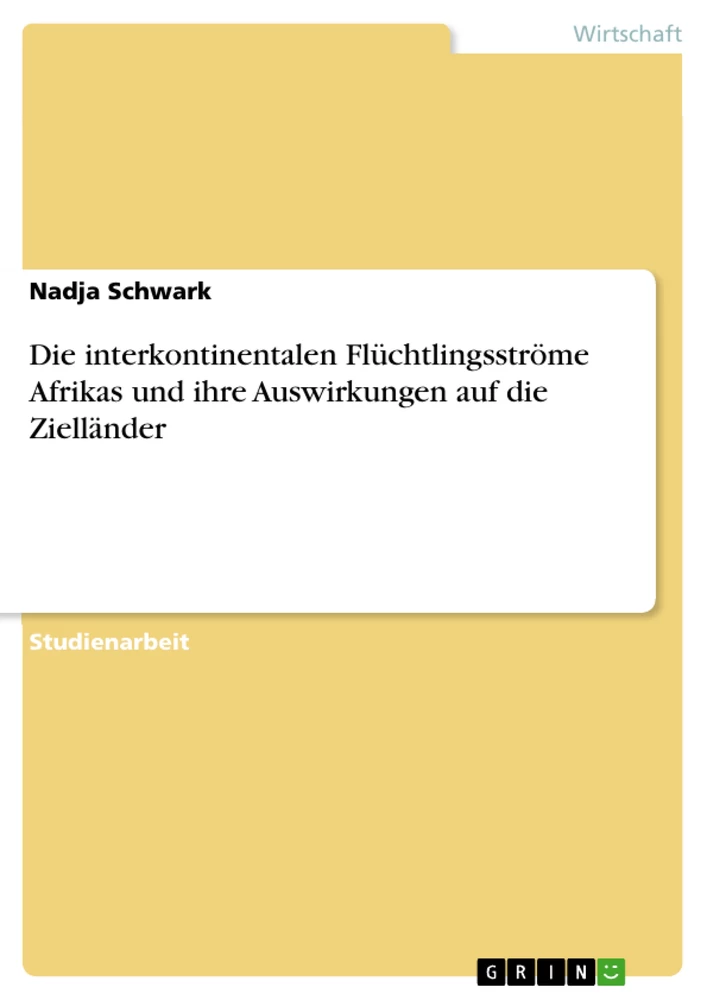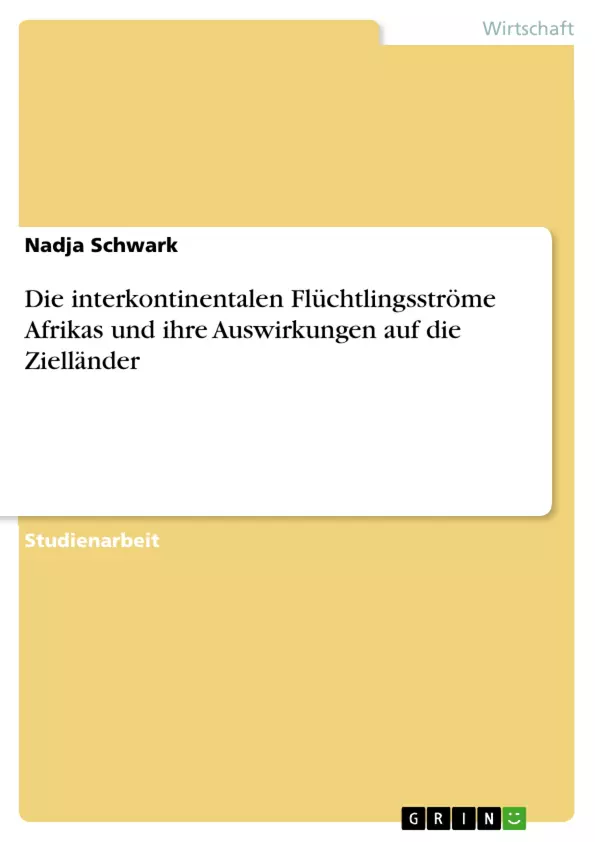Flucht und Wanderung sind schon immer Teil der Geschichte, und die unterschiedlichsten Gründe veranlassen Menschen ihre Heimat zu verlassen. Afrika ist laut Meldungen von Hilfsorganisationen besonders betroffen. In manchen Ländern herrscht eine chronisch katastrophale humanitäre Situation. Ethnische Konflikte, Kriege, politische Repression und Verelendung häufen sich in Afrika. Multipliziert wird die Problematik durch das „Sahel Syndrom“, was einhergeht mit Desertifikation, Wassermangel und Degeneration der Böden. Afrika – ein Erdteil mit vielen Problemen und wird deswegen auch „Kontinent der Flüchtlinge“ tituliert.
Die vorliegende Arbeit wird beginnend die Begriffe Migration und Flucht abgrenzen und humanitäre Organisationen vorstellen, welche im Verlauf der Arbeit als wesentliche Informationsquelle dienen. Es wird der Inhalt der Genfer Flüchtlingskonvention zitiert und die genannte Definition der Flüchtlinge wird in dieser Arbeit als Grundlage für diese Begrifflichkeit dienen.
Es wird versucht, die Fluchtbewegungen zu begründen und die Probleme in dem Zusammenhang zu betrachten, um die Auswirkungen auf die Zielländer darzustellen. Beispielhaft wird die Situation Somalias beschrieben, um letztlich eine Aussicht zu wagen, was die Flüchtlingssituation in Afrika verbessern könnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung in die Arbeit
- 2. Einführende Begriffs- und Organisationsbeschreibung
- 2.1. Abgrenzung Flüchtlinge von Migranten
- 2.2. Humanitäre Organisationen
- 3. Flüchtlingsbewegungen, Gründe und Auswirkungen
- 3.1. Allgemeine Fluchtgründe mit Implizierung auf Afrika
- 3.1.1. Allgemeine, ökonomische, kriegerische und geschlechtsspezifische Gründe
- 3.1.2. Ökologische Gründe
- 3.1.3. Urbanisierung und der Zusammenhang mit Flucht
- 3.1.4. Push und Pullfaktoren
- 3.1.5. Globalisierung und der Zusammenhang mit Flucht
- 3.2. Afrika und seine speziellen Fluchtgründe
- 3.2.1. Kolonialzeit und ihre Auswirkungen auf die Staatenbildung
- 3.2.2. Ethnien und ihre Konflikte
- 3.3. Beispiele für Fluchtbewegungen, „Weg-Schwierigkeiten“ und Entstehung der Flüchtlingslager
- 3.4. Somalia und die Zielländer seiner Flüchtlinge
- 3.5. Situation der Auffanglager und die Auswirkungen auf die Menschen und Staaten
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die interkontinentalen Flüchtlingsströme aus Afrika und deren Auswirkungen auf die Zielländer. Ziel ist es, die komplexen Fluchtgründe zu beleuchten und die Herausforderungen für die betroffenen Staaten zu analysieren.
- Abgrenzung von Migration und Flucht
- Analyse der Fluchtursachen in Afrika (ökonomische, politische, ökologische Faktoren)
- Auswirkungen der Flüchtlingsströme auf die Zielländer
- Die Rolle humanitärer Organisationen
- Fallbeispiel Somalia
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung in die Arbeit: Die Einleitung führt in das Thema ein und benennt Flucht und Migration als historische Phänomene. Sie hebt die besondere Problematik Afrikas hervor, die durch ethnische Konflikte, Kriege, politische Repression und Verelendung gekennzeichnet ist. Das „Sahel Syndrom“ mit Desertifikation, Wassermangel und Bodendegeneration verstärkt die Herausforderungen. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau: Abgrenzung von Begriffen, Vorstellung humanitärer Organisationen, Analyse von Fluchtgründen und -auswirkungen, sowie ein Fallbeispiel Somalia, um letztlich Lösungsansätze zu erörtern.
2. Einführende Begriffs- und Organisationsbeschreibung: Dieses Kapitel grenzt die Begriffe „Flüchtling“ und „Migrant“ voneinander ab und stellt die Rolle humanitärer Organisationen vor, die als wichtige Informationsquellen für die Arbeit dienen. Die Genfer Flüchtlingskonvention wird zitiert und ihre Definition von Flüchtlingen bildet die Grundlage der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Klärung zentraler Begriffe, um eine fundierte Basis für die weitere Analyse zu schaffen.
3. Flüchtlingsbewegungen, Gründe und Auswirkungen: Dieses Kapitel analysiert die Fluchtbewegungen aus Afrika, untersucht die komplexen Fluchtgründe (ökonomische, kriegerische, ökologische und geschlechtsspezifische Faktoren), und beleuchtet den Einfluss von Urbanisierung und Globalisierung. Es werden Push- und Pull-Faktoren erörtert, die die Fluchtbewegungen antreiben. Weiterhin werden spezifische Fluchtgründe Afrikas behandelt, u.a. die Folgen der Kolonialzeit und ethnische Konflikte. Das Kapitel umfasst Fallbeispiele von Fluchtbewegungen, die Herausforderungen auf der Flucht und die Entstehung von Flüchtlingslagern. Der Fokus liegt auf Somalia und den Auswirkungen auf die Zielländer und die Menschen in den Auffanglagern.
Schlüsselwörter
Flüchtlingsströme, Afrika, Migration, Fluchtursachen, Zielländer, humanitäre Organisationen, Konflikte, Ökologie, Globalisierung, Somalia, Flüchtlingslager, Push- und Pullfaktoren, Kolonialismus, Ethnien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse Afrikanischer Flüchtlingsströme
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert interkontinentale Flüchtlingsströme aus Afrika und deren Auswirkungen auf die Zielländer. Sie untersucht die komplexen Fluchtgründe und die Herausforderungen für die betroffenen Staaten. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Fallbeispiel Somalia.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Abgrenzung von Migration und Flucht, Analyse der Fluchtursachen in Afrika (ökonomische, politische, ökologische Faktoren), Auswirkungen der Flüchtlingsströme auf die Zielländer, die Rolle humanitärer Organisationen und ein detailliertes Fallbeispiel Somalia.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Abgrenzung von Begriffen und zur Vorstellung humanitärer Organisationen, ein zentrales Kapitel zur Analyse der Flüchtlingsbewegungen, ihrer Ursachen und Auswirkungen, sowie ein Fazit. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Erläuterung der Fluchtgründe in Afrika, inklusive der Folgen der Kolonialzeit und ethnischer Konflikte. Somalia dient als Fallbeispiel, um die Situation in den Auffanglagern und deren Auswirkungen auf die Menschen und Staaten zu veranschaulichen.
Welche Fluchtgründe werden untersucht?
Die Arbeit untersucht allgemeine Fluchtgründe wie ökonomische Not, Kriege und geschlechtsspezifische Gewalt, aber auch ökologische Faktoren wie Desertifikation und Wassermangel. Im afrikanischen Kontext werden zusätzlich die Folgen der Kolonialzeit, ethnische Konflikte, Urbanisierung und die Auswirkungen der Globalisierung berücksichtigt. Die Analyse umfasst sowohl Push- als auch Pull-Faktoren.
Welche Rolle spielen humanitäre Organisationen?
Humanitäre Organisationen werden als wichtige Informationsquellen für die Arbeit genannt und ihre Rolle bei der Unterstützung von Flüchtlingen wird thematisiert. Die Genfer Flüchtlingskonvention und ihre Definition von Flüchtlingen bilden die Grundlage der Arbeit.
Was ist das Besondere am Fallbeispiel Somalia?
Das Fallbeispiel Somalia illustriert die komplexen Fluchtgründe, die Herausforderungen auf der Flucht, die Entstehung von Flüchtlingslagern und die Auswirkungen der Flüchtlingsströme auf die Zielländer und die Menschen in den Auffanglagern. Es zeigt die konkreten Folgen der verschiedenen Fluchtursachen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Flüchtlingsströme, Afrika, Migration, Fluchtursachen, Zielländer, humanitäre Organisationen, Konflikte, Ökologie, Globalisierung, Somalia, Flüchtlingslager, Push- und Pull-Faktoren, Kolonialismus, Ethnien.
Wie werden die Begriffe „Flüchtling“ und „Migrant“ abgegrenzt?
Das Kapitel 2 widmet sich der klaren Abgrenzung der Begriffe „Flüchtling“ und „Migrant“, basierend auf der Genfer Flüchtlingskonvention. Dies bildet die Grundlage für die weitere Analyse der Flüchtlingsströme.
- Quote paper
- Nadja Schwark (Author), 2011, Die interkontinentalen Flüchtlingsströme Afrikas und ihre Auswirkungen auf die Zielländer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170614