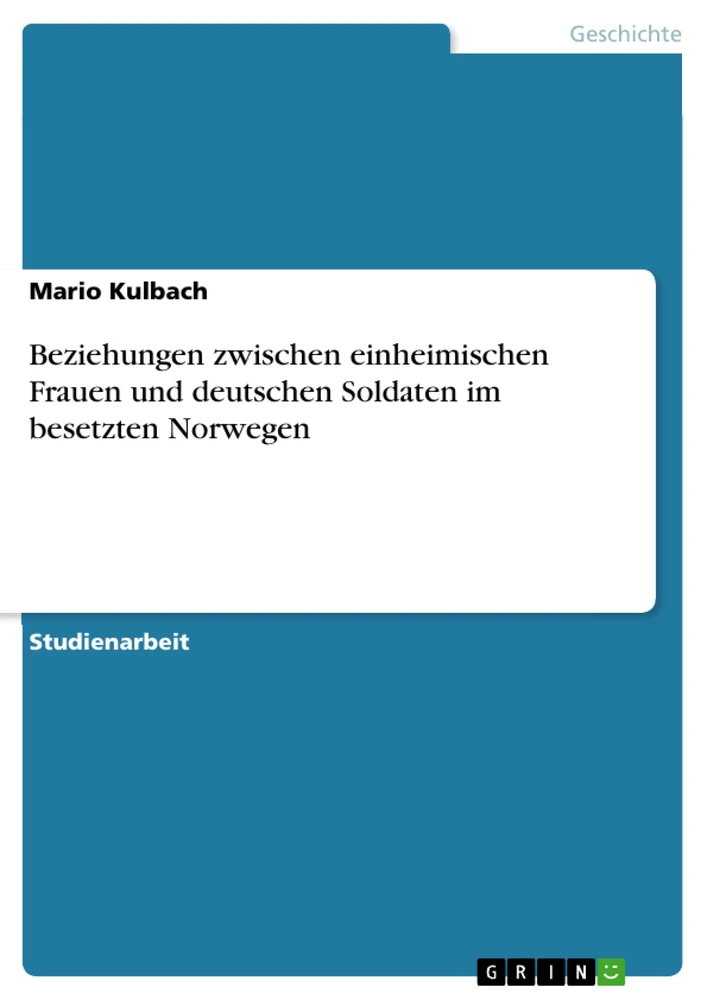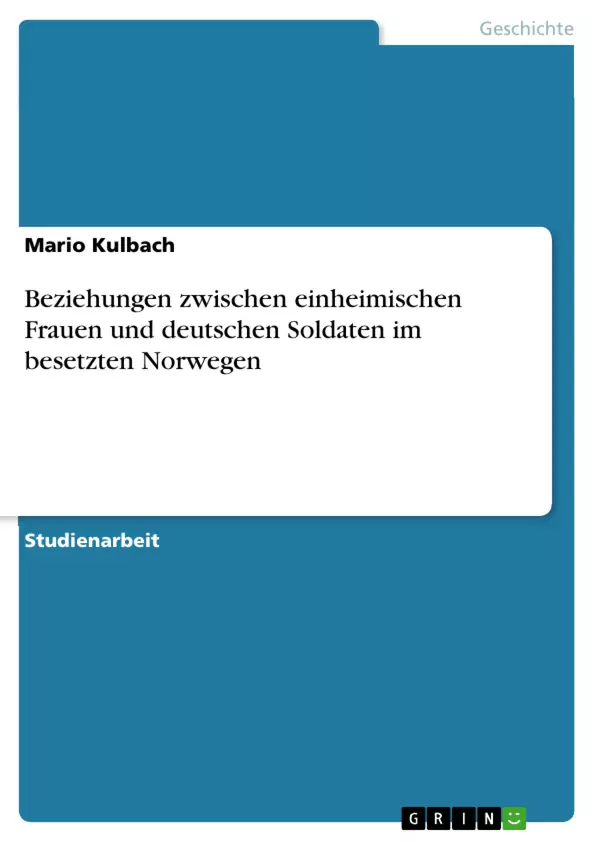„Die Deutschen in ihren Uniformen, mein Gott, waren das schöne Männer, wir haben unseren Augen nicht getraut.“ So äußerte sich die Norwegerin Lucie im Gespräch mit Ebba D. Drolshagen über den ersten flüchtigen Kontakt mit denjenigen Männern, die zwischen 1940 und 1945 als Besatzer in Norwegen stationiert waren. Die Bewunderung für die fremden Soldaten, die in dieser Aussage steckt, kann kaum geleugnet werden. Es lässt sich durchaus ein Interesse an den unbekannten Fremden herauslesen. Dieses Interesse (u.a.) an den Neuankömmlingen führte dazu, dass schätzungsweise 40 - 50.000 Norwegerinnen engeren Kontakt zu Deutschen hatten, und aus diesen Beziehungen mind. 9.000 Kinder hervorgingen .
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob Bewunderung allein als Motiv gelten kann, welches erklärt, warum man sich von Seiten der einheimischen Frauen auf die fremden Männer einließ. Welche anderen Gründe spielten für die Frauen eine Rolle, sich mit dem „Feind“ abzugeben. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, welche Beweggründe es für deutsche Soldaten gab, sich den norwegischen Frauen anzunähern. Die Beantwortung dieser Frage, nämlich der Frage nach den Motiven der Frauen einerseits und denen der Männer andererseits für eine Annäherung an den jeweils anderen, soll Gegenstand dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kontakte zur Zivilbevölkerung: Norwegen aus Sicht nationalsozialistischer Ideologie
- Die Reaktionen der Anderen: Beziehungen zwischen norwegischen Frauen und deutschen Soldaten aus norwegischer Sicht
- Kontaktfelder deutscher Soldaten und norwegischer Einheimischer
- Motive für Beziehungen zwischen norwegischen Frauen und deutschen Soldaten
- Aus Sicht deutscher Soldaten in Norwegen
- Aus Sicht norwegischer Frauen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehungen zwischen norwegischen Frauen und deutschen Soldaten während der Besatzungszeit Norwegens (1940-1945). Die Zielsetzung besteht darin, die Motive beider Seiten für diese Beziehungen zu analysieren und zu verstehen, welche Faktoren – von nationalsozialistischer Ideologie bis hin zu persönlichen Bedürfnissen – eine Rolle spielten.
- Die Rolle der nationalsozialistischen Ideologie im Kontext der Beziehungen
- Die gesellschaftlichen Reaktionen auf Beziehungen zwischen Norwegerinnen und deutschen Soldaten
- Die Kontaktmöglichkeiten zwischen deutschen Soldaten und der norwegischen Zivilbevölkerung
- Motive der deutschen Soldaten für Beziehungen mit norwegischen Frauen
- Motive der norwegischen Frauen für Beziehungen mit deutschen Soldaten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie von der Bewunderung einiger norwegischer Frauen für die deutschen Soldaten berichtet und die Forschungsfrage nach den Motiven für die Beziehungen zwischen norwegischen Frauen und deutschen Soldaten formuliert. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und kündigt die Analyse der NS-Ideologie, der gesellschaftlichen Reaktionen und der Motive beider Seiten an. Die Einleitung betont, dass die Analyse keine Verallgemeinerung für alle Beteiligten darstellt, sondern sich auf diejenigen konzentriert, die bewusst Kontakt suchten.
Kontakte zur Zivilbevölkerung: Norwegen aus Sicht nationalsozialistischer Ideologie: Dieses Kapitel untersucht die Perspektive der nationalsozialistischen Ideologie auf die Beziehungen zwischen deutschen Soldaten und norwegischen Frauen. Es analysiert, inwieweit die NS-Ideologie, etwa durch Institutionen wie den Lebensborn, diese Beziehungen förderte, verhinderte oder ignorierte. Die Betrachtung der NS-Haltung gegenüber ethnischen Minderheiten wie den Samen wird ebenfalls einbezogen, um ein umfassenderes Bild der ideologischen Rahmenbedingungen zu zeichnen.
Die Reaktionen der Anderen: Beziehungen zwischen norwegischen Frauen und deutschen Soldaten aus norwegischer Sicht: Dieses Kapitel beleuchtet die Reaktionen der norwegischen Bevölkerung auf Beziehungen zwischen norwegischen Frauen und deutschen Soldaten. Es beschreibt die gesellschaftliche Ausgrenzung und Stigmatisierung der Frauen, die als „Tyskertøs“ oder „Tyskerjenter“ bezeichnet und als Kollaborateure betrachtet wurden. Die Analyse konzentriert sich auf die psychischen und physischen Folgen dieser Ausgrenzung, sowohl während als auch nach der Besatzungszeit.
Kontaktfelder deutscher Soldaten und norwegischer Einheimischer: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten und Situationen, in denen Kontakte zwischen deutschen Soldaten und der norwegischen Zivilbevölkerung zustande kamen. Es unterstreicht, dass diese Kontakte keine Seltenheit waren, sondern in vielfältiger Form stattfanden, was die Entstehung von Beziehungen zwischen norwegischen Frauen und deutschen Soldaten erklärt.
Motive für Beziehungen zwischen norwegischen Frauen und deutschen Soldaten: Dieses Kapitel, der Kern der Arbeit, analysiert die Motive sowohl der norwegischen Frauen als auch der deutschen Soldaten für die Beziehungen. Es verwendet zwei Modelle, um die verschiedenen Motive zu kategorisieren und zu benennen. Es werden Aspekte wie Neugier, Faszination, Opportunismus, Liebe, Langeweile, und Ideologie beleuchtet, jeweils aus der Sicht der Frauen und der Soldaten.
Schlüsselwörter
Norwegen, Besatzung, Zweiter Weltkrieg, Beziehungen, deutsche Soldaten, norwegische Frauen, nationalsozialistische Ideologie, Kollaboration, gesellschaftliche Ausgrenzung, Motive, Tyskertøs, Tyskerjenter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Beziehungen zwischen norwegischen Frauen und deutschen Soldaten während der Besatzungszeit (1940-1945)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Beziehungen zwischen norwegischen Frauen und deutschen Soldaten während der deutschen Besatzung Norwegens (1940-1945). Sie analysiert die Motive beider Seiten für diese Beziehungen und die einflussnehmenden Faktoren, von der nationalsozialistischen Ideologie bis hin zu persönlichen Bedürfnissen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle der nationalsozialistischen Ideologie, die gesellschaftlichen Reaktionen auf diese Beziehungen, die Möglichkeiten des Kontakts zwischen deutschen Soldaten und der norwegischen Zivilbevölkerung, sowie die Motive der deutschen Soldaten und der norwegischen Frauen für diese Beziehungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den Kontakten zur Zivilbevölkerung aus nationalsozialistischer Sicht, den Reaktionen der norwegischen Bevölkerung, den Kontaktfeldern zwischen Soldaten und Zivilisten, den Motiven beider Seiten und einem Fazit. Die Einleitung beschreibt die Forschungsfrage und den Aufbau. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des jeweiligen Themas.
Welche Perspektive wird eingenommen?
Die Arbeit analysiert die Beziehungen aus verschiedenen Perspektiven: der nationalsozialistischen Ideologie, der norwegischen Bevölkerung und den individuellen Motiven der beteiligten Frauen und Soldaten. Es wird betont, dass die Analyse sich auf diejenigen konzentriert, die bewusst Kontakt suchten und keine Verallgemeinerung für alle Beteiligten darstellt.
Welche Rolle spielte die nationalsozialistische Ideologie?
Die Arbeit untersucht, wie die nationalsozialistische Ideologie, einschließlich Institutionen wie der Lebensborn, diese Beziehungen beeinflusste – ob sie gefördert, verhindert oder ignoriert wurden. Die Haltung gegenüber ethnischen Minderheiten, wie den Samen, wird ebenfalls berücksichtigt.
Wie reagierte die norwegische Bevölkerung?
Die Arbeit beschreibt die gesellschaftliche Ausgrenzung und Stigmatisierung der Frauen, die Beziehungen zu deutschen Soldaten hatten. Sie analysiert die psychischen und physischen Folgen dieser Ausgrenzung als „Tyskertøs“ oder „Tyskerjenter“ und deren Behandlung als Kollaborateure.
Welche Möglichkeiten des Kontakts gab es?
Die Arbeit beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten und Situationen, in denen Kontakte zwischen deutschen Soldaten und der norwegischen Zivilbevölkerung stattfanden, um zu erklären, wie Beziehungen entstehen konnten.
Welche Motive hatten die Frauen und die Soldaten?
Der Kern der Arbeit analysiert die Motive der norwegischen Frauen und der deutschen Soldaten mithilfe von Modellen zur Kategorisierung. Aspekte wie Neugier, Faszination, Opportunismus, Liebe, Langeweile und Ideologie werden aus beiden Perspektiven beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Norwegen, Besatzung, Zweiter Weltkrieg, Beziehungen, deutsche Soldaten, norwegische Frauen, nationalsozialistische Ideologie, Kollaboration, gesellschaftliche Ausgrenzung, Motive, Tyskertøs, Tyskerjenter.
- Citar trabajo
- Mario Kulbach (Autor), 2011, Beziehungen zwischen einheimischen Frauen und deutschen Soldaten im besetzten Norwegen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170619