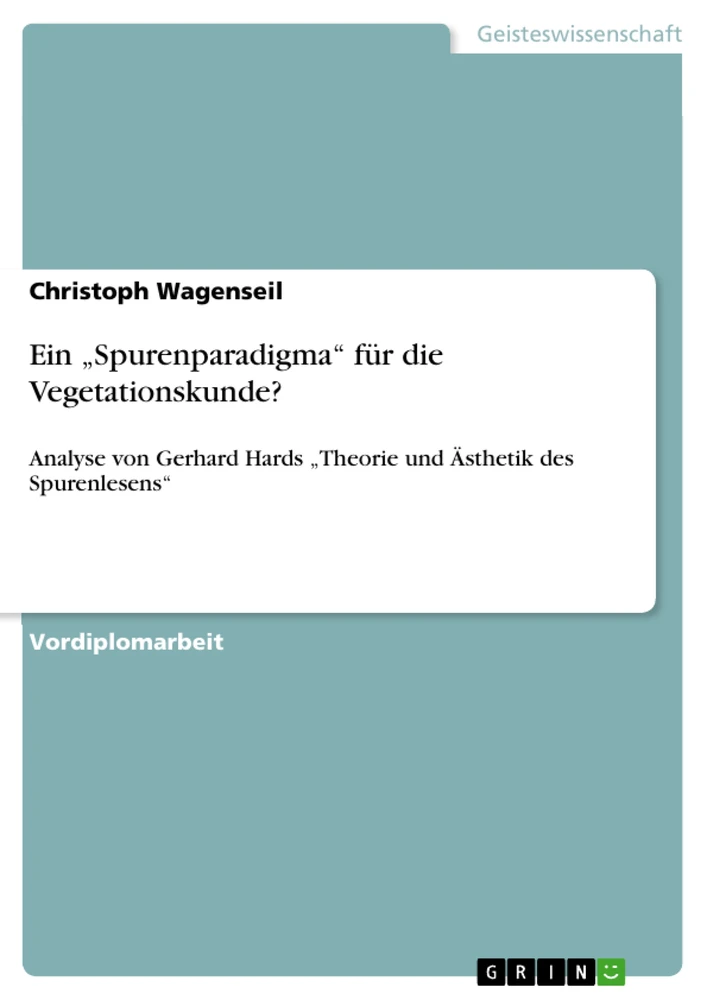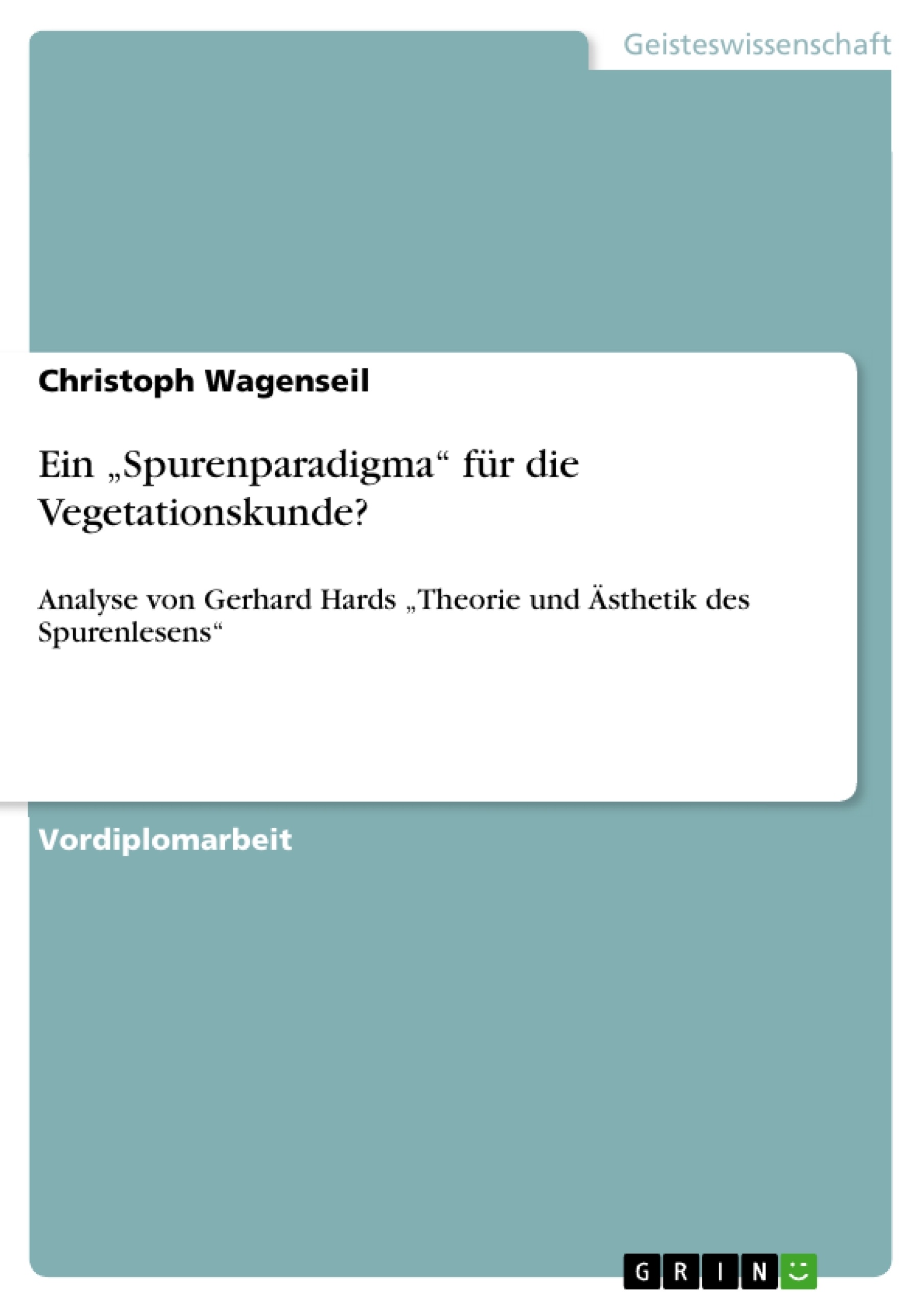Die von Gerhard Hard entwickelte „Theorie der Vegetationskunde“ entwickelt eine „Logik der zweifachen Interpretation“ analog zum Zeichenkonzept von Signifikanten und Signifikat im epistemologischen Modell eines abbildtheoretischen Naturalismus. Menschliches Tun wird dabei lediglich – mit nur scheinbarer Ausnahme des vegetationskundlichen Spurenlesers selbst – als Verhalten interpretiert. Die Position des Spurenlesers entspricht in Analogie derjenigen des hermetischen Philosophen, nur die Wahl der „richtigen“ Meßgeräte scheint – zirkulär begründet – die „richtige“ Naturerkenntnis zu ermöglichen. Hards Konzept werden bezüglich der handlungstheoretischen Defizite Benno Werlens Überlegungen im Zusammenhang mit Raumbegriffen in der Sozialgeographie (Kapitel 1.1.2) und zur Problematisierung der Rede von „historischen Zeichen“ der historische Relativismus von Arthur C. Danto (Kapitel 2) gegenübergestellt. Schließlich wird mit Kapitel 3 ein häufiges Missverständnis bzgl. "Postmoderne" und "Ästhetik" behandelt. Die Erkenntnistheorie des Vegetationskundlers kann ihrem Anspruch nicht gerecht werden, mit der "Spur" ein neues Paradigma zu begründen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1. Spuren und Spurenleser
- 1.1 Theorie der Vegetationskunde als spezielle Theorie des Spurenparadigmas
- 1.1.1 „Handlungen“ als rekonstruierbare „Spuren“ in der „Natur“
- 1.1.2 Spurenlesen als „Handlung“ - ein Ausblick auf Alternativen für Vegetationskundler
- 1.2 Der Spurenleser
- 1.1 Theorie der Vegetationskunde als spezielle Theorie des Spurenparadigmas
- 2. „Spuren“ als „Zeichen“ und „Symbole“ der Vergangenheit
- 3. „Postmoderne“ und „Ästhetik“
- die ewige Wiederkehr eines Mißverständnisses
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Gerhard Hards Konzept eines „Spurenparadigmas“ für die Vegetationskunde, wie es in seinem Werk „Spuren und Spurenleser: zur Theorie und Ästhetik des Spurenlesens in der Vegetation und anderswo“ (2006) vorgestellt wird. Die Analyse zielt darauf ab, die Grundannahmen des Paradigmas kritisch zu hinterfragen und zu beleuchten, inwieweit es problematisch bleibt, insbesondere aus der Perspektive derjenigen wissenschaftlichen Disziplinen, die in ihrer Methodik indirekt bemängelt werden.
- Die Unterscheidung von „Spuren“ und „Spurenleser“ im Kontext von „realer“ und „symbolischer“ Natur
- Die Anwendung der Zeichentheorie von Saussure auf die „Theorie der Spur, des Spurenlesens und des Spurenlesers“
- Die „Ästhetik“ des Spurenlesens und ihre Anwendung in unterschiedlichen Disziplinen
- Die Relevanz des „historischen Zeichens“ in der „diachronen“ Perspektive der Vegetationskunde
- Die Kritik an Hards Rezeption von Derrida und „der Postmoderne“
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Einführung beleuchtet die historische Entwicklung des „Friedensstifter“-Ansatzes, der von Johann August Unzer im 18. Jahrhundert in seiner Schrift „Gedancken vom Schlafe und denen Träumen“ vertreten wurde. Sie stellt einen Zusammenhang zwischen Unzers Versuch, die „Vernunft“ und „Erfahrung“ miteinander in Einklang zu bringen, und Hards „Spurenparadigma“ her.
1. Spuren und Spurenleser
Dieses Kapitel stellt die Grundannahmen des „Spurenparadigmas“ von Gerhard Hard vor. Es wird die Unterscheidung von „Spuren“ und „Spurenleser“ in der „realen“ und „symbolischen“ Natur beleuchtet und die Anwendung der Zeichentheorie von Saussure auf die „Theorie der Spur, des Spurenlesens und des Spurenlesers“ diskutiert.
2. „Spuren“ als „Zeichen“ und „Symbole“ der Vergangenheit
Dieses Kapitel behandelt die „diachrone“ Perspektive des „Spurenparadigmas“ und beleuchtet die Bedeutung des „historischen Zeichens“ in der Vegetationskunde. Die Unterscheidung zwischen „natürlich“ und „künstlich“ erzeugten Spuren wird dabei diskutiert.
Schlüsselwörter
Spurenparadigma, Vegetationskunde, Spurenleser, Theorie der Spur, Zeichentheorie, Saussure, Derrida, Postmoderne, Ästhetik, historisches Zeichen, natürliche und künstliche Spuren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Spurenparadigma" in der Vegetationskunde?
Es ist eine von Gerhard Hard entwickelte Theorie, die menschliches Handeln in der Natur als rekonstruierbare "Spuren" interpretiert.
Welche Rolle spielt die Zeichentheorie von Saussure in dieser Arbeit?
Hards Konzept nutzt das Zeichenkonzept von Signifikant und Signifikat, um die Vegetation als lesbares System von Zeichen zu verstehen.
Was wird an Gerhard Hards Konzept kritisiert?
Kritisiert werden unter anderem handlungstheoretische Defizite und eine problematische Rezeption von Postmoderne und Ästhetik.
Was unterscheidet "natürliche" von "künstlichen" Spuren?
Die Arbeit untersucht die diachrone Perspektive und wie historische menschliche Eingriffe als künstliche Zeichen in der Vegetation verbleiben.
Wie ordnet sich die Arbeit in den wissenschaftlichen Diskurs ein?
Sie stellt Hards Thesen den Überlegungen von Benno Werlen zur Sozialgeographie und dem historischen Relativismus von Arthur C. Danto gegenüber.
- Quote paper
- Christoph Wagenseil (Author), 2006, Ein „Spurenparadigma“ für die Vegetationskunde?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170627