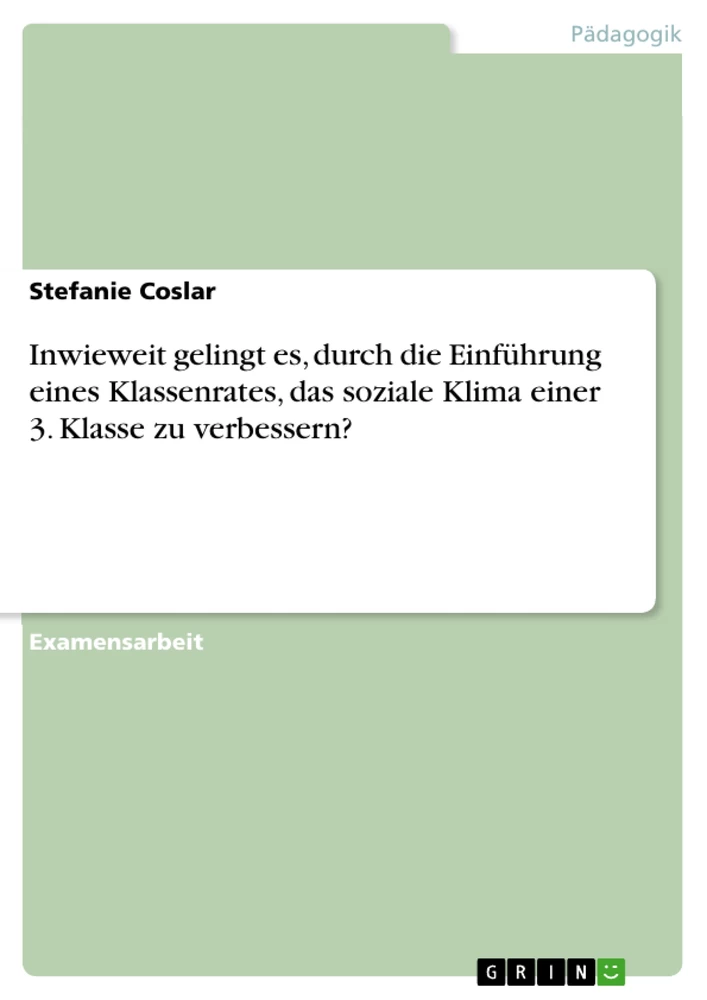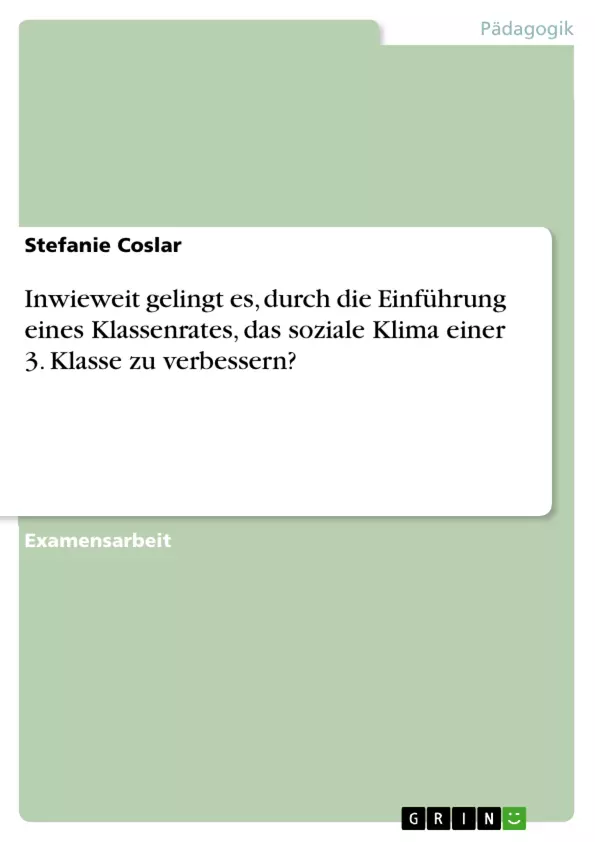Einleitung
„Alicia(1) hat gesagt, dass Indira nur ihre Freundin allein ist, das darf sie doch nicht, oder?“(2), tönt es mir schon im Treppenhaus auf dem Weg in die Klasse 3a entgegen – die Pause ist zu Ende, der Unterricht müsste beginnen, wenn da nicht immer die Streitereien wären, die aus der Pause mit in den Unterricht getragen werden. Als Lehrerin stehe ich nun vor der Entscheidung, diese Konflikte entweder direkt zu klären, wodurch wertvolle Unterrichtszeit
geopfert werden muss, oder aber den Unterricht ohne Klärung dieser
Konflikte zu beginnen. Letzteres führt dazu, dass kein ungestörter
Unterrichtseinstieg möglich ist.
Die Klasse 3a habe ich schon ganz zu Beginn meines Referendariats kennen gelernt, zurzeit unterrichte ich dort angeleitet das Fach Deutsch, im letzten Halbjahr gab ich dort aber auch bedarfsdeckend Deutschunterricht. Sowohl mir als auch der Klassenlehrerin fiel zu Beginn des Schuljahres auf, dass die Konflikte sich häuften. Ich stellte mir die Frage, wie die Situation wohl entschärft werden könnte und wo die Ursachen für das Problem lagen. Schnell
wurde klar, dass das soziale Klima der Klasse gestört sein müsse. Im Hinblick auf die vielen Streitereien hatte ich zunächst die Idee, eine Streitschlichter-AG zu gründen und einige Kinder zu Streitschlichtern(3) auszubilden. Ich verwarf die Idee allerdings wieder, weil es sich hierbei nicht um eine gezielte Maßnahme
für die Klassengemeinschaft handelte und ich selbst bisher keine Ausbildung zum Streitschlichter genossen hatte. Im Hauptseminar lernten wir zum Thema Streitschlichtung und Mediation auch den Klassenrat kennen. Nach näherer Auseinandersetzung mit dem Thema entschied ich, dass der Klassenrat sich als Maßnahme zur Verbesserung des sozialen Klimas in der 3a gut eignen könnte. Die Idee, einen Klassenrat einzuführen, war also geboren.
Zusätzlich zu dem Wunsch in der Klasse, die mir über die Halbjahre hinweg nun doch ans Herz gewachsen ist, etwas zu verbessern, gefiel mir die Idee, anders als im normalen Unterricht mit den Kindern auf einer Ebene zusammenzuarbeiten. Hier eröffneten sich nicht nur eine Menge Lernmöglichkeiten für die Kinder, sondern auch für mich, vor allem im Hinblick auf die Weiterentwicklung meiner eigenen Lehrerpersönlichkeit.
[...]
_____
1 Aus Gründen des Datenschutzes wurden alle Namen geschlechtsspezifisch verändert.
2 Aussage von Sandra, einem Mädchen aus der Lerngruppe.
3 Aus Gründen der Lesbarkeit wird [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Das soziale Klima
- 2.1.1 Zum Begriff des sozialen Klimas
- 2.1.2 Das stabile soziale Klima als lernförderliches Klima
- 2.1.3 Indikatoren für ein stabiles soziales Klima und dessen empirische Messung
- 2.2 Der Klassenrat
- 2.2.1 Der Klassenrat nach Célestin Freinet
- 2.2.2 Klassenrat heute
- 2.2.3 Ziele und Möglichkeiten
- 2.2.4 Grenzen des Klassenrats
- 3. Die Einführung des Klassenrats in der Klasse 3a
- 3.1 Lernvorraussetzungen und Ausgangssituation
- 3.1.1 Das soziale Klima der Klasse 3a
- 3.1.2 Individuelle Lernvorraussetzungen
- 3.2. Didaktische Begründung
- 3.2.1 Der Klassenrat als Maßnahme in der 3a
- 3.2.2 Bezug zum Lehrplan, zum Schulgesetz und zu den Grundsätzen zur Bildungsförderung
- 3.2.3 Zielvorstellungen
- 3.3 Methodische Vorgehensweise
- 3.3.1 Rahmenbedingungen und Übersicht über das Vorhaben
- 3.3.2 Einführungsstunde
- 3.3.3 Erarbeitung der Regeln
- 3.3.4 Die erste Klassenratssitzung
- 3.3.5 Rolle der Lehrperson
- 3.3.6 Ämterabgabe
- 3.3.7 Zwischenreflexion
- 4. Dokumentation, Reflexion und Evaluation
- 4.1 Verlauf der Durchführung
- 4.2 Evaluation und Zielerreichung
- 4.3 Kritische Aspekte und Alternativen
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Einführung des Klassenrats als Maßnahme zur Verbesserung des sozialen Klimas in einer 3. Klasse. Ziel ist es, die Wirksamkeit des Klassenrats in der Praxis zu untersuchen und dessen Potenzial für die Förderung eines positiven Lernumfelds aufzuzeigen.
- Der Einfluss des sozialen Klimas auf das Lernen
- Die Bedeutung des Klassenrats als Instrument zur Gestaltung des sozialen Klimas
- Die praktische Umsetzung des Klassenrats in einer 3. Klasse
- Die Evaluation der Wirksamkeit des Klassenrats
- Die Reflexion der Erfahrungen und die Ableitung von Schlussfolgerungen für die zukünftige Arbeit mit dem Klassenrat
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem der häufigen Streitereien in der Klasse 3a dar und führt zur Idee, einen Klassenrat einzuführen. Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen des sozialen Klimas und des Klassenrats, wobei verschiedene Definitionen und Ansätze beleuchtet werden. Kapitel 3 beschreibt die konkrete Einführung des Klassenrats in der Klasse 3a, einschließlich der didaktischen Begründung, der methodischen Vorgehensweise und der Rahmenbedingungen. Kapitel 4 dokumentiert den Verlauf der Durchführung, reflektiert die Erfahrungen und evaluiert die Zielerreichung. Die Zusammenfassung und der Ausblick schließen die Arbeit ab und geben einen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse und zukünftige Perspektiven.
Schlüsselwörter
Soziales Klima, Klassenrat, Lernumfeld, Streitschlichtung, Mediation, Partizipation, Schülerbeteiligung, Schulentwicklung, Schulgesetz, Bildungsförderung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Klassenrat?
Der Klassenrat ist ein demokratisches Gremium in der Schule, in dem Schüler gemeinsam über Anliegen, Konflikte und Planungen der Klasse beraten und entscheiden.
Wie kann der Klassenrat das soziale Klima verbessern?
Durch die regelmäßige Klärung von Konflikten und die Mitbestimmung fühlen sich Schüler ernst genommen, was die Klassengemeinschaft stärkt und Unterrichtsstörungen reduziert.
Welche Rolle spielt die Lehrperson im Klassenrat?
Die Lehrkraft agiert idealerweise als Begleiter auf Augenhöhe und gibt nach und nach Ämter und Verantwortung an die Schüler ab, um deren Selbständigkeit zu fördern.
Wer war Célestin Freinet im Kontext des Klassenrats?
Freinet war ein Reformpädagoge, der den Klassenrat als zentrales Instrument der Schülerpartizipation und der demokratischen Erziehung entwickelte.
Welche Lernmöglichkeiten bietet der Klassenrat für Grundschüler?
Kinder lernen Gesprächsregeln einzuhalten, Argumente zu formulieren, Verantwortung für Ämter zu übernehmen und konstruktive Lösungen für Probleme zu finden.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Coslar (Autor:in), 2010, Inwieweit gelingt es, durch die Einführung eines Klassenrates, das soziale Klima einer 3. Klasse zu verbessern?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170686