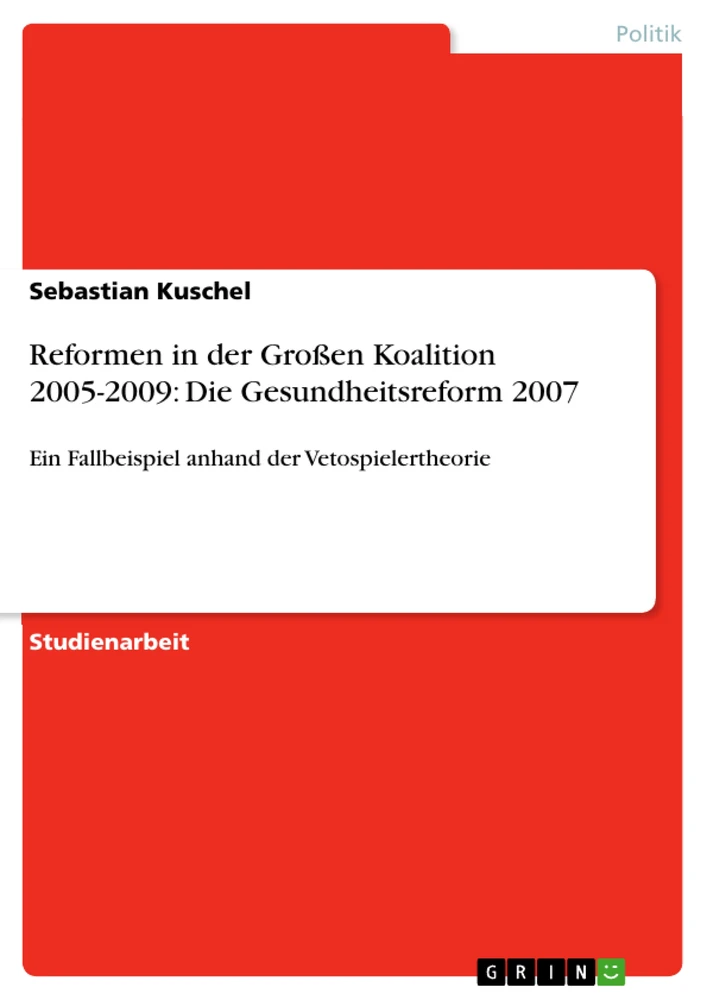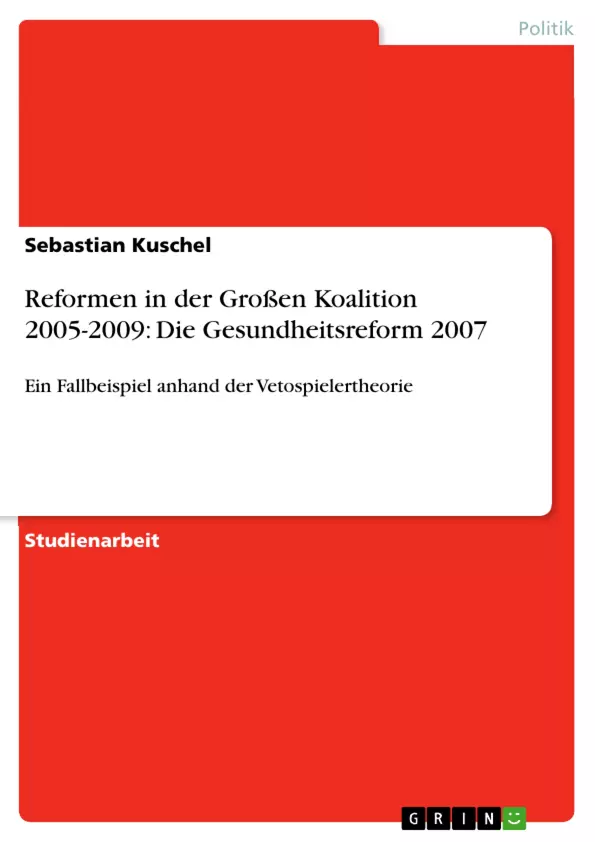„Ich glaube, das ist ein wirklicher Durchbruch, den wir hier schaffen[...]“
Mit diesen Worten verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 03.07.2006 in Berlin die Eckpunkte der Gesundheitsreform, auf die sich die Regierungsparteien aus SPD, CDU und CSU zuvor in zähen Verhandlungen geeinigt hatten. Auch die damals amtierende Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) zeigte sich euphorisch:
"Mit der Gesundheitsreform werden wir Strukturen im System aufbrechen.“
Die Kritik war allerdings auch nicht zu überhören. Bei den Krankenkassen und der Opposition im Bundestag, bei
Ärztevereinigungen bis hin zu Pharmaunternehmen wurde der Vorstoß eher negativ bewertet. Selbst aus den Reihen der Regierungsparteien wurde verstärkt Kritik geäußert. So beschwerte sich beispielsweise der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in einem Spiegel-Interview: „Ich war nie überzeugt.“ Desweiteren bezeichnete er den Gesundheits-
fonds, den zentralen Kern der Reform, als „überflüssig“.
Obwohl ein Gesetz selten schon bei seiner Entstehung dermaßen kritisiert wurde, beschloss der Bundestag das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG) am 2. Februar 2007, dem daraufhin auch der Bundesrat am 16. Februar 2007 zustimmte. Die meisten Änderungen des GKV-WSG traten am 01.04.2007 in Kraft, der Gesundheitsfonds wurde 2009 eingeführt.
Natürlich ist die Gesundheitspolitik ein nicht enden wollender Zankapfel, bei dem die „Reform nach der Reform“ mittlerweile keinen Ausnahmefall mehr darstellt. Auch die derzeitige Debatte, angestoßen durch den jetzigen Gesundheitsminister Phillip Rösler (FDP), um die Einführung einer sogenannten Kopfpauschale, birgt ebenfalls
enormen politischen Sprengstoff.
Ziel dieser Arbeit ist es, das Zustandekommen der Gesundheitsreform 2007 im Hinblick auf die Durchsetzung der verschiedenen Interessen der Beteiligten zu untersuchen.
Dabei wird es weniger um Inhalte der Reform an sich, sondern um Prozesse, Institutionen und Akteure gehen, die einen Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess deutlich machen konnten.
Diese Arbeit wird die auftretenden Machtkonstellationen anhand der sogenannten Vetospielertheorie von George Tsebelis beleuchten, die im ersten Teil kurz vorgestellt wird. Dabei soll auch geklärt werden, inwiefern dieser theoretische Ansatz Stärken und
Schwächen bei der empirischen Anwendung offenbart.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung
- B Reformen in der Großen Koalition 2005-2009: Die Gesundheitsreform 2007 - Ein Fallbeispiel anhand der Vetospielertheorie
- I. Grundlagen zur empirischen Analyse
- I.1 Die Vetospielertheorie nach George Tsebelis und ihre Erweiterung
- I.2 Die politische Ausgangslage 2007 - Diskussion und Meinungsfindung in der Großen Koalition
- II. Vetospieler im politischen System der BRD
- III. Akteure und Interessen der Gesundheitsreform 2007 und ihr Einfluss (Vetomacht) auf den Gesetzgebungsprozess und die Anwendbarkeit der Vetospielertheorie
- III.1 Das Bundesministerium für Gesundheit
- III.2 Die Bundesländer
- III.3 Konflikte in der Großen Koalition (SPD vs CDU/CSU) und innerhalb der Koalitionspartner
- III.4 Kurzer Überblick der „Sonstigen Vetospieler\" - Verbände, Interessengruppen und die Opposition im Bundestag
- C Zusammenfassung und Ausblick
- D Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Zustandekommen der Gesundheitsreform 2007 im Hinblick auf die Durchsetzung der verschiedenen Interessen der Beteiligten. Der Fokus liegt dabei weniger auf den Inhalten der Reform selbst, sondern auf den Prozessen, Institutionen und Akteuren, die einen Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess hatten.
- Analyse der Vetospielertheorie von George Tsebelis und ihre Relevanz für die Gesundheitsreform 2007
- Identifizierung der wichtigsten Akteure und ihrer Interessen im Gesetzgebungsprozess
- Untersuchung der Machtkonstellationen im Zusammenhang mit der Gesundheitsreform
- Bewertung der Anwendbarkeit der Vetospielertheorie auf den deutschen Kontext
- Analyse der Prozesse und Dynamiken, die zur Verabschiedung der Gesundheitsreform führten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema der Gesundheitsreform 2007 und stellt die Problematik der Reform im Kontext der Vetospielertheorie dar. Im ersten Kapitel werden die Grundlagen der Vetospielertheorie nach George Tsebelis erläutert und ihre Anwendbarkeit auf den deutschen Kontext diskutiert. Außerdem wird die politische Ausgangslage im Jahr 2007 beschrieben, einschließlich der Diskussionen und Meinungsfindungsprozesse innerhalb der Großen Koalition. Im zweiten Kapitel werden die wichtigsten Vetospieler im politischen System der Bundesrepublik Deutschland vorgestellt. Kapitel drei analysiert die Akteure und Interessen der Gesundheitsreform 2007 und untersucht deren Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess. Hierbei werden insbesondere die Rolle des Bundesministeriums für Gesundheit, der Bundesländer, der Konflikte innerhalb der Großen Koalition und der „Sonstigen Vetospieler\" (Verbände, Interessengruppen, Opposition) betrachtet.
Schlüsselwörter
Gesundheitsreform, Vetospielertheorie, Gesetzgebungsprozess, Interessenvertretung, Machtkonstellationen, politische Prozesse, Bundesministerium für Gesundheit, Bundesländer, Große Koalition, Interessengruppen, Opposition.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern der Gesundheitsreform 2007?
Zentraler Kern war die Einführung des Gesundheitsfonds (ab 2009) und das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG).
Was ist die Vetospielertheorie nach George Tsebelis?
Diese Theorie besagt, dass politische Reformen schwieriger umzusetzen sind, je mehr Akteure (Vetospieler) zustimmen müssen und je weiter deren Interessen auseinanderliegen.
Wer waren die wichtigsten Akteure der Gesundheitsreform 2007?
Dazu gehörten das Bundesministerium für Gesundheit, die Bundesländer, die Koalitionspartner SPD und CDU/CSU sowie verschiedene Verbände und Krankenkassen.
Warum wurde der Gesundheitsfonds so stark kritisiert?
Kritiker wie Karl Lauterbach bezeichneten ihn als überflüssig; andere sahen darin eine übermäßige Bürokratisierung und eine Schwächung der finanziellen Autonomie der Kassen.
Welche Rolle spielten die Bundesländer bei der Reform?
Die Bundesländer fungierten als institutionelle Vetospieler im Bundesrat und konnten so maßgeblichen Einfluss auf die endgültige Ausgestaltung des Gesetzes nehmen.
- Quote paper
- Sebastian Kuschel (Author), 2010, Reformen in der Großen Koalition 2005-2009: Die Gesundheitsreform 2007 , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170687