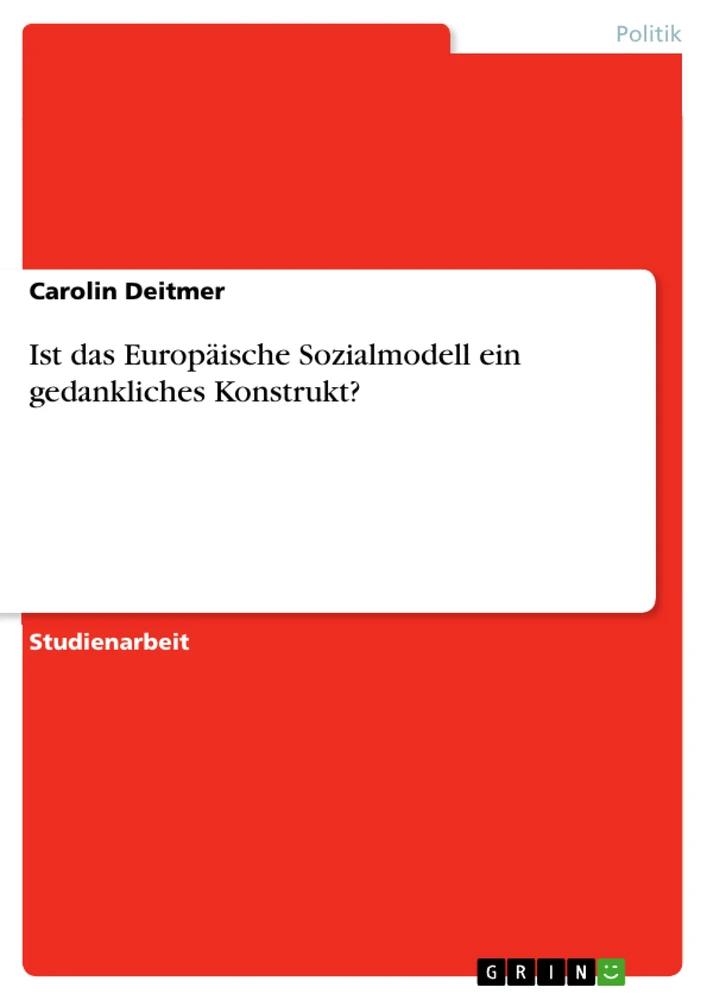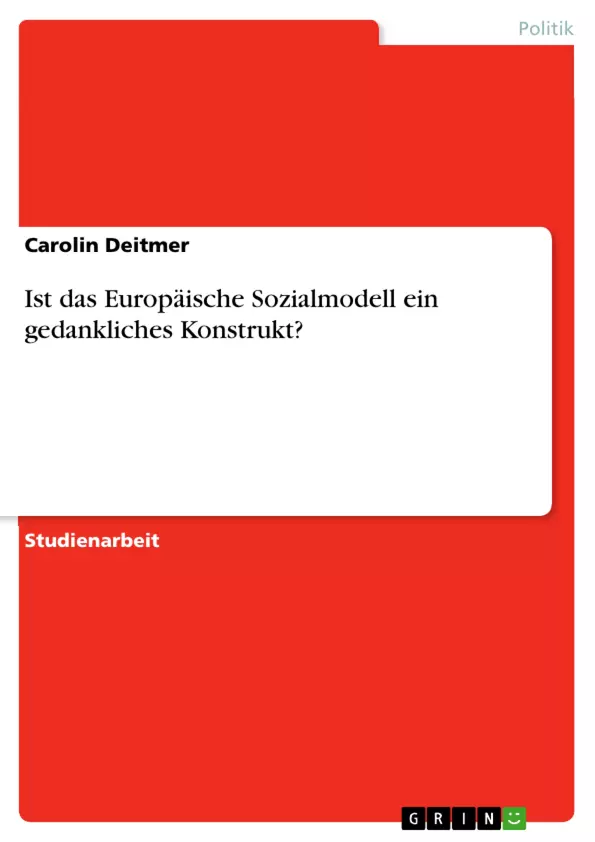Als José Manuel Barroso, Präsident der Europäischen Kommission, im März 2009 kurz vor dem Weltfinanzgipfel in London betonte, wie stolz die EU auf ihr Europäisches Sozialmodell sei und dass es als Inspiration für Staatenlenker aus aller Welt diene, unterstrich er zum einen die Existenz und zum anderen die besondere Wichtigkeit des Modells.
Doch was genau ist dieses Modell eigentlich? Was steckt hinter dem Begriff „Europäisches Sozialmodell“?
Ein Blick auf die Geschichte zeigt, dass Europäische Sozialpolitik keinesfalls ein Anfangsziel der europäischen Integration von 1950 war. Erst ab Ende der 1980er Jahre nahm der soziale Aspekt der europäischen Integration stärkere Konturen an, als Jaques Delors, damaliger Kommissionspräsident, die Vision einer gemeinsamen Sozialpolitik im Rahmen des Binnenmarktprojektes suggerierte. Man ging davon aus, dass das Binnenmarktprojekt die „Europäisierung des Arbeitsmarktes“ nach sich zöge – und so wurde das Konzept eines „europäischen Sozialraums“ aufgeworfen. Dieses Konzept trägt die Bezeichnung „Europäisches Sozialmodell“ (ESM).
Eine genaue Definition des ESM fällt allerdings schwer, so findet man in der Literatur die unterschiedlichsten Erklärungen, die aber weitgehend die geringe Greifbarkeit des Modells unterstreichen. Wolfram Lamping beispielsweise kam zu dem Schluss, dass die Suche nach dem ESM der „Jagd nach einer schwarzen Katze in einem dunklen Raum“ gleichkomme. Die Europäische Kommission hingegen konkretisierte das Modell, indem sie von gemeinsamen Werten und Zielvorgaben sprach.
Zwar wurde viel über das ESM publiziert, dennoch blieb die Frage nach dem genauen Wesen des Modells offen: Es lässt sich in der Literatur keine übereinstimmende Begriffsbestimmung finden. Vom Charakter eines konkreten Modells mit tatsächlichen Zielen bis zum Charakter eines rein normativen Entwurfs, also eines gedankliches Konstrukts, ist alles anzutreffen. Ein gedankliches Konstrukt ist mit einer „Leitidee“ gleichzusetzen. Es stellt keinesfalls ein „reales Phänomen“ dar, sondern kann auch mit „Fiktion und Illusion“ umschrieben werden.
Angesichts dieser Forschungslücke stellt sich die Frage nach dem Wesen des ESM. Es gilt zu untersuchen, ob es nicht eher ein gedankliches Konstrukt als ein reales Modell ist. Die vorliegende Arbeit widmet sich dieser Fragestellung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Annäherung an den wichtigsten Begriff
- Geschichte des ESM
- Definitionsversuch des ESM
- Theoretischer Rahmen und Inkrementalismus
- Untersuchung der Bekanntheit/Akzeptanz des Europäischen Sozialmodells in der europäischen Öffentlichkeit
- Untersuchung der Möglichkeit, ein kohärentes ESM zu formen
- Typologie europäischer Wohlfahrtstaaten
- Typologisierung nach Esping-Andersen
- Weitere Typologisierung
- Untersuchung nach sozio-ökonomischen Kriterien
- Erwartungen europäischer Staaten an ein Europäisches Sozialmodell
- Beurteilung der Modellbildung
- Untersuchung der konkreten Instrumente zur Bildung eines ESM
- Mindeststandard-/Harmonisierungsmodell
- Offene Methode der Koordinierung (OMK)
- Korridor-Konvergenz-Modell
- Fazit: Das Wesen des ESM
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob das Europäische Sozialmodell (ESM) eher ein gedankliches Konstrukt oder ein reales Modell ist. Sie untersucht den Begriff des ESM, seine Geschichte und die unterschiedlichen Definitionen, die in der Literatur existieren.
- Definition und Entwicklung des Europäischen Sozialmodells
- Die Bedeutung des ESM in der europäischen Integration
- Typologie und Charakteristika europäischer Wohlfahrtsstaaten
- Möglichkeiten und Grenzen der Bildung eines kohärenten ESM
- Analyse von Instrumenten und Strategien der europäischen Sozialpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in die Thematik des Europäischen Sozialmodells ein und stellt die Forschungsfrage nach seinem Wesen. Sie erläutert die Herausforderungen bei der Definition des Modells und gibt einen Überblick über die wichtigsten Bereiche, die in der Arbeit behandelt werden.
Kapitel 2 analysiert den Begriff des ESM und zeichnet seine historische Entwicklung nach. Es werden verschiedene Definitionen vorgestellt und der theoretische Rahmen sowie der Inkrementalismus in Bezug auf das ESM beleuchtet.
Kapitel 3 untersucht die Bekanntheit und Akzeptanz des ESM in der europäischen Öffentlichkeit. Darüber hinaus werden die Charakteristika der europäischen Wohlfahrtsstaaten analysiert, um die Möglichkeit einer kohärenten Modellbildung zu untersuchen.
Kapitel 4 konzentriert sich auf die konkreten Instrumente, die zur Bildung eines ESM eingesetzt werden können. Es werden verschiedene Ansätze wie das Mindeststandard-/Harmonisierungsmodell, die Offene Methode der Koordinierung (OMK) und das Korridor-Konvergenz-Modell vorgestellt und diskutiert.
Schlüsselwörter
Europäisches Sozialmodell, Wohlfahrtsstaat, Sozialpolitik, Europäische Integration, Inkrementalismus, Typologie, Harmonisierung, Offene Methode der Koordinierung (OMK), Konvergenz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Europäische Sozialmodell" (ESM)?
Das ESM beschreibt die Vision eines gemeinsamen europäischen Sozialraums mit geteilten Werten und Zielvorgaben, der im Zuge der wirtschaftlichen Integration (Binnenmarkt) entstand.
Ist das ESM ein reales Modell oder ein gedankliches Konstrukt?
Dies ist die Kernfrage der Arbeit. Es wird untersucht, ob das ESM ein konkretes Modell mit festen Zielen ist oder eher eine "Leitidee" bzw. Fiktion darstellt.
Welche Instrumente werden zur Bildung des ESM genutzt?
Wichtige Instrumente sind das Mindeststandard-Modell, die Offene Methode der Koordinierung (OMK) und das Korridor-Konvergenz-Modell.
Warum fällt eine genaue Definition des ESM schwer?
Aufgrund der Vielfalt nationaler Wohlfahrtsstaaten (Typologien nach Esping-Andersen) gibt es keine einheitliche Begriffsbestimmung in der Literatur.
Was bedeutet Inkrementalismus im Kontext der europäischen Sozialpolitik?
Er beschreibt die schrittweise, oft langsame Entwicklung der Sozialpolitik als Reaktion auf die wirtschaftliche Integration, statt eines großen, sofortigen Wurfs.
- Quote paper
- B.A. Carolin Deitmer (Author), 2010, Ist das Europäische Sozialmodell ein gedankliches Konstrukt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170881