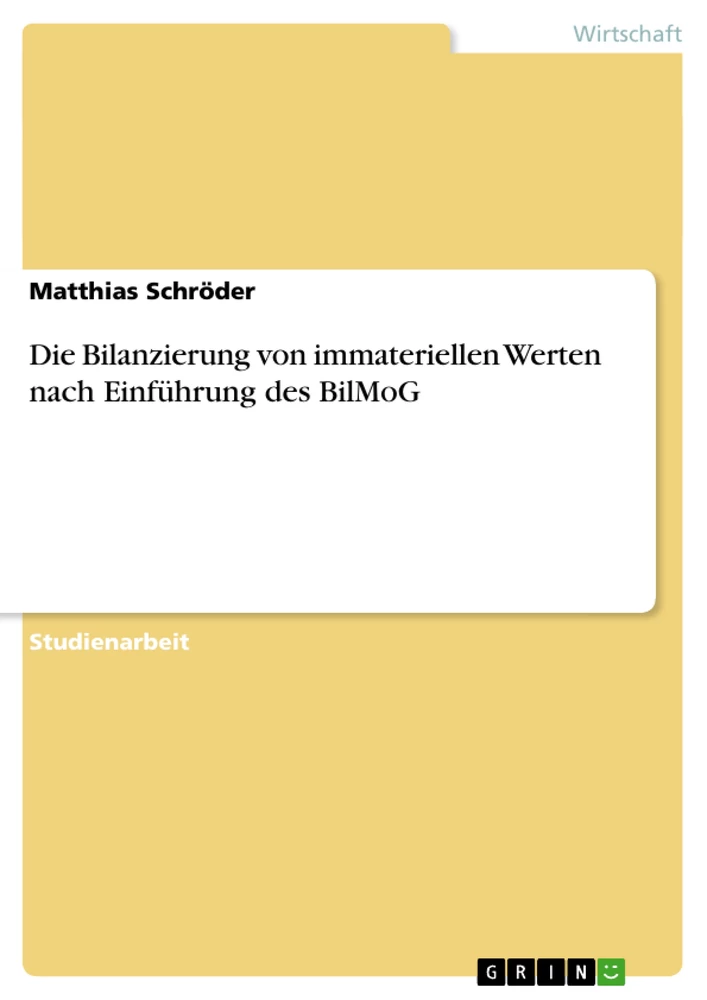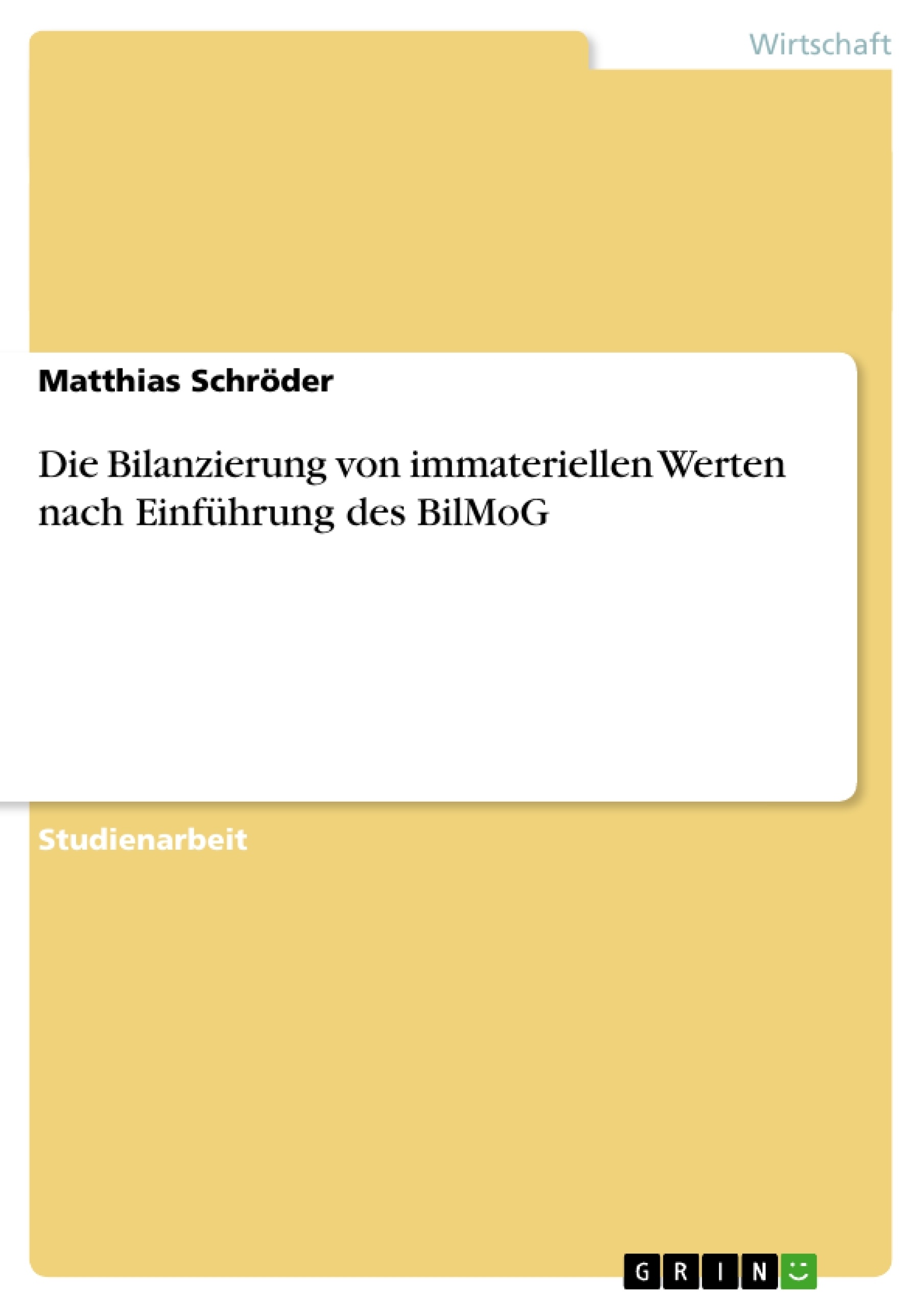Diese Seminararbeit soll die Möglichkeiten der Bilanzierung von immateriellen Vermögensgegenständen nach der Einführung des BilMoG erläutern und auf Probleme hinweisen, die sich durch die neuen Regelungen ergeben können. Dabei wird zuerst untersucht, welche Voraussetzungen zur Aktivierung existieren, wo dies in der Bilanz geschieht und in welcher Höhe sie erfolgt. Danach werden wichtige Aspekte erläutert, die sich unmittelbar aus der Bilanzierung ergeben. Gegen Ende wird auf mögliche Probleme aufmerksam gemacht, sowie kritisch zur gesetzlichen Neuerung Stellung genommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition eines Vermögensgegenstandes
- 3. Die Bilanzierung dem Grunde nach
- 3.1 Anschaffung oder Herstellung
- 3.2 Anlage- oder Umlaufvermögen
- 3.3 Ansatzverbote und der Geschäfts- oder Firmenwert
- 4. Bilanzierung der Höhe nach
- 4.1 Zugangsbewertung
- 4.1.1 Herstellungskosten
- 4.1.2 Forschung und Entwicklung
- 4.2 Der Aktivierungszeitpunkt
- 4.3 Folgebewertung
- 4.1 Zugangsbewertung
- 5. Folgen der Aktivierung
- 5.1 Die Ausschüttungssperre
- 5.2 Steuerliche Auswirkungen
- 5.3 Angaben im Anhang
- 6. Übergangsvorschriften
- 7. Vor- und Nachteile einer Aktivierung
- 8. Das Problem der Vergleichbarkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit den Möglichkeiten der Bilanzierung von immateriellen Vermögensgegenständen nach Einführung des BilMoG. Sie analysiert die Voraussetzungen für die Aktivierung, die Bilanzierungshöhe sowie die Konsequenzen, die sich aus der Bilanzierung ergeben.
- Voraussetzungen für die Aktivierung von immateriellen Vermögensgegenständen
- Bilanzierungshöhe immaterieller Vermögensgegenstände
- Konsequenzen der Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände
- Problematik der Vergleichbarkeit im Kontext der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände
- Bewertung der gesetzlichen Neuerung im BilMoG
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung in die Thematik und beleuchtet die wachsende Bedeutung von immateriellem Vermögen in der heutigen Wirtschaft. Es wird auf die historische Entwicklung der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände eingegangen und die Motivation des BilMoG erläutert.
Kapitel 2 definiert den Begriff des Vermögensgegenstandes im Rahmen der Bilanzierung.
Kapitel 3 befasst sich mit der grundsätzlichen Bilanzierung von immateriellen Vermögensgegenständen. Es werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die Einordnung in das Anlage- oder Umlaufvermögen diskutiert. Außerdem werden Ansatzverbote und die Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes betrachtet.
Kapitel 4 befasst sich mit der Bilanzierung der Höhe nach. Es werden die Zugangsbewertung, insbesondere die Herstellungskosten und die Bewertung von Forschung und Entwicklung, sowie der Aktivierungszeitpunkt und die Folgebewertung beleuchtet.
Kapitel 5 erörtert die Folgen der Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände, wie die Ausschüttungssperre, die steuerlichen Auswirkungen und die Anforderungen an die Angaben im Anhang.
Kapitel 6 behandelt die Übergangsvorschriften des BilMoG.
Kapitel 7 analysiert die Vor- und Nachteile der Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände.
Kapitel 8 diskutiert das Problem der Vergleichbarkeit von Bilanzierungen immaterieller Vermögensgegenstände aufgrund der unterschiedlichen Regelungen im BilMoG, IFRS und US-GAAP.
Schlüsselwörter
Immaterielle Vermögensgegenstände, Bilanzierung, BilMoG, HGB, IFRS, US-GAAP, Aktivierung, Ansatzverbote, Geschäfts- oder Firmenwert, Herstellungskosten, Forschung und Entwicklung, Folgebewertung, Vergleichbarkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was änderte das BilMoG bei der Bilanzierung immaterieller Werte?
Mit der Einführung des BilMoG wurden neue Möglichkeiten zur Aktivierung von selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens geschaffen, was zuvor im HGB weitgehend untersagt war.
Welche Voraussetzungen müssen für eine Aktivierung erfüllt sein?
Es muss sich um einen Vermögensgegenstand handeln, der die Kriterien der Greifbarkeit und Einzelveräußerbarkeit erfüllt und eindeutig den Herstellungskosten zugeordnet werden kann.
Wie wird zwischen Forschung und Entwicklung unterschieden?
Forschungskosten unterliegen einem strikten Aktivierungsverbot, während Entwicklungskosten unter bestimmten Voraussetzungen aktiviert werden dürfen. Die Trennung dieser Phasen ist ein zentrales Problem der Bilanzierungspraxis.
Was ist die Ausschüttungssperre im Kontext des BilMoG?
Um den Gläuberschutz zu gewährleisten, dürfen Gewinne, die nur durch die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Werte entstehen, nicht an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Gibt es Unterschiede zwischen HGB, IFRS und US-GAAP?
Ja, die Arbeit diskutiert das Problem der Vergleichbarkeit, da die Regelungen zur Aktivierung und Bewertung immaterieller Werte in den verschiedenen Rechnungslegungssystemen erheblich voneinander abweichen.
Was sind die Nachteile einer Aktivierung immaterieller Werte?
Zu den Nachteilen zählen ein erhöhter Dokumentationsaufwand, potenzielle steuerliche Auswirkungen und eine geringere Transparenz für externe Bilanzleser aufgrund von Bewertungsspielräumen.
- Arbeit zitieren
- Matthias Schröder (Autor:in), 2010, Die Bilanzierung von immateriellen Werten nach Einführung des BilMoG, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170888