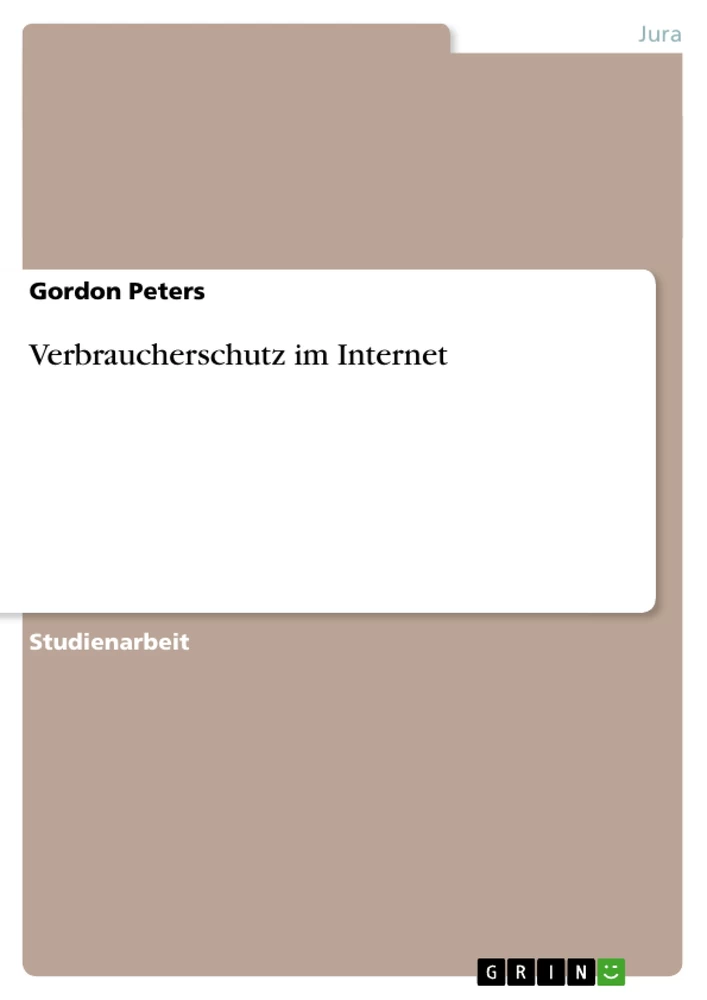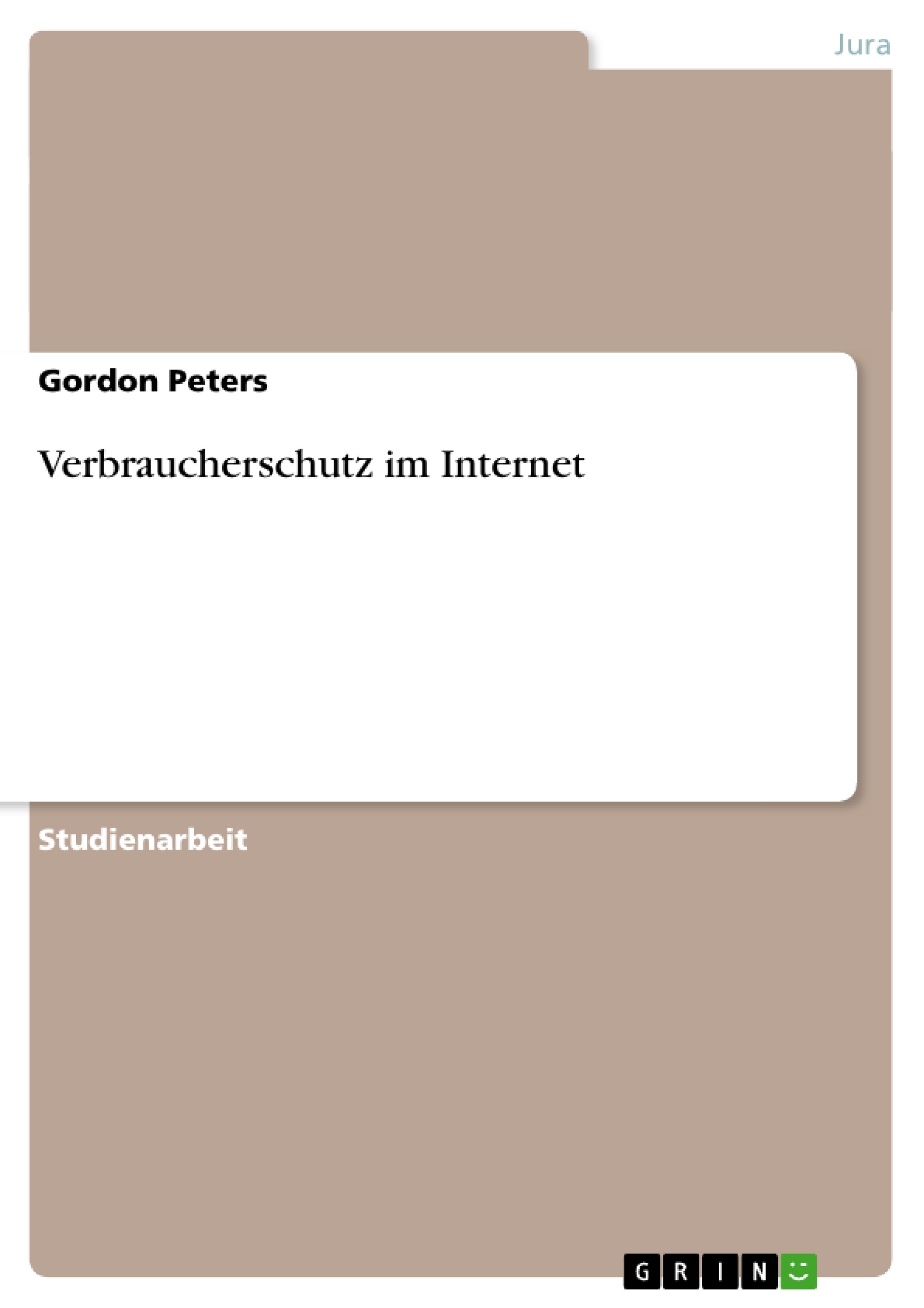Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen einer Präsentation für den Kurs Zivilrecht
erstellt und ist die Dokumentation des „gesprochenen Wortes“ des Vortrages.
Das Thema Verbraucherschutz im Internet ist aus zweierlei Gründen aktuell.
Zum einen aufgrund der Novellierung des Schuldrechtes im Jahre 2002 und
der damit verbundenen Stärkung der Verbraucherrechte im Allgemeinen. Zum
anderen wegen der, in den letzten Jahren explosionsartig verlaufenen Entwicklung
des Internets. Diese Entwicklung hat zwar ihren Zenith überschritten, was
das Wachstum betrifft, das Medium Internet ist aber aus dem täglichen Leben
nicht mehr wegzudenken. Gerade der Abschluss von Rechtsgeschäften belegt
einen der vorderen Plätze in der Nutzungshierarchie. Somit bedarf die enorme
Signifikanz der Rechtssicherheit beim Vertragsschluss im Netz keiner Erklärung.
Die Arbeit gliedert sich in 4 thematische Abschnitte in denen die Darstellung
aus Sicht des Verbrauchers erfolgt. Das bedeutet, es wird beschrieben, was der
Kunde im Internet vom Anbieter erwarten darf. Dazu werden besonders wichtige
Pflichten des Unternehmers aufgezählt und erläutert wobei jeweils auch die
zivilrechtliche Basis dieses „Soll“-Verhaltens genannt wird. Kritisch betrachtet
wird jeweils auch die tatsächliche Umsetzung bzw. Einhaltung der Vorgaben
des BGB.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Angebot und Annahme
1.1. Der Vertragsschluss im Internet
2.2. Pflichten des Anbieters nach Annahme
Bestätigung der Bestellung
Mittel zur Korrektur der Eingabe
Darstellung des Bestellablaufs
3. Information
Identität des Unternehmers
Eigenschaften des Vertragsgegenstandes
Widerrufs- und Rückgaberecht
4. Widerruf
5. AGB in Online Verträgen
6. Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen einer Präsentation für den Kurs Zivilrecht erstellt und ist die Dokumentation des „gesprochenen Wortes“ des Vortrages. Das Thema Verbraucherschutz im Internet ist aus zweierlei Gründen aktuell. Zum einen aufgrund der Novellierung des Schuldrechtes im Jahre 2002 und der damit verbundenen Stärkung der Verbraucherrechte im Allgemeinen. Zum anderen wegen der, in den letzten Jahren explosionsartig verlaufenen Entwicklung des Internets. Diese Entwicklung hat zwar ihren Zenith überschritten, was das Wachstum betrifft, das Medium Internet ist aber aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Gerade der Abschluss von Rechtsgeschäften belegt einen der vorderen Plätze in der Nutzungshierarchie. Somit bedarf die enorme Signifikanz der Rechtssicherheit beim Vertragsschluss im Netz keiner Erklärung.
Die Arbeit gliedert sich in 4 thematische Abschnitte in denen die Darstellung aus Sicht des Verbrauchers erfolgt. Das bedeutet, es wird beschrieben, was der Kunde im Internet vom Anbieter erwarten darf. Dazu werden besonders wichtige Pflichten des Unternehmers aufgezählt und erläutert wobei jeweils auch die zivilrechtliche Basis dieses „Soll“-Verhaltens genannt wird. Kritisch betrachtet wird jeweils auch die tatsächliche Umsetzung bzw. Einhaltung der Vorgaben des BGB.
1. Angebot und Annahme
1.1. Der Vertragsschluss im Internet
Im Internet geschlossene Verträge entsprechen der Rechtsfigur des Vertragsschlusses unter Abwesenden und fallen innerhalb des BGB unter den Begriff Fernabsatzvertrag. In §312b Abs. 1 wird definiert, welche Eigenschaften diese Verträge bzw. ihr Zustandekommen haben. Ein wesentliches Kriterium ist dabei die Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für die Abgabe von Willenserklärungen zur Anbahnung bzw. zum Abschluss eines Vertrages. Die genaue Abgrenzung eines Fernabsatzvertrages von einem „normalen“ Vertrag ist erforderlich, weil die Anwendung des BGB-Fernabsatzrechtes solch eine Art Vertrag voraussetzt.
Der Regel- bzw. häufigste Fall rechtsgeschäftlichen Handelns eines Verbrauchers im Internet ist das Online Shopping. Dabei werden von einer natürlichen Person Waren für den nicht gewerblichen Bedarf erworben. (vgl. §13 BGB - Verbraucherdefinition)[1]
Im Unterschied zum „realen“ Einkauf gibt der Kunde seine Willenserklärung nicht explizit, durch „herkömmliche“ verbale/nonverbale Kommunikation bzw. konkludent (Bsp.: Band der Supermarktkasse) ab, sondern per Mausklick oder Tastatur.
Hauptsächlich zwei Mechanismen dienen der technischen Realisierung. Die sicherlich prominenteste Lösung, ist das so genannte Warenkorbsystem. Die (Einkaufs-)Wirklichkeit wird abgebildet, indem der Kunde einen Artikel auswählen, und per Mausklick - vorerst unverbindlich - in seinen virtuellen Warenkorb legen kann. Erst am Ende eines, mehrere Schritte umfassenden, Bestellvorganges wird eine elektronische Willenserklärung generiert und an den Vertragspartner abgeschickt.
Die zweite Möglichkeit ist die Bestellung per E-Mail. Der Text muss dann alle konstitutiven Komponenten einer Willenserklärung für einen Vertragsschluss enthalten bzw. objektiv erkennen lassen. Die vom Verbraucher abgeschickten Erklärungen haben (soweit formal korrekt) verbindlichen Charakter und gelten bei „...Passieren der Schnittstelle des Online-Unternehmens...“ (T. Hoeren, 2003, S. 240) als zugegangen.
2.2. Pflichten des Anbieters nach Annahme
Das Angebot auf der Website eines Unternehmens hat in der Regel keine bindende Wirkung und stellt somit eine invitatio ad offerendum dar.[2] Dies hat zur Folge, dass die Verpflichtung eines Anbieters zu bestimmten Handlungen erst dann beginnt, wenn er eine Willenserklärung des Verbrauchers entgegengenommen hat bzw. diese in seinen Machtbereich gelangt ist. Die wichtigsten dieser „Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr“ (§312e) werden im Folgenden aufgezählt.
Bestätigung der Bestellung
Der Unternehmer hat dem Verbraucher „...den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen...“ (§312e Abs. 1 Satz 1 Nr. 3) Diese Bestätigung erfolgt in der Regel per E-Mail, muss aber konsequenterweise auf anderem Wege erfolgen, wenn keine E-Mail Adresse vom Verbraucher hinterlassen wurde. Inhalt der Bestätigung sollte die Zusammenfassung aller wesentlichen Eigenschaften des Rechtsgeschäftes sein. Formal wird damit die Annahme des Verbraucherangebotes (und damit auch die Annahme von dessen Willenserklärung) durch den Empfänger erklärt. Damit sind die konstitutiven Erfordernisse eines Vertragsschlusses erfüllt. Die Richtlinie 2000/31/EG
[...]
[1] Implizit hat das zur Folge, dass die im Folgenden beschriebenen Gesetze keine oder nur eingeschränkte Anwendung auf Online Auktionen haben.
[2] In der Rechtsgeschäftslehre werden Onlineangebote in die Kategorie des klassischen Versandhandels eingeordnet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Fernabsatzvertrag im Internet?
Ein Fernabsatzvertrag (§312b BGB) ist ein Vertrag über die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, der ausschließlich über Fernkommunikationsmittel (wie das Internet) abgeschlossen wird.
Wann kommt ein Vertrag beim Online-Shopping zustande?
In der Regel stellt das Angebot auf der Webseite eine "invitatio ad offerendum" dar. Der Vertrag kommt erst durch die Bestellung des Kunden und die Annahme durch den Anbieter zustande.
Welche Pflichten hat ein Online-Händler nach der Bestellung?
Der Unternehmer muss den Zugang der Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege bestätigen und dem Kunden Mittel zur Korrektur von Eingabefehlern zur Verfügung stellen.
Was beinhaltet das Widerrufsrecht für Verbraucher?
Verbraucher haben bei Fernabsatzverträgen grundsätzlich ein gesetzliches Widerrufsrecht, das es ihnen erlaubt, den Vertrag innerhalb einer bestimmten Frist ohne Angabe von Gründen rückgängig zu machen.
Welche Informationen muss ein Anbieter auf seiner Webseite bereitstellen?
Er muss unter anderem über seine Identität, die wesentlichen Eigenschaften des Produkts, den Gesamtpreis sowie über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts informieren.
Was ist der Unterschied zwischen Warenkorbsystem und E-Mail-Bestellung?
Warenkorbsysteme führen den Kunden durch einen strukturierten Prozess, während eine E-Mail-Bestellung alle für den Vertragsschluss notwendigen Komponenten explizit enthalten muss.
- Quote paper
- Gordon Peters (Author), 2003, Verbraucherschutz im Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17093