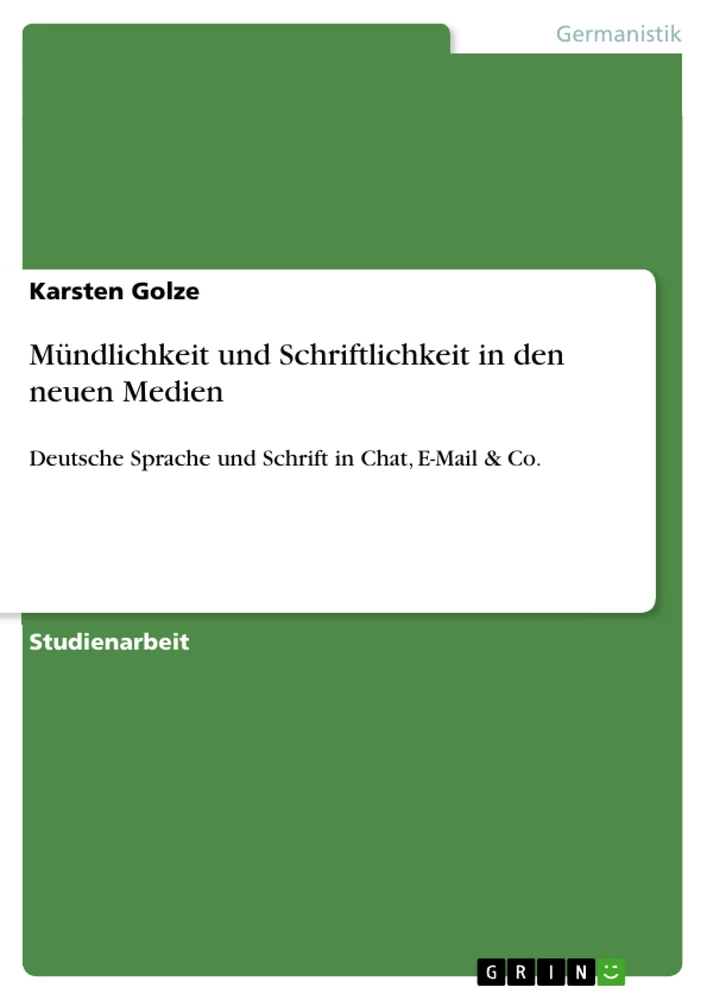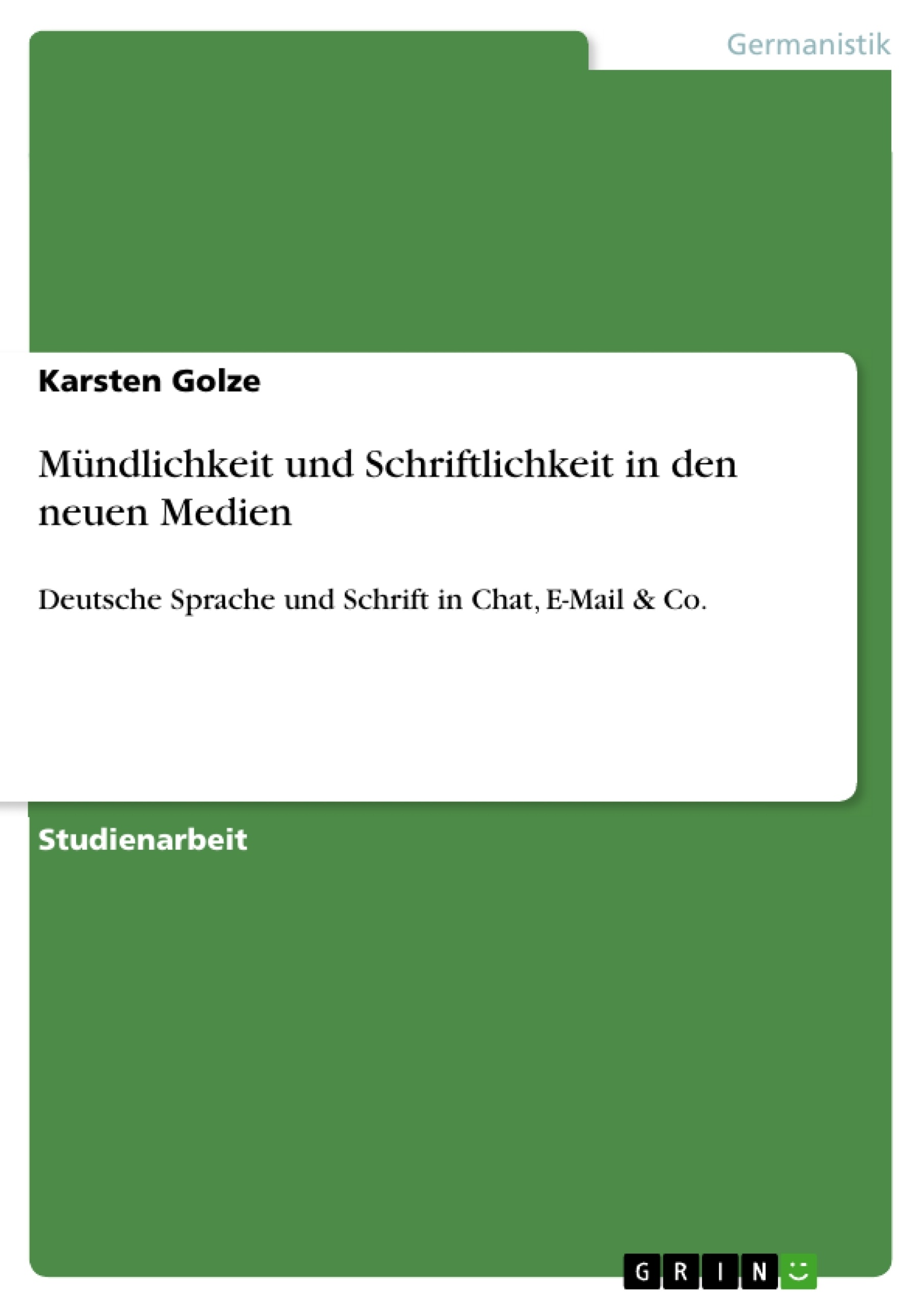LOL, Rofl, BRB oder AFK. Einigen Menschen dürften diese drei Abkürzungen nichts sagen. Anders verhält es sich allerdings bei Menschen, die schon einmal eine der zahlreichen Kommunikationsmöglichkeiten im Internet genutzt haben und sich mit derartigen Abkürzungen auskennen. Denn dann ließen sich diese ungewöhnlichen Buchstabenkombinationen einfach in Laughing out loud, Rolling on floor laughing, Be right back und Away from keyboard aufschlüsseln. Man müsste also schon selbst Teil einer Online-Community sein oder sich direkt mit dem Thema „Virtuelle Kommunikation“ befassen, um manche Gespräche und Aussagen der User zu verstehen.
Aktuelle Studien zeigen, dass die Kenner des Bereichs Netzsprache und deren Eigenheiten vor allem aus der jugendlichen Bevölkerung stammen. So erfährt man aus der Studie „Gesprächskultur in Deutschland 2009“, dass vor allem die unter 20-Jährigen nicht mehr sehr viel von einem direkten Gespräch – der sogenannten Face-to-Face-Kommunikation – halten. Nur die Hälfte dieser Gruppe gab an, dass das persönliche Gespräch die wichtigste Kommunikationsform sei (vgl. Gesprächskultur in Deutschland 2009 – Highlights der Studie). Netzsprache ist also vor allem ein Phänomen der jungen Generation. Und mit dem Wandel der gesprochenen Sprache, wie es beispielsweise die Jugendsprache zeigt, verändert sich auch die Sprache beim Schriftwechsel.
„Das Internet ist bislang noch ein schriftdominiertes Medium“ (Storrer 2000, S. 1). Das heißt, neben den neuaufkommenden Techniken, wie Voice-over-IP oder dem Video-Chat, sind es vor allem der Online-Chat, Foren, Instant Messaging oder der E-Mail-Verkehr, mit denen über das weltweite Netzwerk kommuniziert wird. Die meisten Unterhaltungen finden also nach wie vor schriftlich statt. Dabei verändert sich offensichtlich etwas in der geschriebenen Sprache der User. Formelle und unpersönliche Gewohnheiten beim Schriftwechsel weichen dem informellen und persönlichen Gespräch. Es findet also eine Annäherung an die Sprechsprache statt.
Dieses Phänomen und die Frage danach, ob diese Verschiebung zugunsten der Mündlichkeit die alltägliche Kommunikation zwischen Menschen weitläufig verändern kann, soll in der folgenden Arbeit diskutiert und geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Sprachentwicklung durch Netzsprache
- B. Deutsche Sprache und Schrift in Chat, E-Mail & Co.
- 1. Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der Netzkommunikation
- 1.1 Modell der Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- 1.2 Konzeptionelle Mündlichkeit im virtuellen Dialog
- 2. Kommunikationsdienste im Internet
- 2.1 E-Mail
- 2.1.1 E-Mail vs. Snail-Mail
- 2.1.2 Sprache in E-Mails
- 2.2 Instant-Messaging
- 3. Der Chat – Plaudern 2.0
- 3.1 Mediale und kommunikative Randbedingungen
- 3.2 Sprache und Gespräch im Chat
- 4. Dienstübergreifende Merkmale der Netzsprache
- C. Netzsprache als neue Form der schnellen Kommunikation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung der deutschen Sprache im Kontext der neuen Medien, insbesondere in Chat, E-Mail und Instant Messaging. Ziel ist es, die Veränderungen in der Mündlichkeit und Schriftlichkeit im virtuellen Dialog zu analysieren und deren Einfluss auf die alltägliche Kommunikation zu erörtern.
- Untersuchung der Veränderungen in der Schriftkultur durch die neuen Medien
- Analyse der medialen und konzeptionellen Dimensionen von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der Netzkommunikation
- Beschreibung der spezifischen Merkmale der Netzsprache in verschiedenen Kommunikationsdiensten
- Diskussion des Einflusses der Netzsprache auf die Entwicklung der deutschen Sprache
- Beurteilung der Rolle der Netzsprache in der heutigen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit der Sprachentwicklung durch Netzsprache und stellt die Besonderheiten der Online-Kommunikation im Kontext der Sprachgeschichte dar. Im zweiten Teil wird die deutsche Sprache und Schrift in Chat, E-Mail und Instant Messaging analysiert. Hierbei werden die Konzepte der Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der Netzkommunikation betrachtet, wobei das Modell von Koch/Oesterreicher eine zentrale Rolle spielt. Anschließend werden die verschiedenen Kommunikationsdienste im Internet detailliert beleuchtet, inklusive einer Analyse der sprachlichen Besonderheiten in E-Mails und im Chat.
Schlüsselwörter
Netzsprache, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Kommunikation, Internet, Chat, E-Mail, Instant Messaging, Sprachentwicklung, Medienwandel, Sprachvariation.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "Netzsprache"?
Netzsprache bezeichnet die sprachlichen Besonderheiten in der digitalen Kommunikation, wie Abkürzungen (LOL, AFK), Emoticons und eine Annäherung an die Sprechsprache.
Wie verändert das Internet das Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit?
Obwohl das Internet schriftdominiert ist, werden Texte oft "konzeptionell mündlich" verfasst – sie sind informell, persönlich und dialogorientiert wie ein Gespräch.
Was besagt das Modell von Koch/Oesterreicher?
Es unterscheidet zwischen medialer (Form) und konzeptioneller (Stil) Mündlichkeit/Schriftlichkeit, was hilft, die hybride Natur der Online-Chats zu erklären.
Ist Netzsprache nur ein Phänomen der Jugend?
Studien zeigen, dass besonders unter 20-Jährige die Netzsprache prägen und das persönliche Gespräch seltener als wichtigste Kommunikationsform ansehen.
Wie unterscheidet sich die Sprache in E-Mails vom Chat?
E-Mails sind oft noch stärker an die klassische Briefkultur angelehnt, während Chats durch hohe Geschwindigkeit und noch stärkere Mündlichkeit geprägt sind.
Was sind dienstübergreifende Merkmale der Netzsprache?
Dazu zählen Ökonomie (kurze Sätze), Expressivität (Akronyme) und der Einsatz von Interpunktion zur Vermittlung von Emotionen.
- Arbeit zitieren
- Karsten Golze (Autor:in), 2010, Mündlichkeit und Schriftlichkeit in den neuen Medien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170934