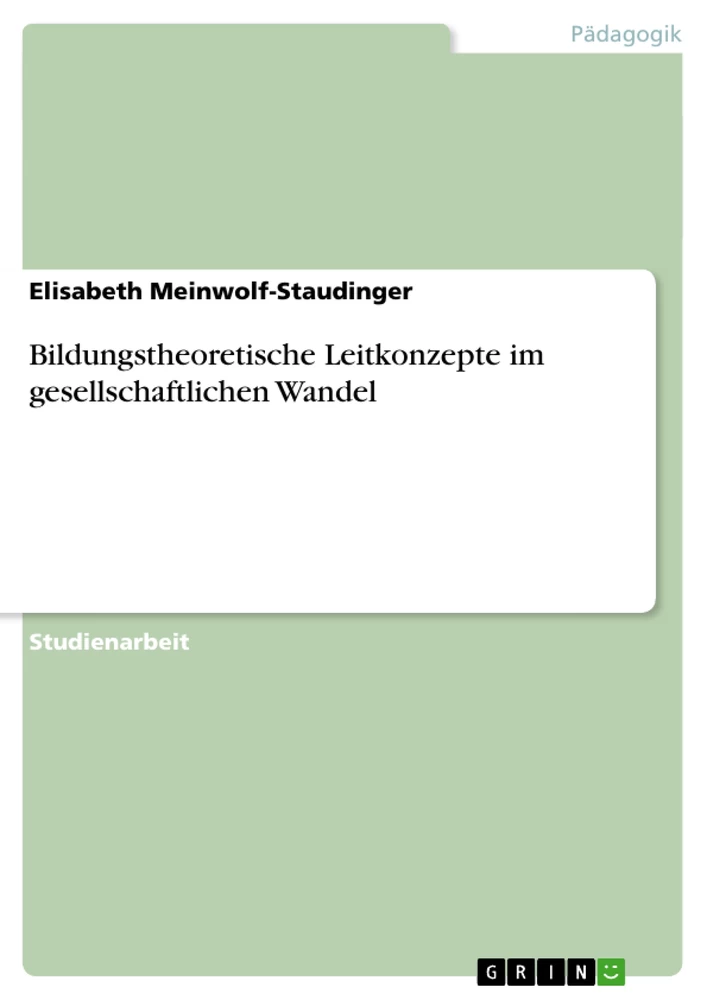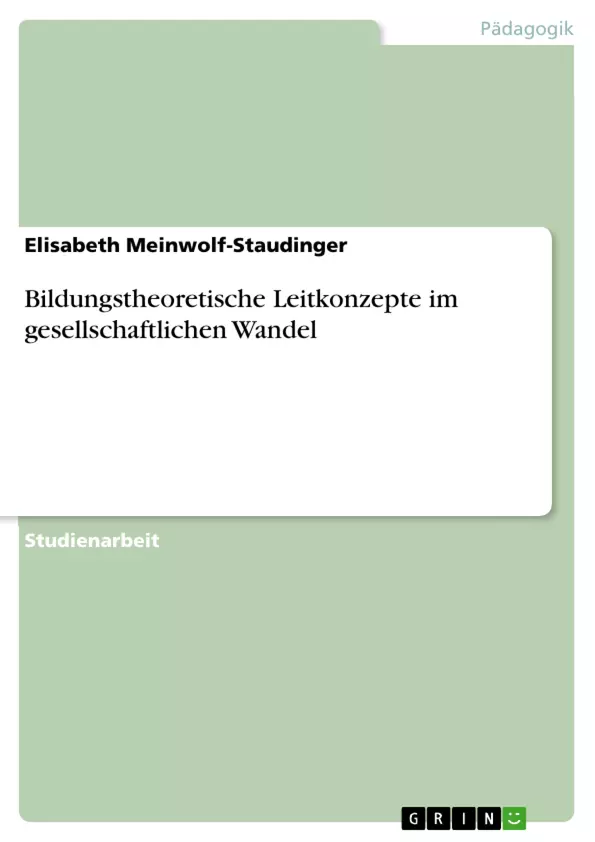Zusammenfassung
Bereits 1964 prägte Georg Picht den Begriff der „Bildungskatastrophe“, heute liegt uns der „PISA – Schock“ in den Ohren. Aussagen wie diese treffen auf´s Empfindlichste den Nerv des deutschen Volkes.
Dennoch wird erst in der Auseinandersetzung mit der Bildungshistorie deutlich, woher wir kommen und wohin wir gehen. Nachfolgend werde ich, ab dem späten 19. Jahrhundert, die Veränderung von Bildungstheoretischen Leitkonzepten betrachten und sie der Gesellschaftspolitischen Situation der jeweiligen Epoche gegenüberstellen.
Abschließend werde ich zum aktuellen Bildungsdiskurs in unserem Land unter Anderem die Gedanken von Andreas Seiverth (2007) rezitieren. Andreas Seiverth ist Bundesgeschäftsführer der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft.
Er betrachtet die Geschichte des deutschen Bildungsdiskurses im Horizont des Sputnik-Schocks und beschreibt es als langes Erwachen aus einem Überlegenheitstraum der Deutschen in Bezug auf Bildung. Er spricht von der anschließenden Unfähigkeit eines eigenständigen Reformenkurses und mokiert die Adaption von Bildungsstandards, die die Erkenntnisse der Bildungssieger aus den skandinavischen und angelsächsischen Ländern spiegeln.
Seiverth gibt zu bedenken, dass in Deutschland das Recht auf Bildung noch nie im Sozialstaatsprinzip eingeschlossen war, was in Diskrepanz zu den Bildungssiegern steht. Seine düstere Prognose lautet: „Wenn sich an dieser Systembedingung des deutschen Bildungssystems nichts ändert, muss man fataler Weise auf einen neuen Schock hoffen, der Einsicht bringt“.
Nachdem die amtierende konservative Regierungspartei nur halbherzig im sozialen Bereich investiert, wird die Bildungsdebatte für die nächsten Jahre wohl wieder abgespalten von einer sozialen Gleichberechtigungsdebatte geführt werden und der Ruf „Bildung für alle“ wird wie ungehört verhallen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesellschaftspolitische Situation und Bildungstheoretische Leitkonzepte im 19. Jahrhundert
- Gesellschaftspolitische Situation und Bildungstheoretische Leitkonzepte im 20. Jahrhundert
- Gesellschaftspolitische Situation und Bildungstheoretische Leitkonzepte nach Ende des 1. Weltkrieges
- Gesellschaftspolitische Situation und Bildungstheoretische Leitkonzepte von der Weimarer Republik bis zum 2. Weltkrieg
- Gesellschaftspolitische Situation und Bildungstheoretische Leitkonzepte nach dem 2. Weltkrieg
- Gesellschaftspolitische Situation und Bildungstheoretische Leitkonzepte im westlichen Teil Deutschlands
- Gesellschaftspolitische Situation und Bildungstheoretische Leitkonzepte im östlichen Teil Deutschlands
- Weltpolitik - Gesellschaftspolitische Situation und Bildungstheoretische Leitkonzepte der 60ger Jahre
- Westdeutschland in den 60ger Jahren
- Ostdeutschland in den 60ger Jahren
- Beginn der Wiedervereinigung Deutschlands, 80ger Jahre
- Bildungstheoretische Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung von Bildungstheoretischen Leitkonzepten im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen im 19. und 20. Jahrhundert. Die Arbeit analysiert die Einflüsse der politischen und wirtschaftlichen Situation auf die Gestaltung von Bildungssystemen und -inhalten.
- Der Einfluss der industriellen Revolution auf die Entwicklung von Bildungstheoretischen Leitkonzepten
- Die Bedeutung der gesellschaftlichen Reformbewegungen des frühen 20. Jahrhunderts für die Pädagogik
- Die Folgen von Weltkriegen und politischen Systemwechseln für Bildungssituationen in Deutschland
- Die Rolle von Schulreformen und Bildungspolitik im Wandel der Zeit
- Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Ansätzen der Bildungstheorie im Kontext der jeweiligen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die historische Entwicklung von Bildungstheoretischen Leitkonzepten im 19. und 20. Jahrhundert, beginnend mit dem Begriff der "Bildungskatastrophe" und dem "PISA-Schock" und beleuchtet die Relevanz historischer Analysen für die Gegenwart.
Das erste Kapitel analysiert die gesellschaftliche Situation und die Bildungstheoretischen Leitkonzepte im 19. Jahrhundert, mit einem Fokus auf die Industrialisierung, die Entwicklung des Obrigkeitsstaates und die Rolle des Gymnasiums als elitäre Bildungseinrichtung.
Das zweite Kapitel untersucht die gesellschaftliche Situation und die Bildungstheoretischen Leitkonzepte im 20. Jahrhundert, beginnend mit der Reformbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, die sich gegen den traditionellen Schulbetrieb und für eine schülergerechte Pädagogik einsetzte. Es werden verschiedene Schulreformer wie Hermann Lietz, Gustav Wyneken und Paul Geheeb und ihre Ideen vorgestellt, sowie die Entwicklung der Einheitsschule und die Rolle von Persönlichkeiten wie Georg Kerschensteiner und Johannes Tews. Der Einfluss der Weltkriege und die Debatte um Begabungsforschung und Begabungsförderung werden ebenfalls thematisiert.
Das dritte Kapitel beleuchtet verschiedene Perspektiven der Bildungstheorie, ohne jedoch weitere Inhalte zu verraten. Diese sind in der vollständigen Hausarbeit zu finden.
Schlüsselwörter
Bildungstheoretische Leitkonzepte, Gesellschaftspolitische Situation, Industrielle Revolution, Obrigkeitsstaat, Reformbewegung, Schulreform, Einheitsschule, Weltkriege, Begabungsforschung, Begabungsförderung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Georg Picht unter dem Begriff „Bildungskatastrophe“?
Der 1964 geprägte Begriff warnte vor einem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rückfall Deutschlands durch einen Mangel an qualifizierten Absolventen.
Wie beeinflusste die Industrielle Revolution die Bildung im 19. Jahrhundert?
Sie führte zu einer stärkeren Ausrichtung der Bildung auf wirtschaftliche Bedürfnisse, während das Gymnasium als elitäre Einrichtung des Obrigkeitsstaates bestehen blieb.
Welche Ziele verfolgte die Reformpädagogik im frühen 20. Jahrhundert?
Sie setzte sich gegen den starren Drill des traditionellen Schulsystems ein und forderte eine kindgerechte Pädagogik sowie die Förderung individueller Begabungen.
Was ist der „PISA-Schock“?
Der PISA-Schock bezeichnet die Ernüchterung über das durchschnittliche Abschneiden deutscher Schüler in internationalen Vergleichsstudien Anfang der 2000er Jahre.
Warum wird die soziale Gleichberechtigung in der Bildungsdebatte oft vernachlässigt?
Laut Kritikern wie Andreas Seiverth ist das Recht auf Bildung in Deutschland nicht tief genug im Sozialstaatsprinzip verankert, was zu einer Abkopplung von Bildungs- und Sozialdebatten führt.
- Citar trabajo
- Bachelor of Arts Elisabeth Meinwolf-Staudinger (Autor), 2010, Bildungstheoretische Leitkonzepte im gesellschaftlichen Wandel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171070