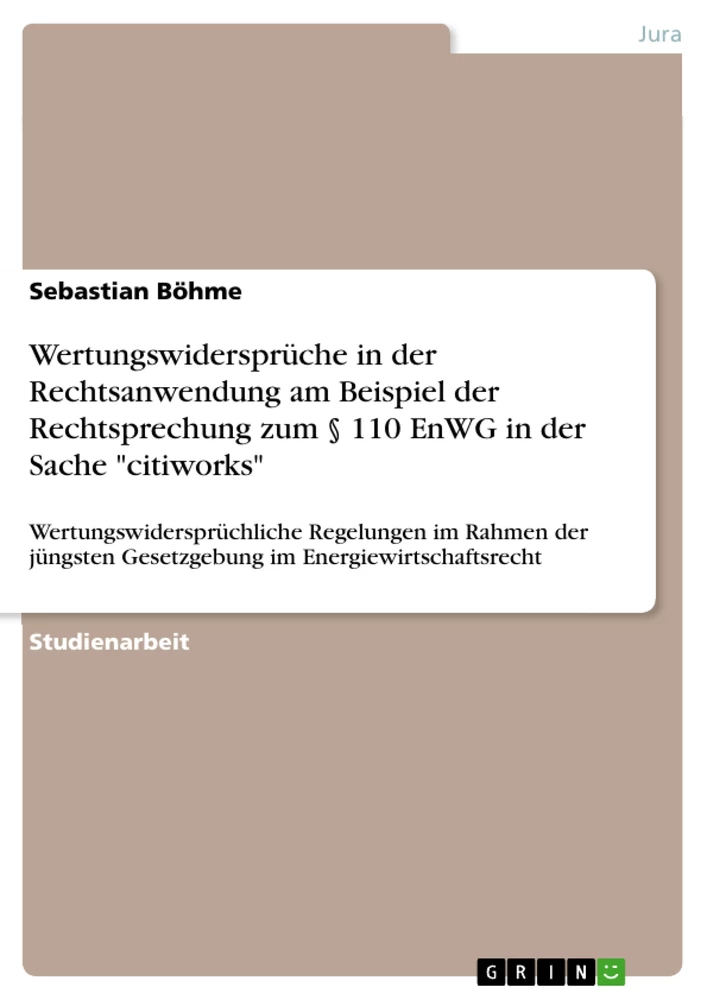Widersprüche in der Rechtsordnung stellen sowohl den Normgeber als auch den Rechtsanwender vor besondere Herausforderungen. Oftmals bereitet bereits die Identifikation eines Widerspruchs Schwierigkeiten. Wurde ein Widerspruch erkannt, so muss er entweder durch den Normgeber behoben oder durch den Rechtsanwender mit Hilfe besonderer Argumentationsmethoden gelöst werden. In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, inwiefern Wertungswidersprüche in der Rechtsanwendung auftauchen und wie sie behandelt werden. Hierzu ist der Wertungswiderspruch zunächst von anderen Widerspruchstypen abzugrenzen. Anschließend werden Prüfungsmaßstäbe erarbeitet, nach denen sich ein Wertungswiderspruch bemisst. Prüfungsgegenstand ist schließlich die Rechtsanwendung des § 110 EnWG in der Sache citiworks AG ./. Flughafen Leipzig/Halle GmbH. Die Praxisrelevanz der Entscheidungen zeigt sich an der Betroffenheit aller Objektnetze (Strom und Gas) in Deutschland. Zudem erlässt die Bundesnetzagentur seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes keine neuen Feststellungsbescheide mehr nach § 110 Abs. 4 EnWG. Es folgt vollumfänglich dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs und bejaht einen Netzzugangsanspruch gem. § 20 EnWG, auch wenn es sich um ein Objektnetz nach § 110 EnWG handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Wertungswidersprüchliche Regelungen im Rahmen der jüngsten Gesetzgebung im Energiewirtschaftsrecht
- Einleitung
- Das Citiworks-Urteil des EuGH – ein Paradigmenwechsel in der Rechtsprechung zum § 110 EnWG?
- Die Rechtsfrage im Citiworks-Urteil
- Die Entscheidung des EuGH
- Das Citiworks-Urteil im Kontext der Rechtsprechung zum § 110 EnWG
- Die Auswirkungen des Citiworks-Urteils auf die Rechtsanwendung des § 110 EnWG
- Die Regulierung der Objektnetze im Spannungsfeld von europäischem und nationalem Recht
- Das Ende der Objektnetze? Überlegungen zur Weiterentwicklung des § 110 EnWG
- Die EnWG-Novelle 2011
- Die Novelle im Kontext des Citiworks-Urteils
- Die neuen Regelungen zur Netzzugangsregulierung
- Kritik an der Novelle
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die wertungswidersprüchlichen Regelungen im Rahmen der jüngsten Gesetzgebung im Energiewirtschaftsrecht am Beispiel der Rechtsprechung zum § 110 EnWG in der Sache citiworks. Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen des Citiworks-Urteils des EuGH auf die Rechtsanwendung des § 110 EnWG zu analysieren und die Entwicklung des Energierechts im Kontext des europäischen Rechts zu beleuchten.
- Der Einfluss des Citiworks-Urteils auf die Rechtsprechung zum § 110 EnWG
- Die Problematik der Objektnetze im Spannungsfeld von europäischem und nationalem Recht
- Die Reform des Energiewirtschaftsrechts im Kontext des Citiworks-Urteils
- Die Bedeutung der Netzzugangsregulierung für die Energiewende
- Die Spannungen zwischen europäischem und nationalem Recht im Bereich des Energiewirtschaftsrechts
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit widmet sich der Einleitung und stellt die Problematik der wertungswidersprüchlichen Regelungen im Energiewirtschaftsrecht dar. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Citiworks-Urteil des EuGH, analysiert die Rechtsfrage und die Entscheidung des EuGH und betrachtet das Urteil im Kontext der Rechtsprechung zum § 110 EnWG. Das dritte Kapitel untersucht die Auswirkungen des Citiworks-Urteils auf die Rechtsanwendung des § 110 EnWG, beleuchtet die Regulierung der Objektnetze und diskutiert die Weiterentwicklung des § 110 EnWG. Das vierte Kapitel analysiert die EnWG-Novelle 2011 im Kontext des Citiworks-Urteils, betrachtet die neuen Regelungen zur Netzzugangsregulierung und kritisiert die Novelle.
Schlüsselwörter
Energiewirtschaftsrecht, § 110 EnWG, Citiworks-Urteil, Objektnetze, Netzzugangsregulierung, europäisches Recht, nationales Recht, EnWG-Novelle 2011, Energiewende.
- Quote paper
- Sebastian Böhme (Author), 2011, Wertungswidersprüche in der Rechtsanwendung am Beispiel der Rechtsprechung zum § 110 EnWG in der Sache "citiworks", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171116