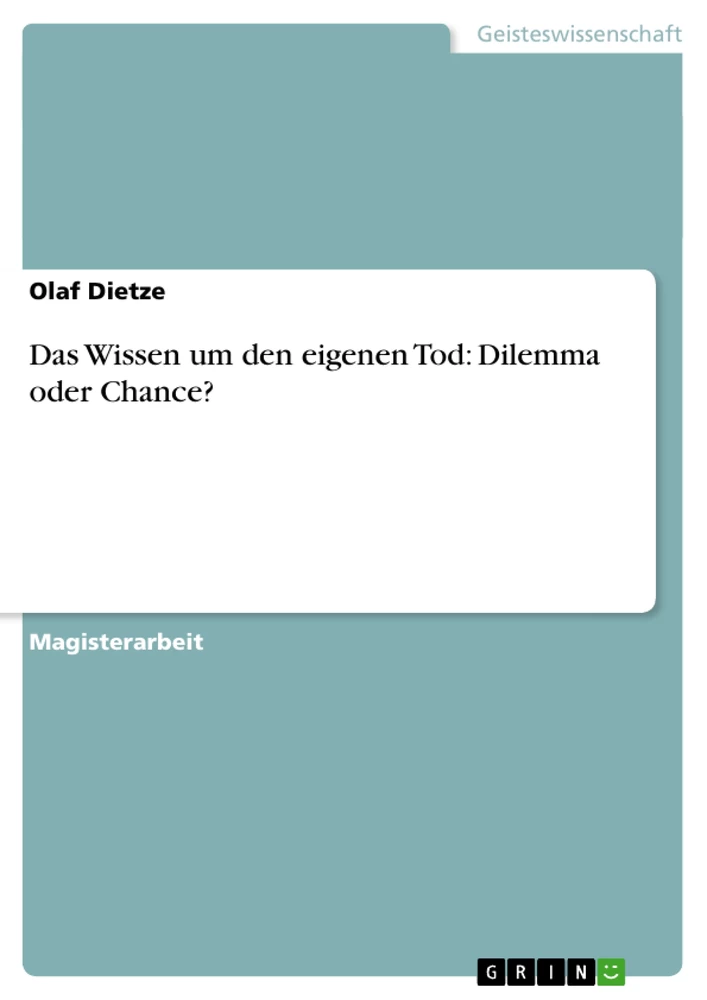Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage der Bedeutung des Wissens um
den eigenen Tod für den/die WissendeN. Die Arbeit richtet sich einerseits an
PhilosophInnen, andererseits auch an jedeN InteressierteN. Um die Lesbarkeit auch für die
zweite Gruppe von Personen zu erhöhen, sind einige Begriffe und Zusammenhänge in
Fußnoten erklärt. Gleicherart behandele ich einige Kritikpunkte an Positionen anderer
PhilosophInnen, die keinen oder nur geringen Einfluss auf die Entwicklung des Themas
haben, in Fußnoten.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Frage: „Das Wissen um den eigenen Tod: Dilemma oder
Chance?“ systematisch zu klären. 2 Dies soll in mehren Schritten erfolgen. Zur Einleitung gehe
ich kurz auf geschichtliche Gedanken zum Tod ein. Daraufhin kläre ich die Fragestellung und
mache einige Bemerkungen zu Philosophie und Methode in Bezug auf das Thema Tod.
Im ersten Hauptteil der Arbeit geht es um das Wissen um den eigenen Tod und die
Beschreibung der im Tod sterbenden Instanz. Dabei beschreibe ich anhand von Werner
Beckers Buch „Das Dilemma der menschlichen Existenz“ wie das Wissen um den eigenen
Tod entstanden sein könnte und welche Bedeutung es in der Geschichte der kulturellen Entwicklung gespielt hat. Daraufhin wird geklärt, was unser Wissen um den eigenen Tod
beinhaltet. Dies führt zur Frage, was der eigene Tod für einen selbst bedeutet, wobei ich auf
eine Theorie zurückgreife, die ich in der Auseinandersetzung mit der Frage „Was ist eine
Person?“ entwickelt haben. Diese Theorie argumentiert für eine Irrreduzibilität von Körper
und Geist. Durch diesen Schritt zeige ich, dass der Tod das absolute Ende des Lebens ist.
Im zweiten Hauptteil der Arbeit behandele ich die Frage, ob das Wissen, welches im
ersten Teil erarbeitet worden ist, ein Dilemma oder eine Chance für die wissende Person
darstellt. Dabei greife ich auf das Dilemma Beckers zurück und stelle diesem die
Möglichkeiten, die Heidegger dem Wissen um den eigenen Tod zuschreibt, gegenüber. [...]
2 Die Arbeit stützt sich in erster Linie auf die Werke: „Sein und Zeit“ (Heidegger), „Das Dilemma der
menschlichen Existenz“ (Becker), sowie „Freud und die analytische Philosophie des Geistes“ (Cavell). Letzteres
ist jedoch nur in Bezug auf den Personenbegriff relevant.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Konzeption der Arbeit
- 1.2 Kurzer Ausflug in die Geschichte und Eingrenzung des Themas
- 1.3 Klärung der Fragestellung
- 1.3.1 Das Wissen
- 1.3.2 Dilemma oder Chance?
- 2 Bemerkungen zu Philosophie und Methode in Bezug auf den Tod
- 2.1.1 Theorie und Motivation
- 2.1.2 Die Gültigkeit von Aussagen
- 2.1.3 Die Undurchsichtigkeit der Voraussetzungen
- 2.1.4 Das methodische Hauptproblem: Es gibt keine Erfahrung des Todseins
- 2.1.5 Philosophie und Autobiographie
- 2.1.6 Die atheistische Perspektive
- 2.1.7 Der eigene Anspruch: Vom Menschen her denken
- 3 Das Wissen um den eigenen Tod
- 3.1 Das Wissen vom eigenen Tod
- 3.1.1 Die geschichtliche Entstehung des kulturellen Wissens vom eigenen Tod
- 3.1.2 Das individuelle Wissen vom eigenen Tod
- 3.2 Das Wissen über den Tod: Analyse des Todes
- 3.2.1 Der existenzielle Begriff des Todes
- 3.2.2 Die Unerfahrbarkeit der Erfahrungen Anderer im Tod
- 3.2.3 Die Gewissheit des Todes
- 3.2.4 Die Endgültigkeit des Todes
- 3.2.5 Die Undenkbarkeit des Todseins
- 3.2.6 Die Unvertretbarkeit des Todes
- 3.2.7 Der Tod als Ende jeglicher Intersubjektivität
- 3.2.8 Die Ungewissheit der Todesart
- 3.2.9 Die Ungewissheit des Todeszeitpunktes
- 3.2.10 Das unvollendete Sterben
- 3.2.11 Zusammenfassende Analyse des Todes
- 4 Das Subjekt des Todes: Wer stirbt?
- 4.1 Individualität und Tod: Beckers Theorie der Individualität
- 4.1.1 Individualität ohne Todeswissen
- 4.2 Was macht ein Individuum aus: Dasein und Person
- 4.2.1 Das alltägliche Dasein
- 4.2.2 Das Fehlen des Augenblicks und der Geschichte in der Analyse Heideggers
- 4.2.3 Was ist eine Person?
- 4.2.3.1 Die Grundlagen
- 4.2.3.2 Die Irreduzibilität
- 4.2.3.3 Das Modell des Geistes und der Person
- 4.3 Das Subjekt des Todes
- 4.3.1 Folgerungen aus der Analyse des Subjekts des Todes für die Bedeutung des Todes einer Person
- 5 Der Tod als Dilemma
- 5.1 Das existenzielle Dilemma
- 5.2 Das Sinnproblem oder das metaphysische Dilemma
- 5.3 Das Nicht-wissen-wollen
- 5.3.1 Das uneigentliche Sein zum Tode (Heidegger)
- 5.3.2 Das Dilemma der menschlichen Existenz (Becker)
- 6 Das Wissen um den eigenen Tod als Chance
- 6.1 Das eigentliche Sein zum Tode
- 6.2 Das existenzielle Dilemma als Chance
- 7 Ethische Konsequenzen der Individualität
- 8 Versuch einer Selbstreflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die philosophische Bedeutung des Wissens um den eigenen Tod. Die Arbeit hinterfragt, ob dieses Wissen ein Dilemma oder eine Chance darstellt. Sie analysiert verschiedene philosophische Perspektiven und Theorien, um die komplexen Aspekte dieses Themas zu beleuchten.
- Das Wissen vom eigenen Tod: seine geschichtliche und individuelle Dimension.
- Analyse des Todesbegriffs: Existentielle, philosophische und ontologische Aspekte.
- Das Subjekt des Todes: Individualität und Person im Kontext des Sterbens.
- Der Tod als Dilemma: Existentielle, metaphysische und sinnbezogene Herausforderungen.
- Das Wissen um den Tod als Chance: Möglichkeiten der Selbstfindung und des authentischen Lebens.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Magisterarbeit ein und erläutert die Konzeption der Arbeit. Sie skizziert einen kurzen geschichtlichen Überblick über die Auseinandersetzung mit dem Thema des Todeswissens und präzisiert die zentrale Fragestellung, ob das Wissen um den eigenen Tod ein Dilemma oder eine Chance darstellt. Die Einleitung legt den methodischen Rahmen fest und grenzt das Thema sinnvoll ein.
2 Bemerkungen zu Philosophie und Methode in Bezug auf den Tod: Dieses Kapitel beleuchtet die methodischen Herausforderungen der philosophischen Auseinandersetzung mit dem Tod. Es thematisiert die Schwierigkeiten, den Tod aus einer Erfahrungsperspektive zu analysieren, da der Tod selbst unerfahrbar ist. Die Arbeit diskutiert verschiedene philosophische Zugänge und betont die Bedeutung einer anthropologischen Perspektive.
3 Das Wissen um den eigenen Tod: Dieses Kapitel analysiert das Wissen um den eigenen Tod in seinen verschiedenen Facetten. Es wird zwischen dem kulturellen und dem individuellen Wissen differenziert. Die Analyse des Todes selbst umfasst Aspekte wie seine Existenzialität, Unerfahrbarkeit, Gewissheit, Endgültigkeit und Unvertretbarkeit. Die Analyse verdeutlicht die Ambivalenz dieses Wissens und seiner Auswirkungen.
4 Das Subjekt des Todes: Wer stirbt?: Dieses Kapitel widmet sich der Frage nach dem Subjekt des Todes. Es untersucht die Verbindung zwischen Individualität und Tod, indem es Beckers Theorie der Individualität diskutiert und die Frage stellt, was ein Individuum ausmacht. Die Analyse der Begriffe Dasein und Person, insbesondere im Lichte der Philosophie Heideggers, ist zentral für das Verständnis des sterbenden Subjekts.
5 Der Tod als Dilemma: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Facetten, in denen das Wissen um den Tod als Dilemma wahrgenommen werden kann. Es werden existenzielle und metaphysische Aspekte des Problems erörtert, und die Theorien von Heidegger und Becker werden im Detail analysiert. Die Arbeit untersucht die Strategien der Verdrängung und Entlastung vom Todeswissen und deren Grenzen.
6 Das Wissen um den eigenen Tod als Chance: Im Gegensatz zum vorhergehenden Kapitel wird hier die Perspektive des Wissens um den eigenen Tod als Chance dargestellt. Es wird das Konzept des „eigentlichen Seins zum Tode“ nach Heidegger erörtert. Die Arbeit argumentiert, dass das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit eine positive Rolle in der Gestaltung des Lebens spielen kann.
7 Ethische Konsequenzen der Individualität: Dieses Kapitel untersucht die ethischen Implikationen, die aus dem Verständnis von Individualität und Tod resultieren. Es werden die ethischen Konsequenzen diskutiert, die sich aus dem vorherigen Kapitel ergeben.
Schlüsselwörter
Tod, Wissen, Dilemma, Chance, Existenz, Individualität, Person, Heidegger, Becker, Philosophie, Methode, Existenzialismus, Sterblichkeit, Authentizität, Sinn, Metaphysik, Ethik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Das Wissen um den eigenen Tod – Dilemma oder Chance?
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die philosophische Bedeutung des Wissens um den eigenen Tod. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob dieses Wissen ein existentielles Dilemma oder eine Chance für die Selbstfindung darstellt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: die geschichtliche und individuelle Dimension des Todeswissens, eine existenzielle und ontologische Analyse des Todesbegriffs, die Verbindung von Individualität und Tod, das Problem des Todes als existentielles und metaphysisches Dilemma, sowie die Möglichkeit, das Todeswissen als Chance für ein authentisches Leben zu verstehen. Die philosophischen Theorien von Heidegger und Becker spielen dabei eine wichtige Rolle.
Welche methodischen Herausforderungen werden in der Arbeit diskutiert?
Ein zentrales methodisches Problem ist die Unerfahrbarkeit des Todes. Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeiten, den Tod aus einer Erfahrungsperspektive zu analysieren und beleuchtet verschiedene philosophische Zugänge und deren Grenzen. Die Bedeutung einer anthropologischen Perspektive wird hervorgehoben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu Philosophie und Methode im Kontext des Todes, eine Analyse des Wissens um den eigenen Tod, ein Kapitel zum Subjekt des Todes, eine Auseinandersetzung mit dem Tod als Dilemma, die Betrachtung des Todeswissens als Chance, ein Kapitel zu den ethischen Konsequenzen der Individualität und abschließend eine Selbstreflexion.
Welche philosophischen Perspektiven werden in der Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf existenzialistische Philosophen wie Heidegger und Becker. Ihre Theorien zur Individualität, zum Dasein und zum "Sein zum Tode" werden ausführlich analysiert und im Kontext des Themas diskutiert.
Welche zentralen Begriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Tod, Wissen, Dilemma, Chance, Existenz, Individualität, Person, Heidegger, Becker, Philosophie, Methode, Existenzialismus, Sterblichkeit, Authentizität, Sinn, Metaphysik und Ethik.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht, ob das Wissen um den eigenen Tod ein Dilemma oder eine Chance darstellt. Die genauen Schlussfolgerungen lassen sich erst nach der Lektüre des vollständigen Textes ziehen, jedoch werden existentielle, metaphysische und ethische Aspekte beleuchtet und die Perspektiven von Heidegger und Becker miteinander verglichen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich philosophisch mit dem Thema Tod auseinandersetzen möchten. Sie ist insbesondere für Studenten der Philosophie, Theologie und anderer geisteswissenschaftlicher Fächer von Interesse.
Wo finde ich den vollständigen Text der Magisterarbeit?
Der vollständige Text der Magisterarbeit ist nicht öffentlich zugänglich und dient rein akademischen Zwecken. Weitere Informationen können bei der entsprechenden Universität erfragt werden.
- Citation du texte
- Olaf Dietze (Auteur), 2003, Das Wissen um den eigenen Tod: Dilemma oder Chance?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17111