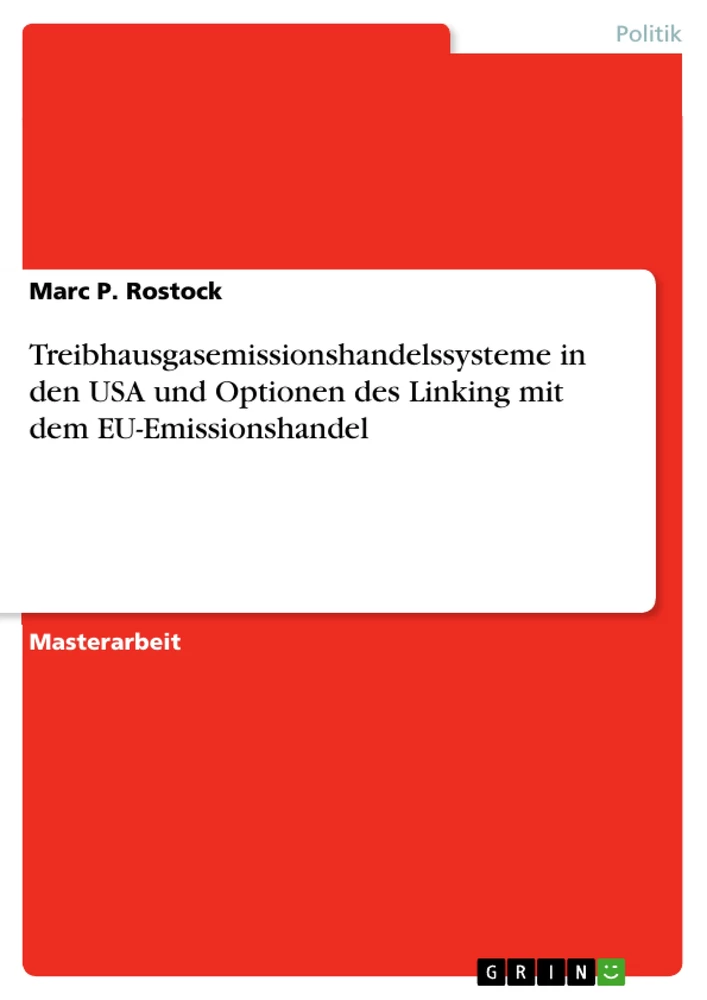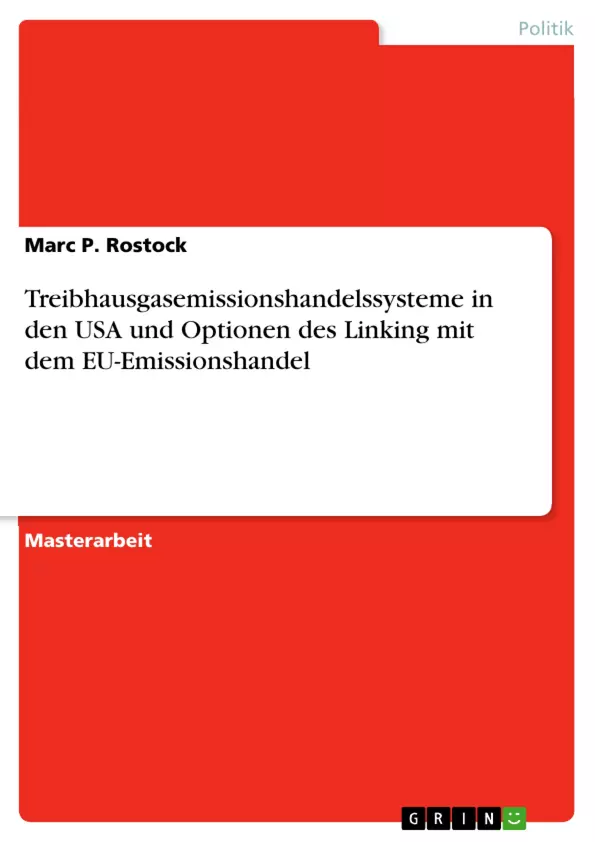Die EU Kommission gab 2009 als Ziel aus, bis 2015 die Schaffung eines OECD-weiten Marktes für CO2 erreichen zu wollen. Das Linking eines potenziellen US-amerikanischen Systems mit dem EU-Emissionshandel würde bereits einem riesigen Schritt in dieser Richtung gleichen. Schließlich sind die USA und die EU gemeinsam für nahezu 80% der Treibhausgasemissionen der OECD-Länder verantwortlich.
Der Fokus wird teils stark auf die Bundespolitik der USA gelegt und oft die mangelnden klimapolitischen Anstrengungen beklagt. Dabei wird oft übersehen, dass es innerhalb der USA eine ganze Reihe an Bundesstaaten gibt, die sich aktiv einer solchen Politik widmen. Darunter gibt es gleich drei Vorhaben für regionale Emissionshandelssysteme: Die Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI), die Western Climate Initiative (WCI) und den Midwestern Greenhouse Gas Accord (MGGA). Zwar würde eine Verbindung des europäischen Emissionshandels mit diesen nur einen Teil der Emissionen der USA abdecken, aber durchaus Symbolwirkung zeigen, wichtige Signale senden und Druck auf die Bundespolitik ausüben.
Diese Arbeit gibt einen Einblick in den Stand des Emissionshandels in den USA und Europa sowie einen Überblick über die bestehenden oder entworfenen Emissionshandelssysteme der USA. Auf dieser Basis werden anschließend realistische Optionen eines Linking von US und EU Emissionshandelssystemen ermittelt und mittels einer Kompatibilitätsanalyse die Chancen und Risiken einer solchen Verbindung
abgeschätzt. Zunächst werden als Basis für die weitere Darstellung die theoretischen Grundlagen des Zertifikatehandels erörtert und die grundsätzliche Funktions- und Wirkungsweise dargelegt. Anschließend werden die politischen Möglichkeiten, dieses theoretische Modell in die
Praxis umzusetzen, erläutert und auf Kerncharakteristika von Emissionshandelssystemen eingegangen. Kapitel 3 stellt empirische Beispiele bereits existierender oder in Planung befindlicher
Emissionshandelssysteme vor. Dazu wird ausführlich das EU Emissionshandelssystem erläutert, bevor darauf aufbauend regionale EHS
der USA vorgestellt und einer Wirkungsanalyse unterzogen werden. Außerdem wird ein Überblick über die sämtlich gescheiterten nationalen Gesetzentwürfe der letzten Jahre gegeben. Kapitel 4 widmet sich der Analyse von Optionen des Linking. Dazu werden zunächst Beweggründe für die Verbindung von EHS erläutert, bevor die Kompatibilität ausgesuchter EHS der USA mit dem europäischen Emissionshandel analysiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Klimawandel und Emissionshandel
- Ziel und Aufbau der Arbeit
- GRUNDLAGEN DES EMISSIONSZERTIFIKATEHANDELS
- Umweltökonomische Instrumente
- Ökonomische Theorie des Emissionshandels
- Funktionsweise des Zertifikatehandels
- Wirkungsanalyse des Zertifikatehandels
- Ökonomische Effizienz
- Dynamische Anreiz- und Innovationswirkung
- Ökologische Treffsicherheit
- Politische Umsetzung des Emissionshandels
- Ökonomische Theorie versus politische Realität
- Aufbau und Charakteristika realer Emissionshandelssysteme
- Rahmenbedingungen, Abdeckung von Gasen und Sektoren
- Festlegung und Höhe des Cap
- Methode der Allokation
- Umgang mit Stilllegung und neuen Marktteilnehmern
- Temporale Dimension: Perioden, Banking und Borrowing
- Anerkennung von Zertifikaten und Typen des Offsetting
- Register, Berichtswesen, Überwachung und Sanktionierung
- Kostenbeschränkungsmechanismen
- EMISSIONSHANDELSSYSTEME IN DER PRAXIS
- Das Kyoto Protokoll
- Historie und grundsätzliche Regelungen
- Flexible Mechanismen des Kyoto-Protokolls
- Emissionshandel
- Joint Implementation (JI)
- Der Clean Development Mechanism (CDM)
- European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS)
- Aufbau und Charakteristika
- Rahmenbedingungen, Abdeckung von Gasen und Sektoren
- Festlegung und Höhe des Cap
- Methode der Allokation
- Umgang mit Stilllegung und neuen Marktteilnehmern
- Temporale Dimension: Perioden, Banking und Borrowing
- Anerkennung von Zertifikaten und Typen des Offsetting
- Register, Berichtswesen, Überwachung und Sanktionierung
- Kostenbeschränkungsmechanismen
- Wirkungsanalyse
- Ökologische Treffsicherheit
- Ökonomische Effizienz
- Dynamische Innovationswirkung
- Fazit
- Regionale Emissionshandelssysteme der USA
- Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI)
- Aufbau und Charakteristika
- Wirkungsanalyse
- Western Climate Initiative (WCI)
- Aufbau und Charakteristika
- Wirkungsabschätzung
- Midwestern Greenhouse Gas Reduction Accord (MGGA)
- Aufbau und Charakteristika
- Wirkungsabschätzung
- Nationale Emissionshandelssysteme der USA
- Cap-and-Trade Gesetzgebung im US-Kongress
- Grundlagen des legislativen Prozesses der USA
- Gesetzentwürfe im 110. Kongress (2007-2008)
- Gesetzentwürfe im 111. Kongress (2009-2010)
- Aktuelle Umsetzungschancen eines nationalen Emissionshandels
- Funktionsweise und Wirkungsweise von Emissionshandelssystemen
- Bewertung verschiedener Emissionshandelssysteme in den USA und der EU
- Potenziale und Herausforderungen einer Verknüpfung von US-amerikanischen und europäischen Emissionshandelssystemen
- Politische und wirtschaftliche Auswirkungen von Emissionshandelssystemen
- Ökologische Effizienz und Innovationsförderung durch Emissionshandel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt den Klimawandel und die Notwendigkeit von Emissionshandelssystemen als wichtiges Instrument zur Reduktion von Treibhausgasen dar. Die Arbeit fokussiert auf die Analyse von Treibhausgasemissionshandelssystemen in den USA und den Optionen einer Verknüpfung mit dem EU-Emissionshandelssystem.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis von Emissionshandelssystemen. Es beleuchtet die Funktionsweise und Wirkungsanalyse des Zertifikatehandels sowie die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen bei der Umsetzung in der Praxis.
- Kapitel 3: In diesem Kapitel werden verschiedene Emissionshandelssysteme in der Praxis analysiert. Es werden sowohl das Kyoto Protokoll, das EU ETS, als auch regionale und nationale Emissionshandelssysteme in den USA beleuchtet und ihre jeweiligen Besonderheiten und Wirkungsweisen erläutert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht Treibhausgasemissionshandelssysteme in den USA mit einem Fokus auf Optionen für eine Verknüpfung mit dem EU-Emissionshandelssystem. Die Arbeit analysiert die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von Emissionshandelssystemen und evaluiert die Effizienz und ökologische Treffsicherheit verschiedener Modelle.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Emissionshandel, Treibhausgasemissionen, Klimaschutz, Umweltökonomie, Kyoto Protokoll, EU ETS, USA, regionale Emissionshandelssysteme, nationale Emissionshandelssysteme, Linking, Verknüpfung, Politische Ökonomie, Effizienz, Treffsicherheit, Innovation, Marktmechanismen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des "Linking" von Emissionshandelssystemen?
Das Ziel ist die Schaffung eines größeren, effizienteren Marktes für CO2-Zertifikate, um die Kosten der Emissionsvermeidung global zu senken.
Welche regionalen Handelssysteme gibt es in den USA?
Bekannte Initiativen sind die RGGI (Nordosten), die Western Climate Initiative (WCI) und der Midwestern Greenhouse Gas Accord (MGGA).
Wie funktioniert der Zertifikatehandel grundsätzlich?
Es wird eine Obergrenze (Cap) für Emissionen festgelegt. Unternehmen benötigen für jede ausgestoßene Tonne CO2 ein Zertifikat, das sie am Markt handeln können (Trade).
Was ist das EU ETS?
Das European Union Emissions Trading Scheme ist das weltweit erste und größte System zur Begrenzung von Treibhausgasemissionen.
Welche Risiken birgt die Verknüpfung von EU- und US-Systemen?
Herausforderungen liegen in der Kompatibilität der Regeln, z.B. bei der Anerkennung von Offsets, Preisobergrenzen und Sanktionsmechanismen.
- Citar trabajo
- Marc P. Rostock (Autor), 2010, Treibhausgasemissionshandelssysteme in den USA und Optionen des Linking mit dem EU-Emissionshandel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171157