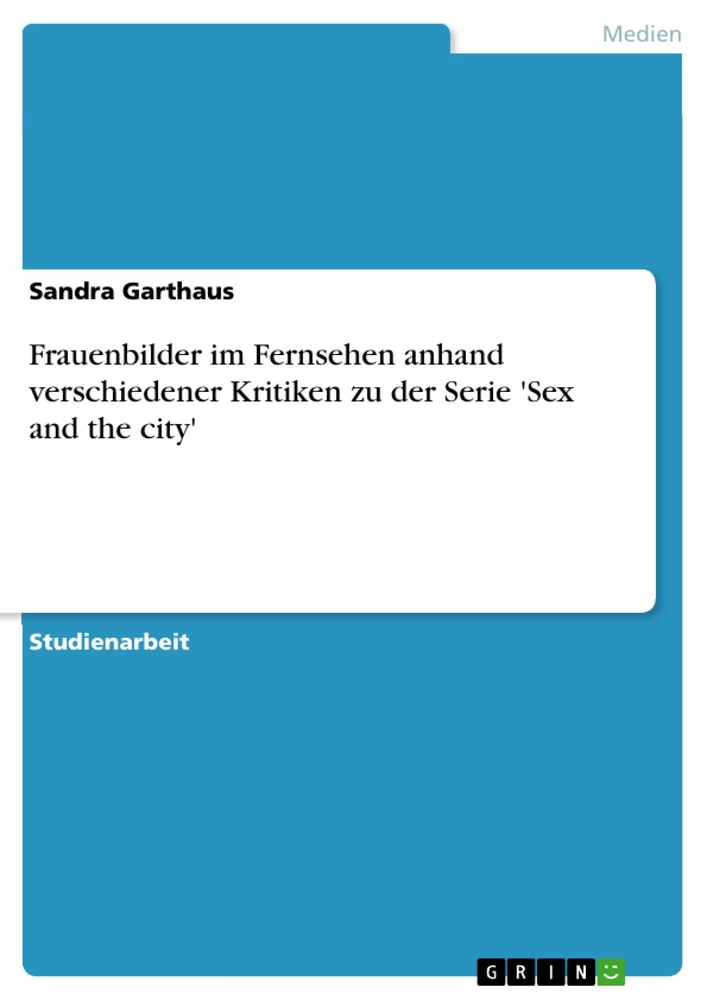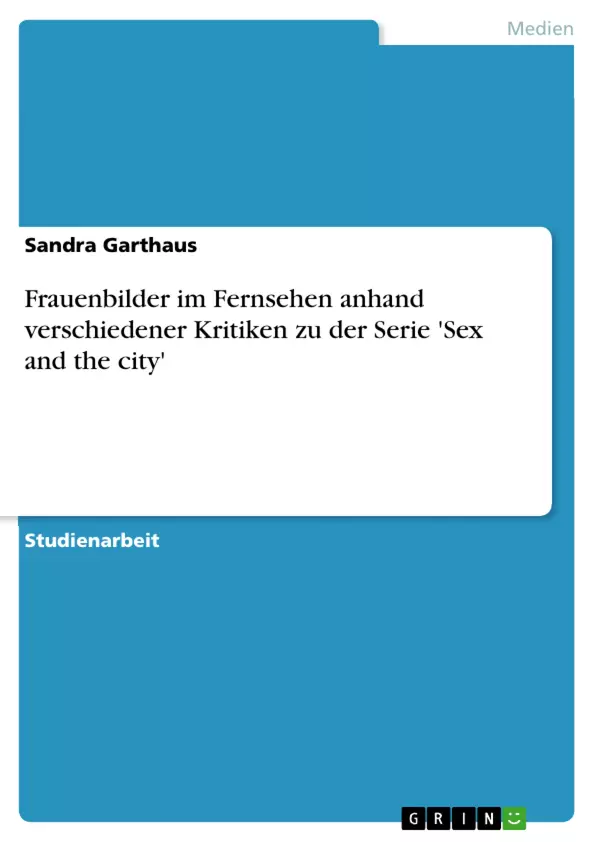Täglich werden Menschen durch die Massenmedien mit unterschiedlichen Medienbildern von Frauen und Männern konfrontiert. Darstellungen, die bestimmte Klischees oder Stereotypen aufzeigen, werden durch Medien konstruiert und an die Konsumenten und Konsumentinnen vermittelt. Sie dienen als Leitbilder und Identifikationsmuster, die die Zuschauer verinnerlichen. Sie prägen die Menschen und präsentieren Ideale, an die wir uns anpassen. Dies geschieht eher unbewusst bei der Rezeption.
Ich konzentriere mich in meiner Arbeit auf das Frauenbild im Fernsehen und untersuche es anhand der Filmkritiken zu der erfolgreichen us-amerikanischen Fernsehserie „Sex and the City“.
Das Bild der Frau, das in den verschiedenen Filmen und Serien präsentiert wird, beruht meist auf den Vorstellungen des Mannes von einer Frau, wie auch bei „Sex and the City“. Diese Tatsache beruht darauf, dass in Medienbetrieben Männer die höheren Positionen besetzen und dadurch die Frauen aus ihrer Sicht darstellen (vgl. Mühlen Achs, G. 1995, 15). Zudem orientierten sich die Frauen immer an einer androzentrischen Weltordnung, das heißt auf eine männlich fixierte Weltordnung (vgl. Mühlen Achs, G. 17).
Ich möchte mit meiner Arbeit herausstellen, was für ein Frauenbild die Serie „Sex and the City“ vermittelt, inwiefern es sich von traditionellen Mustern und Klischees unterscheidet und wieso die Serie bei Frauen so beliebt ist. Hierfür werde ich zunächst Informationen zu der Serie zusammenfassen und die vier Hauptprotagonistinnen kurz charakterisieren. Weiter werde ich die thematischen Schwerpunkte der Kritiken erläutern und mich dann mit den Kritiken auseinandersetzen. Erst werde ich die Inhalte der einzelnen Kritiken wiedergeben und untersuchen, ob die Zeitungen sich in ihren Kritiken unterscheiden. Im Anschluss werde ich darauf eingehen, inwiefern sich die Kritiker und die Kritikerinnen in ihren Auseinandersetzungen differenzieren. In meiner Schlussbetrachtung möchte ich schließlich die Frage beantworten, was für ein Frauenbild „Sex and the City“ kreiert, wo die Unterschiede zu dem konventionellen Frauenbild liegen und warum dieses beim weiblichen Geschlecht so viel Anklang findet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Materialbasis und methodisches Vorgehen
- Frauenbilder im Fernsehen
- Die Serie „Sex & the city“
- Figurencharakterisierung
- Thematische Schwerpunkte der Kritiken
- Reden über Sex
- Mode und Männer
- Unabhängige Frauen
- Analytische Betrachtung der Kritiken
- Kritiken der unterschiedlichen Zeitungen
- Unterschiede in der geschlechtsspezifischen Auseinandersetzung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Frauenbild in der Fernsehserie „Sex and the City“ anhand von Filmkritiken. Ziel ist es, das von der Serie vermittelte Frauenbild zu beschreiben, seine Unterschiede zu traditionellen Frauenbildern herauszustellen und die Popularität der Serie bei Frauen zu erklären.
- Das Frauenbild in „Sex and the City“ im Vergleich zu konventionellen Vorstellungen
- Analyse der thematischen Schwerpunkte in den Kritiken zu „Sex and the City“
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Rezeption und Kritik der Serie
- Die Darstellung von weiblicher Unabhängigkeit und Sexualität
- Der Einfluss von Medienbildern auf die Identifikation und die Selbstwahrnehmung von Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Frauenbilder im Fernsehen ein und beschreibt den Forschungsfokus der Arbeit: die Analyse des Frauenbildes in der Serie „Sex and the City“ anhand von Kritiken. Es wird die Problematik der Medienkonstruktionen von Geschlechterrollen angesprochen und die Forschungsfrage formuliert: Wie präsentiert die Serie das Frauenbild, wie unterscheidet es sich von traditionellen Mustern, und warum ist die Serie bei Frauen so beliebt? Die Autorin skizziert ihre Vorgehensweise, die die Charakterisierung der Hauptfiguren, die Analyse der thematischen Schwerpunkte in den Kritiken und den Vergleich verschiedener Kritiken umfasst.
Materialbasis und methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit. Die Autorin erläutert die Auswahl der untersuchten Kritiken aus verschiedenen Zeitungen (TAZ, FAZ, Welt, BZ, SZ, Die Zeit, Heise online) aus den Jahren 2001 und 2004, also der Ausstrahlungszeit der Serie in Deutschland. Sie beschreibt die Einbeziehung weiterer Literatur zur traditionellen Darstellung von Frauen im Fernsehen, um einen Vergleich zu ermöglichen. Die Autorin skizziert ihren Arbeitsprozess, der die Recherche, die Textanalyse, die Erstellung von Exzerpten und die schrittweise Verfassung der Arbeit umfasst.
Frauenbilder im Fernsehen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die historische Entwicklung von Frauenbildern im Fernsehen. Es werden die traditionellen, stereotypen Darstellungen von Frauen als abhängig, emotional und im Beruf untergeordnet im Vergleich zu den starken, unabhängigen männlichen Figuren beschrieben. Der Wandel in den 90er Jahren hin zu selbstbewussteren Frauenfiguren wird erwähnt, wobei betont wird, dass traditionelle Bilder weiterhin existieren. Der Abschnitt dient als Kontextualisierung für die anschließende Analyse von „Sex and the City“.
Die Serie „Sex and the City“: Hier wird die Serie „Sex and the City“ kurz vorgestellt: ihre Entstehung basierend auf Candace Bushnells Kolumne und Buch, ihre Produktion durch Darren Star und ihre Popularität in den USA und Deutschland. Die zentralen Handlungselemente, die vier Hauptfiguren und ihr Leben als erfolgreiche, aber unverheiratete Frauen in Manhattan werden kurz angerissen. Dieser Abschnitt legt die Grundlage für die detailliertere Analyse der Figuren und der Kritiken im weiteren Verlauf der Arbeit.
Schlüsselwörter
Frauenbild, Fernsehen, Sex and the City, Medienanalyse, Filmkritik, Geschlechterrollen, Stereotypen, Klischees, Unabhängigkeit, Sexualität, traditionelle Frauenbilder, Medienrezeption.
Häufig gestellte Fragen zu "Frauenbilder in der Fernsehserie „Sex and the City“"
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit analysiert das Frauenbild in der Fernsehserie „Sex and the City“, indem sie Filmkritiken aus verschiedenen deutschen Zeitungen (TAZ, FAZ, Welt, BZ, SZ, Die Zeit, Heise online) aus den Jahren 2001 und 2004 untersucht. Ziel ist es, das von der Serie vermittelte Frauenbild zu beschreiben, es mit traditionellen Frauenbildern zu vergleichen und die Popularität der Serie bei Frauen zu erklären.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Inhaltsanalyse von Filmkritiken. Die Autorin beschreibt ihre Methodik detailliert, inklusive der Auswahl der Kritiken, der Einbeziehung weiterer Literatur zu traditionellen Frauenbildern im Fernsehen und ihres Arbeitsprozesses (Recherche, Textanalyse, Exzerpieren etc.).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Das Frauenbild in „Sex and the City“ im Vergleich zu konventionellen Vorstellungen; die Analyse der thematischen Schwerpunkte in den Kritiken; geschlechtsspezifische Unterschiede in der Rezeption und Kritik der Serie; die Darstellung von weiblicher Unabhängigkeit und Sexualität; und der Einfluss von Medienbildern auf die Identifikation und Selbstwahrnehmung von Frauen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Materialbasis und methodisches Vorgehen, Frauenbilder im Fernsehen, Die Serie „Sex and the City“, Thematische Schwerpunkte der Kritiken, Analytische Betrachtung der Kritiken und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Rolle spielt die Serie „Sex and the City“ in der Arbeit?
„Sex and the City“ ist der zentrale Gegenstand der Analyse. Die Arbeit untersucht, wie die Serie Frauen darstellt, welche Aspekte in den Kritiken hervorgehoben werden und wie diese Darstellungen mit traditionellen Frauenbildern verglichen werden können. Die Popularität der Serie bei Frauen wird ebenfalls thematisiert.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf Filmkritiken aus verschiedenen deutschen Zeitungen (TAZ, FAZ, Welt, BZ, SZ, Die Zeit, Heise online) aus den Jahren 2001 und 2004 sowie auf weiterer Literatur zur Darstellung von Frauen im Fernsehen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden in der Schlussbetrachtung zusammengefasst. Es wird auf die Ergebnisse der Analyse des Frauenbildes in "Sex and the City" und deren Kontextualisierung im Vergleich zu traditionellen Frauenbildern eingegangen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frauenbild, Fernsehen, Sex and the City, Medienanalyse, Filmkritik, Geschlechterrollen, Stereotypen, Klischees, Unabhängigkeit, Sexualität, traditionelle Frauenbilder, Medienrezeption.
- Citar trabajo
- Sandra Garthaus (Autor), 2006, Frauenbilder im Fernsehen anhand verschiedener Kritiken zu der Serie 'Sex and the city', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171328