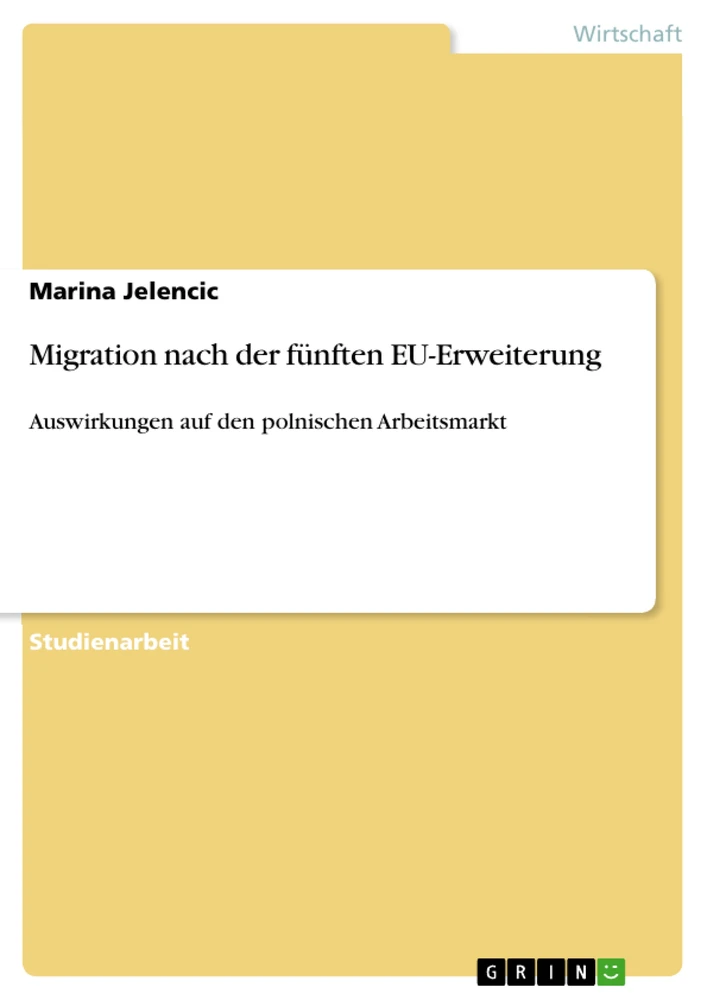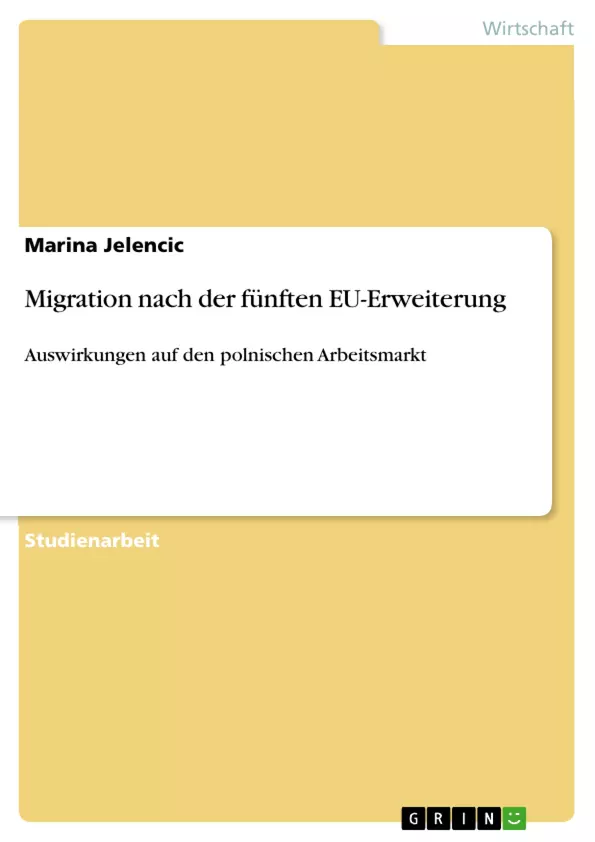Am 13. Dezember 2002 wurde die Entscheidung beim Gipfeltreffen in Kopenhagen endgültig getroffen. Die Zahl der EU-Länder sollte sich am 1. Mai 2004 fast verdoppeln, von fünfzehn auf fünfundzwanzig. An diesem Tag wurden zehn neue Mitglieder in die Europäische Union aufgenommen. Mit der Aufnahme von Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern ist EU-Bevölkerung somit um rund 74 Millionen Menschen angewachsen.
Diese so genannte Osterweiterung war für alle beteiligten Länder eine beträchtliche Herausforderung. Erstens wurden noch nie zuvor so viele Länder gleichzeitig in die EU aufgenommen. Zweitens waren noch nie zuvor die Unterschiede zwischen den beitretenden Staaten und den bisherigen EU-Mitgliedern, sowie die Unterschiede innerhalb der Gruppe der neuen Mitgliedsländer so groß. Vor allem gab es große Diskrepanzen hinsichtlich des Lebensstandards und der Wirtschaftskraft.
Aufgrund dieser Unterschiede und vor allem auch aufgrund der großen Fläche gab es nicht nur positive Erwartungshaltungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die fünfte EU - Erweiterungsrunde
- a. Artikel 39 EGV
- b. Die Übergangsregelung: Die „2+3+2 Richtlinie”
- 3. Modelle zur Migration
- a. Begriffserklärung: Migration
- b. Die Mikroökonomische Migrationstheorie
- c. Die Neue Ökonomie der Arbeitsmigration
- 4. Auswirkungen auf den polnischen Arbeitsmarkt
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der fünften EU-Erweiterung auf den polnischen Arbeitsmarkt, insbesondere in Bezug auf die Migration von Arbeitskräften. Die Arbeit befasst sich mit den Rahmenbedingungen der EU-Erweiterung, den rechtlichen Grundlagen der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der Bedeutung dieser Entwicklungen für die Arbeitskräfte. Die Analyse stützt sich auf zwei ausgewählte Theorien zur Migration von Arbeitskräften, um die Auswirkungen auf den polnischen Arbeitsmarkt zu beleuchten.
- Die Auswirkungen der fünften EU-Erweiterung auf den polnischen Arbeitsmarkt
- Die Rolle der Arbeitnehmerfreizügigkeit im Kontext der EU-Erweiterung
- Die Anwendung mikroökonomischer Theorien auf die Arbeitsmigration
- Die Analyse der Auswirkungen der Migration auf den polnischen Arbeitsmarkt anhand ausgewählter Theorien
- Die Bedeutung der EU-Erweiterung für die Arbeitskräfte in Polen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung liefert eine kurze Einführung in die fünfte EU-Erweiterung und deren Bedeutung für die Arbeitskräfte. Sie stellt den Fokus der Arbeit auf die Migration von Arbeitskräften im Zuge der Erweiterung dar.
- Kapitel 2: Die fünfte EU - Erweiterungsrunde: Dieses Kapitel beleuchtet die fünfte EU-Erweiterungsrunde und ihre Hintergründe. Es untersucht die Bedeutung der Erweiterung für die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Raumes und die Kritikpunkte, die mit der Größe der Erweiterung verbunden waren. Darüber hinaus werden die Befürchtungen bezüglich Einwanderungswellen und Arbeitsplatzverlusten in den westlichen Mitgliedsstaaten diskutiert.
- Kapitel 3: Modelle zur Migration: In diesem Kapitel werden verschiedene Modelle zur Migration von Arbeitskräften vorgestellt. Neben einer Definition des Begriffs "Migration" werden die Mikroökonomische Migrationstheorie und die Neue Ökonomie der Arbeitsmigration erläutert.
- Kapitel 4: Auswirkungen auf den polnischen Arbeitsmarkt: Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen der fünften EU-Erweiterung auf den polnischen Arbeitsmarkt. Anhand der zuvor genannten Theorien werden die Auswirkungen der Migration auf den Arbeitsmarkt in Polen analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der EU-Erweiterung, der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der Auswirkungen der Migration auf den polnischen Arbeitsmarkt. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: EU-Erweiterung, Osterweiterung, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Artikel 39 EGV, Übergangsregelung, Mikroökonomische Migrationstheorie, Neue Ökonomie der Arbeitsmigration, polnischer Arbeitsmarkt.
Häufig gestellte Fragen
Wann fand die fünfte EU-Erweiterungsrunde statt?
Die Entscheidung fiel im Dezember 2002, und der offizielle Beitritt der zehn neuen Mitgliedsländer erfolgte am 1. Mai 2004.
Welche Länder traten der EU bei der Osterweiterung bei?
Es traten Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern bei.
Was regelt die „2+3+2 Richtlinie“?
Dies war eine Übergangsregelung zur Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit, um plötzliche Einwanderungswellen in die alten EU-Staaten zu verhindern.
Welche Migrationstheorien werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit erläutert die Mikroökonomische Migrationstheorie und die Neue Ökonomie der Arbeitsmigration.
Wie wirkte sich die Erweiterung auf den polnischen Arbeitsmarkt aus?
Die Arbeit analysiert die Migrationsbewegungen polnischer Arbeitskräfte und deren Folgen für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in Polen.
- Citation du texte
- Marina Jelencic (Auteur), 2010, Migration nach der fünften EU-Erweiterung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171363