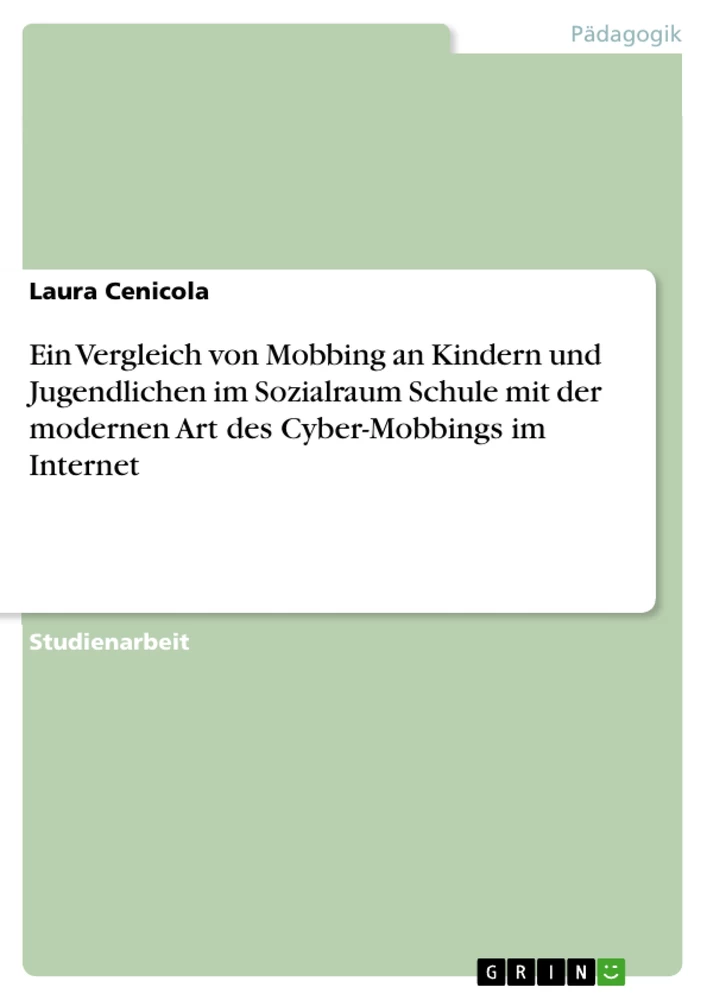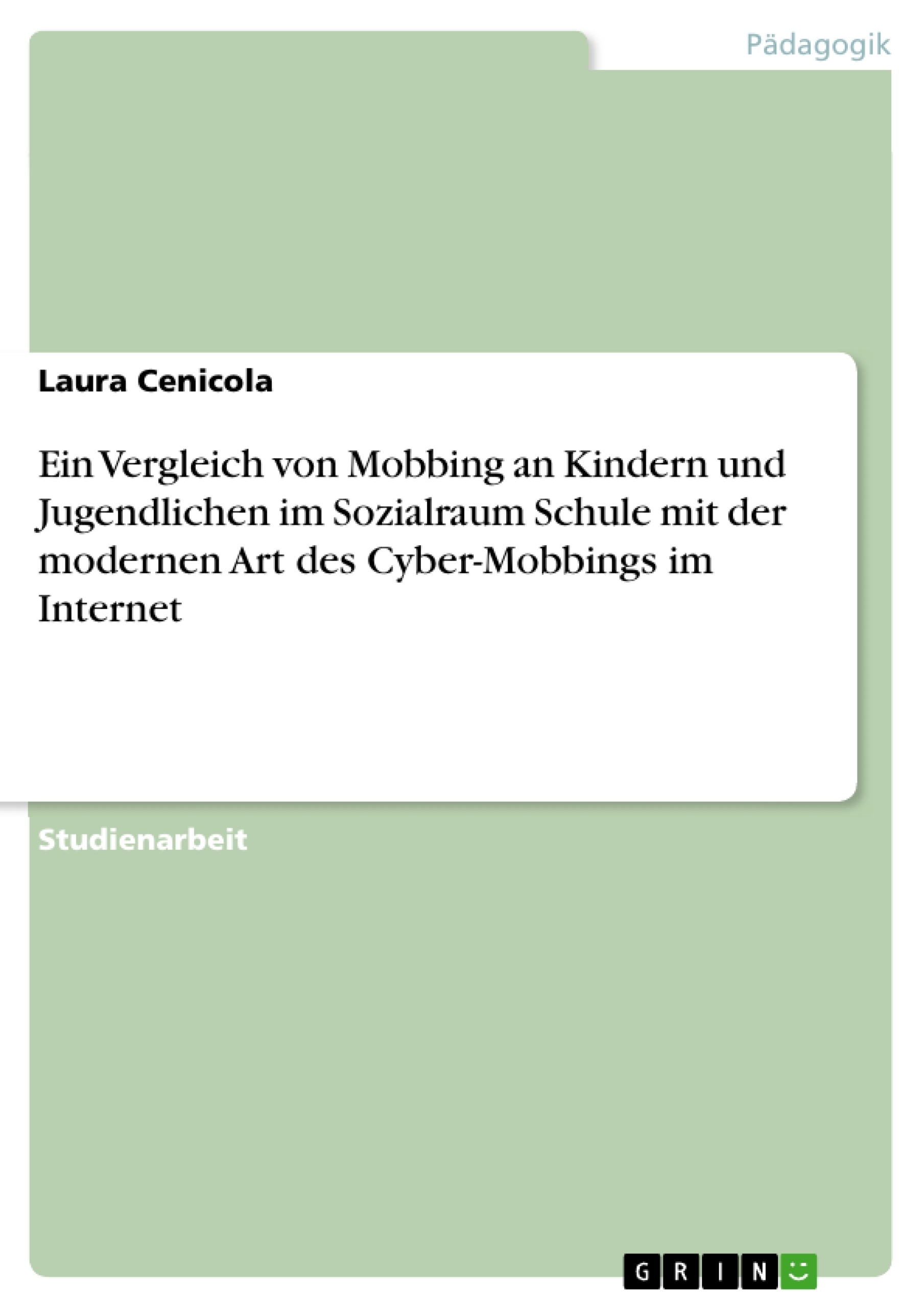„Jedes Jahr unternehmen in Deutschland 30.000 Kinder und Jugendliche einen Suizidversuch. 1.000 dieser Versuche enden tödlich.“ (Gebauer 2007, S.90). Ein häufig angegebenes Motiv dafür sind regelmäßige Demütigungen, Beschimpfungen und verschiedenartige Ausübungen von Gewalt durch andere Personen – kurz: Mobbing.
Mobbing hat es schon immer gegeben. Seit etwa zwei Jahrzehnten nimmt die Problematik in der Schule allerdings dramatisch zu, denn LehrerInnen und Eltern berichten immer häufiger von ernsten Vorfällen, welche starke psychische und zum Teil auch physische Probleme nach sich ziehen. Es ist normal, dass die SchülerInnen in der Schule ihre Grenzen ausloten und in verschiedene Rollen schlüpfen, aber dass Mobbing nun ein fester Bestandteil der alltäglichen Schulrealität widerspiegelt (vgl. Scheithauer et al. 2003, S.90) scheint nicht akzeptabel zu sein.
Eine weitere Art von Mobbing hat sich zusätzlich zum klassischen, immer noch existenten Mobbing in der Schule herauskristallisiert: Das moderne Cyber-Mobbing ist eine andere Art der Peer-Schikanierung (siehe Eingangs-Beispiel oben). Über moderne Medien wie das Internet oder das Handy drangsalieren sich Kinder und Jugendliche heutzutage oftmals bis aufs Äußerste und sind sich der Auswirkungen kaum bewusst.
Die beiden sozialen Phänomene Mobbing und Cyber-Mobbing sollen in der vorliegenden Arbeit unter ausgewählten Gesichtspunkten erklärt und verglichen werden. Vor allem wurde Mobbing bisher von der psychologischen Forschung untersucht (vgl. Wachs 2009, S.5), doch diese Arbeit beschäftigt sich aus erziehungswissenschaftlicher Sicht mit dem Phänomen Mobbing. Die ersten systematischen Forschungen zum Thema Mobbing wurden vor etwa 30 Jahren durch Olweus durchgeführt (vgl. Scheithauer et al. 2003, S.14) und gelten bis heute als wichtigste Vorlagen für kommende Forschungen auf dem Gebiet.
- Quote paper
- Laura Cenicola (Author), 2010, Ein Vergleich von Mobbing an Kindern und Jugendlichen im Sozialraum Schule mit der modernen Art des Cyber-Mobbings im Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171370