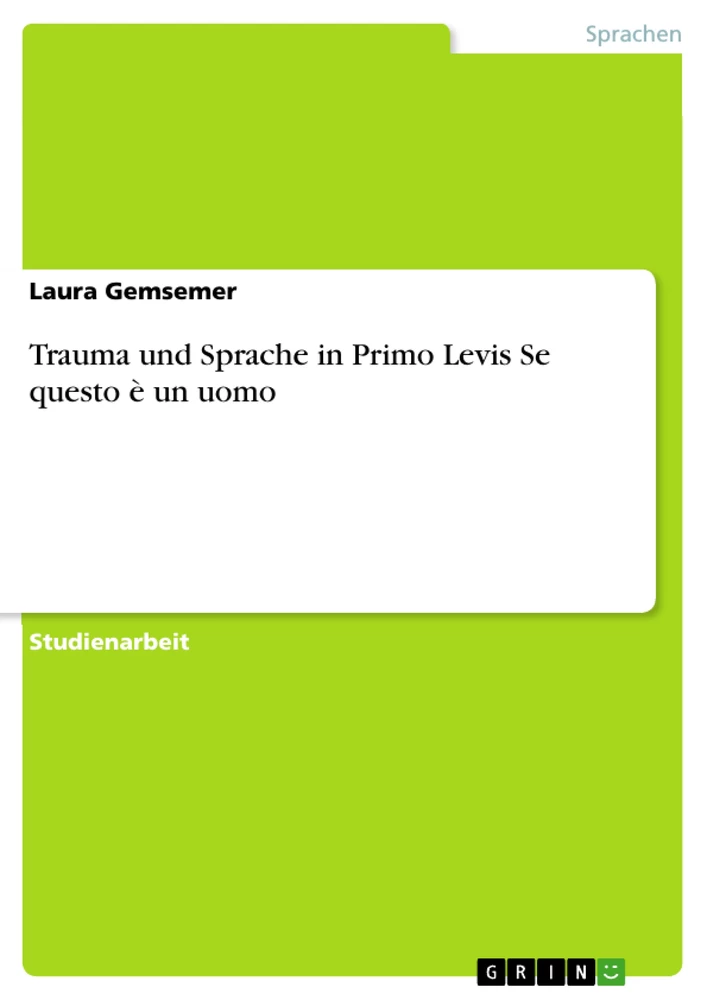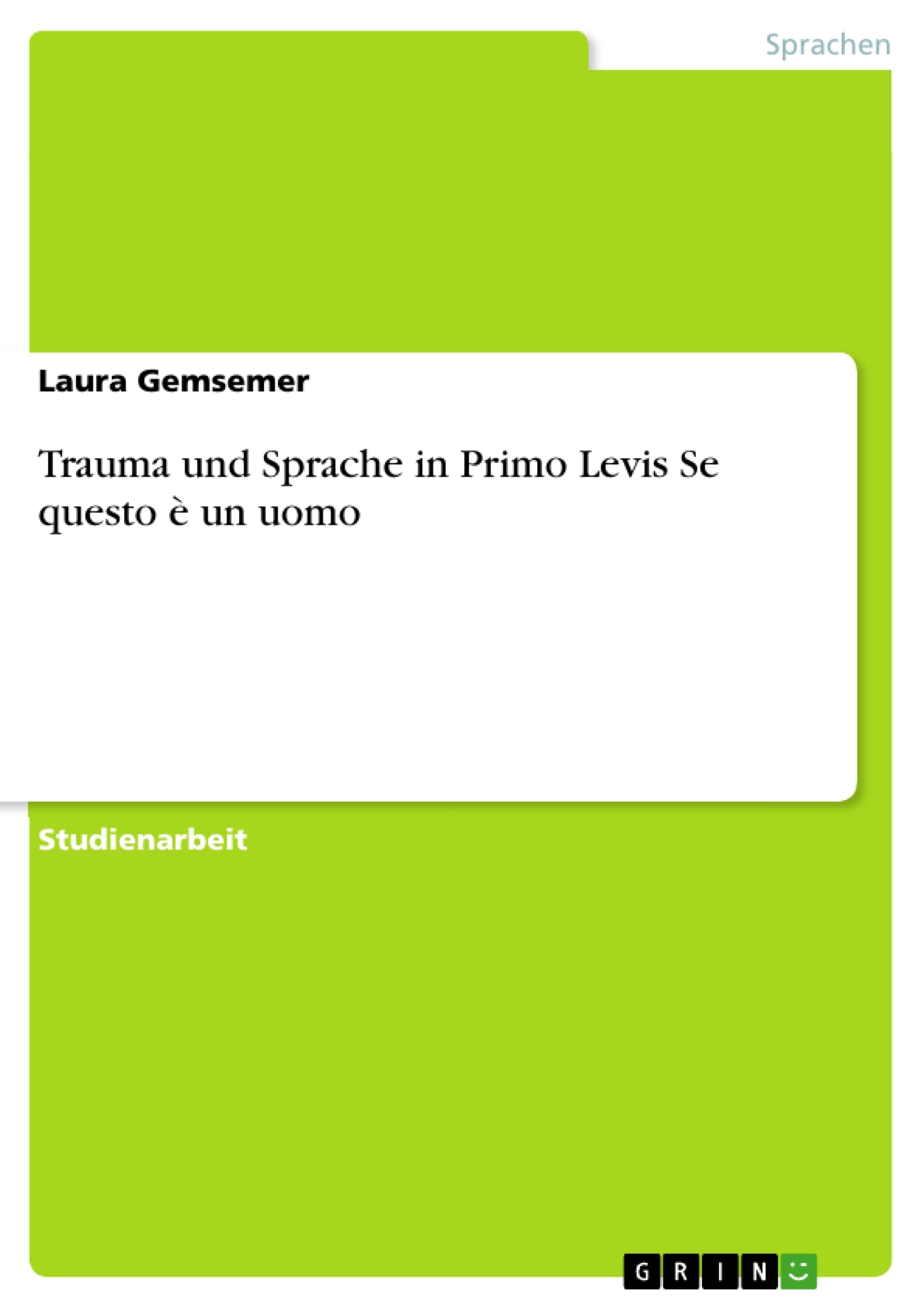>>Da ist keine Sprache, da sind keine Worte, mit deren Hilfe Du das Unsagbare sagen, das
Unbegreifliche erklären könntest. Kein Sprachgewand, das über das Skelett Deiner
Erfahrungen geworfen werden könnte. Keine Buchstaben für den Schrei. […] und
solltest du auch mit Engels- und Teufelszungen reden, es würde kaum nützen, […] die
Menschen wollen nicht hören.1<<
Im Februar 1944 wird Primo Levi nach Auschwitz deportiert. Erst im Herbst
1945, nach dem die Überlebenden des bereits zerbombten Lagers von den Russen
befreit werden, kann er die Heimkehr nach Italien antreten. Sein Drang das
Erlebte aufzuschreiben und zu bezeugen, ist so stark, dass er sogar auf den
Rückseiten von Zugtickets oder Papierschnipseln Erinnerungsblitze notiert.2
Innerhalb von zehn Monaten verleiht Primo Levi dem Schrecken seiner KZErfahrungen
Ausdruck in Se questo è un uomo.3 Dass die Erstausgabe nach
langem Hin und Her den Titel Shemà, was dem Hebräischen für Ascolta!
entspricht und Teil des hebräischen Glaubensbekenntnis ist4, erhalten hat5,
symbolisiert bereits den Kernpunkt der hier zu besprechenden Thematik, denn
dieser Titel zeigt, ebenso wie der bereits erwähnte Drang zu schreiben, einen
wichtigen Aspekt der KZ-Erfahrung auf: Traumatische Erfahrungen drängen
darauf, erzählt zu werden, denn nur im Akt der narrativen Wiedergabe, die
ihrerseits einen Zuhörer bzw. einen Leser voraussetzt, kann das Erlebte in die
narrative Erinnerungsstruktur integriert werden und damit auch gleichzeitig eine
Erinnerungskultur begründen. Dies wiederum stellt die Grundvoraussetzung dar,
die es benötigt, um traumatische Erlebnisse zu verarbeiten. Es ist also die
Selbstheilungsfähigkeit des Organismus, welcher den Erzähldrang begründet.
==
1 Edvardson, Cordelia, Für Primo Levi, S. 369-373, in: Levi, Primo, Ist das ein Mensch? Carl Hanser Verlag,
München und Wien, 1988, S. 369.
2 Thomson, Ian, Writing If This Is a Man, S. 141- 160, in: Farrell, Joseph (Hg.), Primo Levi, Peter Lang, Oxford,
Bern, u.a., 2004, S. 142.
3 1947 erstmals bei De Silva unter der Herausgabe Franco Antonicellis erschienen.
4 In Levis einleitendem Gedicht Se questo è un uomo wird das hebräische Shemà intertextuell aufgerufen.
5 Vgl. De Luca, Vania, Tra Giobbe e i buchi neri, Istituto Grafico Editoriale Italiano, Neapel, 1991, S. 18.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachverlust und Trauma
- Annullierung des Menschen
- Entleerung der Wörter
- Schweigende Leerstellen
- Trauma als sprachloser Schrecken
- Sprachfindung und Trauma
- Die Form
- Das Kollektiv - Distanzierung und Trauma
- Traumatische Zeitgefüge
- Gegenwärtigkeit
- Chronologie
- Intertextualität
- Babylonische Sprachverwirrung
- Danteske Hölle
- In der Tiefe
- Il Canto di Ulisse
- Der Drang zu erzählen
- Abschließende Betrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die komplexe Beziehung zwischen Trauma und Sprache im Kontext von Primo Levis autobiografischem Bericht "Se questo è un uomo". Der Fokus liegt auf der Frage, wie Sprache als Mittel der Verarbeitung und Bewältigung traumatischer Erfahrungen fungieren kann, insbesondere im Angesicht der Sprachlosigkeit, die durch die brutale Realität des Konzentrationslagers Auschwitz hervorgerufen wird.
- Sprachverlust als Ausdruck der Entmenschlichung und Vernichtung
- Die Suche nach einer Sprache, die das Unfassbare beschreiben kann
- Die Rolle des Kollektivs in der Bewältigung des Traumas
- Die Bedeutung der Intertextualität als Mittel der Distanzierung und Verarbeitung
- Die narrative Struktur des Berichts als Ausdruck der Dissoziation und des Versuchs, dem Trauma eine Form zu geben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet den Drang von Primo Levi, seine Erlebnisse in Auschwitz zu erzählen. Dabei wird die Bedeutung der narrativen Wiedergabe als Mittel der Verarbeitung und Integration traumatischer Erfahrungen hervorgehoben.
Das erste Kapitel widmet sich dem Sprachverlust, der durch die traumatischen Erfahrungen im Konzentrationslager entsteht. Es werden verschiedene Aspekte des Sprachverlusts beleuchtet, wie die Annullierung des Menschen, die Entleerung der Wörter und die Entstehung von sprachlosen Leerstellen.
Das zweite Kapitel untersucht die Suche nach einer Sprache, die das Unfassbare beschreiben kann. Es werden verschiedene literarische Verfahren analysiert, die Levi in seinem Bericht einsetzt, um das Trauma zu bewältigen, darunter die Verwendung des Kollektivs, die Intertextualität und die Poetik der Dissoziation.
Schlüsselwörter
Trauma, Sprache, Sprachlosigkeit, Holocaust, Auschwitz, Primo Levi, "Se questo è un uomo", Intertextualität, Dissoziation, Kollektiv, narrative Wiedergabe, Erinnerungskultur, biographische Zeugenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Untersuchung von Primo Levis Werk?
Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Trauma und Sprache in Primo Levis Bericht „Se questo è un uomo“ (Ist das ein Mensch?).
Was bedeutet der ursprüngliche Titel „Shemà“?
„Shemà“ ist Hebräisch für „Höre!“ oder „Listen!“. Es verweist auf die Pflicht des Zeugnisabflegens und den Drang, gehört zu werden.
Warum ist das Erzählen für Trauma-Überlebende so wichtig?
Durch die narrative Wiedergabe kann das Erlebte in die Erinnerungsstruktur integriert werden, was eine Grundvoraussetzung für die Verarbeitung des Traumas ist.
Was versteht Levi unter der „Entleerung der Wörter“?
Es beschreibt den Sprachverlust im KZ, wo herkömmliche Begriffe (wie Hunger oder Kälte) ihre normale Bedeutung verloren, da die Realität des Lagers jenseits der normalen Sprache lag.
Welche Rolle spielt Intertextualität in Levis Bericht?
Levi nutzt literarische Bezüge, etwa zu Dantes „Göttlicher Komödie“, um Distanz zum Erlebten zu schaffen und das Unfassbare in einen kulturellen Kontext einzuordnen.
Was wird im Kapitel „Babylonische Sprachverwirrung“ thematisiert?
Es behandelt die Vielzahl der Sprachen im Lager, die die Kommunikation erschwerten und zur Isolation und Entmenschlichung der Häftlinge beitrugen.
- Quote paper
- Laura Gemsemer (Author), 2010, Trauma und Sprache in Primo Levis Se questo è un uomo, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171400