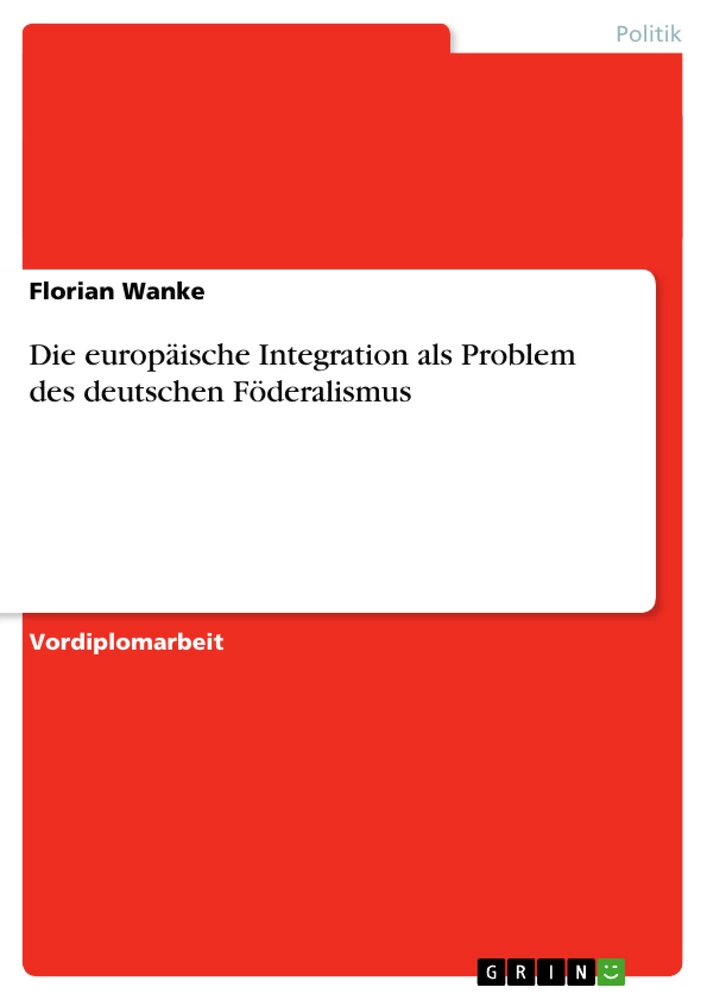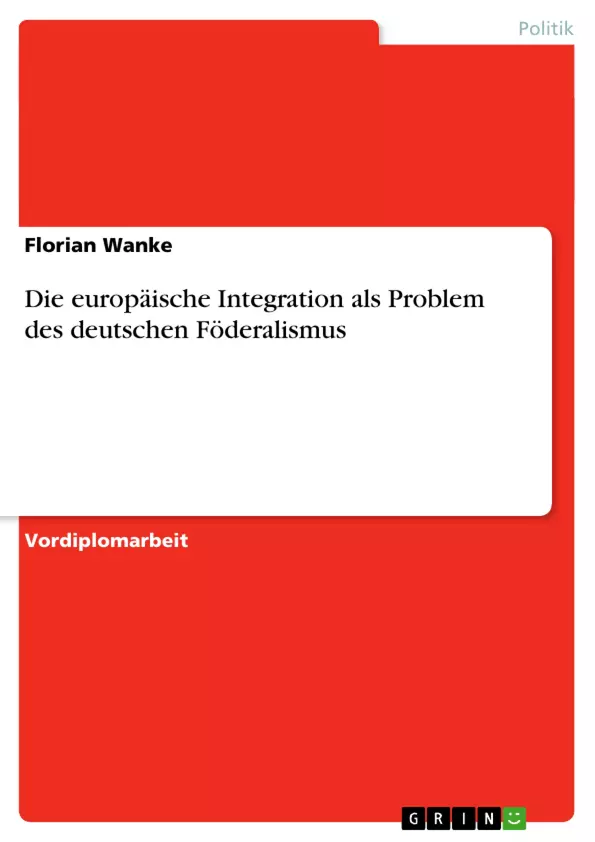Das letzte Jahrhundert brachte einen im historischen Vergleich einzigartigen Prozess der friedlichen Integration ehemals verfeindeter Staaten hervor. In dessen Verlauf wurden mit der Europäischen Union Strukturen des Regierens geschaffen, die tiefe Rückwirkungen auf die Gestalt der politischen Systeme ihrer Mitgliedsstaaten zur Folge haben. Für die Bundesrepublik Deutschland bedeutete und bedeutet dies weiterhin ein Spannungsverhältnis zwischen dem Erfolg des Integrationsprojekts in einer Organisation mit zunehmenden Regelungs- und Gestaltungskompetenzen auf der einen Seite und dem föderalen Gestaltungsprinzip ihres politischen Systems auf der anderen Seite.
Dabei stellt sich immer wieder die Frage, wie die Vorteile der Integration und ihre Chancen zur Lösung zunehmend globaler Probleme genutzt werden können, ohne zugleich die Möglichkeiten föderaler Organisation mit ihrer höheren demokratischen Legitimation und ihrer Berücksichtigung regionaler Besonderheiten und Vielfalt zu beeinträchtigen. Letztlich stellt sich auch die Frage der „‚Europakompatibilität’ des Föderalismus“. (Teufel).
In dieser Arbeit geht es also um die Dimensionen der europäischen Integration als Problem und Herausforderung des deutschen Föderalismus und die Reaktion der Bundesländer darauf. Dazu stellt die Arbeit in einem kurzen Abriss zunächst die Struktur des Föderalismus in Deutschland vor. Danach folgt eine Übersicht über den europäischen Integrationsprozess, wobei besonders dessen Folgen für die deutschen Bundesländer thematisiert werden.
Anschließend wird analysiert, wie die Länder auf die Problematik der europäischen Integration reagierten. Hier können vier unterschiedliche Strategien unterschieden werden: das Bemühen um innerstaatliche Mitwirkung, die institutionelle Beteiligung auf europäischer Ebene, die direkte Interessenvertretung bei EU-Organen und schließlich Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Als eine besondere Problemdimension findet zudem der Bedeutungsverlust der deutschen Landesparlamente Eingang. Die jüngst abgeschlossene Arbeit des Verfassungskonvents der Europäischen Union gibt schließlich Anlass, einen Ausblick auf die zukünftige Stellung der Länder innerhalb des politischen Systems der Europäischen Union zu unternehmen.
Diese Arbeit wurde im Juli 2003 als studienbegleitende Hausarbeit im Rahmen der Diplom-Vorprüfung am Institut für Politikwissenschaft der Philipps-Universität Marburg vorgelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das föderale System der Bundesrepublik Deutschland
- Grundlagen
- Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern
- Der Bundesrat als Länderkammer
- Finanzordnung
- Politikverflechtung und Kooperation
- Entwicklung und aktueller Stand der europäischen Integration
- Von der EGKS zur EG der 12
- Die Einheitliche Europäische Akte: Vollendung des Binnenmarktes
- Die Europäische Union - von Maastricht bis Nizza
- Osterweiterung und Vertiefung? Der aktuelle Stand der Integration
- Strategien der Länder gegen ihren Bedeutungsverlust
- Bemühungen der Länder um innerstaatliche Mitwirkung
- Entwicklung der Ländermitwirkung
- Mitwirkung und Einbindung der Länder heute
- Beteiligung und Vertretung auf europäischer Ebene
- Entwicklung
- Der Ausschuss der Regionen
- Direkte Interessenvertretung der Länder: Die Ländervertretungen
- Neue Perspektive für den Föderalismus: grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit
- Bemühungen der Länder um innerstaatliche Mitwirkung
- Probleme des Länderparlamentarismus
- Strategien der Parlamente zur Einflussgewinnung auf die Europapolitik
- Auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel: Perspektiven der Landesparlamente
- Die zukünftige Stellung der Länder in einem vereinten Europa
- Forderungen der Länder an die Verfassungsentwicklung der EU
- Die Bedeutung des Ergebnis des Konvents zur Zukunft Europas für die Länder
- Zusammenfassung und Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, die die europäische Integration für den deutschen Föderalismus darstellt. Sie untersucht, wie die Bundesländer auf den Integrationsprozess reagieren und welche Strategien sie entwickeln, um ihre Interessen zu wahren.
- Die Struktur des Föderalismus in Deutschland
- Die Entwicklung und der aktuelle Stand der europäischen Integration
- Die Reaktionen der Bundesländer auf die europäische Integration
- Die Auswirkungen der europäischen Integration auf den Länderparlamentarismus
- Die zukünftige Stellung der Länder in der Europäischen Union
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Problematik der europäischen Integration für den deutschen Föderalismus und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor. Kapitel II erläutert das föderale System Deutschlands, indem es die Grundlagen, die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern, den Bundesrat und die Finanzordnung beleuchtet. Kapitel III bietet eine Übersicht über die Entwicklung und den aktuellen Stand der europäischen Integration, wobei insbesondere die Folgen für die Länder fokussiert werden. Kapitel IV untersucht die Reaktionen der Bundesländer auf die europäische Integration und präsentiert verschiedene Strategien, die sie verfolgen, um ihre Interessen zu wahren. Kapitel V analysiert die Probleme des Länderparlamentarismus im Kontext der europäischen Integration und betrachtet die Strategien der Parlamente, um ihren Einfluss zu erhöhen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem deutschen Föderalismus, der europäischen Integration, den Bundesländern, dem Länderparlamentarismus, der Kompetenzverteilung, dem Bundesrat, der Finanzordnung, den Auswirkungen der europäischen Integration auf die Länder, den Strategien der Länder, der Einflussnahme auf die Europapolitik und der Zukunft der Länder in der Europäischen Union.
Häufig gestellte Fragen
Welches Problem ergibt sich aus der EU-Integration für den Föderalismus?
Durch die Übertragung von Kompetenzen auf die EU verlieren die deutschen Bundesländer an eigenem Gestaltungsspielraum in Bereichen, die früher ihre alleinige Domäne waren.
Wie wirken die Bundesländer an der Europapolitik mit?
Die Länder nutzen den Bundesrat für innerstaatliche Mitwirkung, unterhalten eigene Vertretungen in Brüssel und beteiligen sich am Ausschuss der Regionen.
Was ist der „Bedeutungsverlust der Landesparlamente“?
Da oft die Exekutive (Regierungen) auf EU-Ebene verhandelt, werden die gewählten Landesparlamente bei wichtigen Entscheidungen oft übergangen oder vor vollendete Tatsachen gestellt.
Welche Strategien verfolgen Länder zur Interessenwahrung?
Dazu gehören die institutionelle Beteiligung auf EU-Ebene, direkte Lobbyarbeit bei EU-Organen und die verstärkte grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit anderen Regionen.
Was fordern die Länder für die zukünftige EU-Verfassung?
Sie fordern eine klare Kompetenzabgrenzung (Subsidiaritätsprinzip), um die regionale Vielfalt und die demokratische Legitimation des föderalen Systems zu schützen.
- Citation du texte
- Diplom-Politologe Florian Wanke (Auteur), 2003, Die europäische Integration als Problem des deutschen Föderalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17140