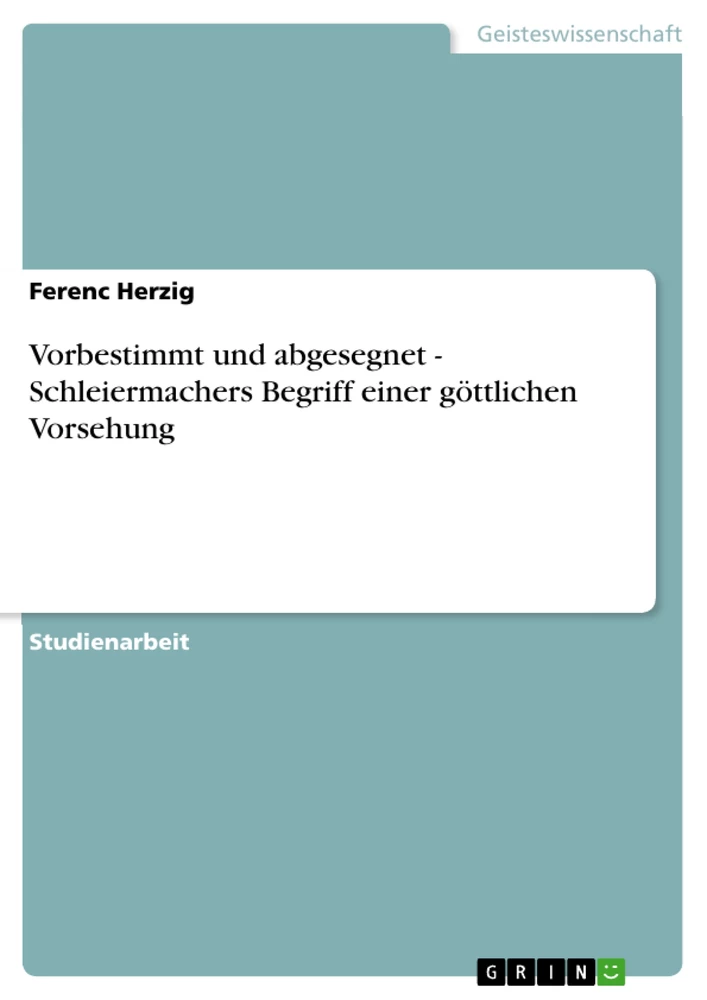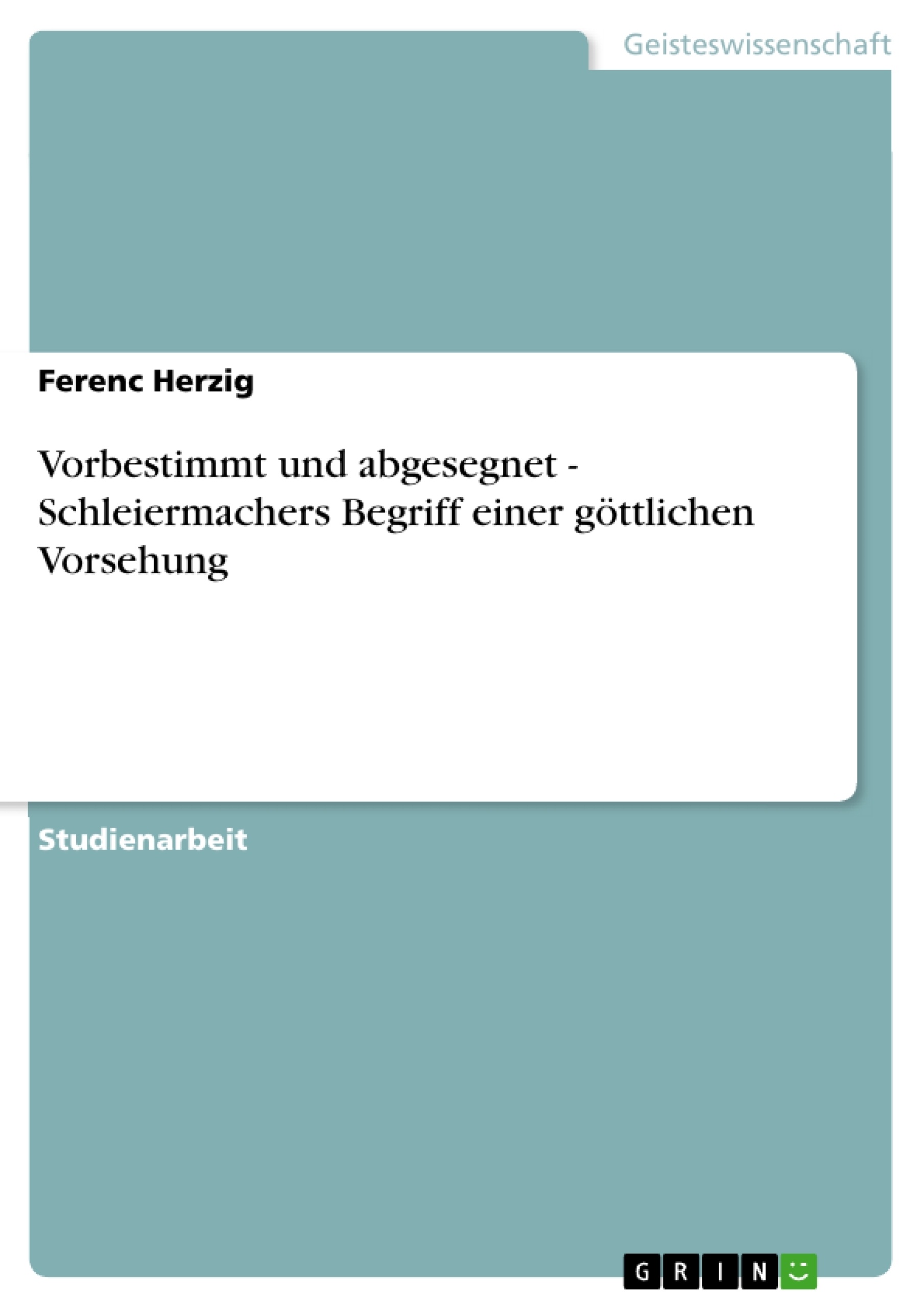Aus der Problemskizze:
"Die Schwierigkeit, angemessen von Gottes Vorsehung angesichts des farben- und facettenreichen, allzuoft aber auch tristen und unverständlich trüben Weltenlaufes zu reden, ist nicht nur sprichwörtlich seit biblischen Zeiten in verschiedenen Ansätzen sowohl klagend festgestellt als auch denkerisch zu lösen versucht worden. [...]
Auch Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher selbst hatte Schwierigkeiten, den Begriff der Vorsehung, zumal in seiner seit der altprotestantischen Orthodoxie klassisch gewordenen Prägung, unbesehen zu übernehmen, da er befürchtete, er stelle nicht scharf genug „die Beziehung jedes einzelnen Theiles auf den Zusammenhang des Ganzen“ heraus oder lasse „das göttliche Weltregiment [verstanden] als eine innerlich zusammenstimmende Anordnung“ nicht eindeutig erkennbar werden. Er entwickelt sein Verständnis einer [...] göttlichen Vorsehung, indem er anhand der von ihm so genannten „schlechthinigen Abhängigkeit“ des unmittelbaren Selbstbewußtseins als Frömmigkeit im ersten Teil seiner Glaubenslehre, bes. §§ 36-39; 46-49 und §§ 54f., das Verhältnis des Menschen zu Gott als Schöpfer, worunter er Gott in erster Linie auch als die Schöpfung Erhaltenden versteht, näher bestimmt und dann über eine auf die Erlösung bezogene Lehre der göttlichen Eigenschaften in den §§ 164-169 die Begründung für einen recht verstandenen Begriff der Weltregierung Gottes gibt.
Diese Seminararbeit versucht nach einer grundlegenden Darstellung des Glaubens als „Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit“ als terminologischer Leitfaden der Glaubenslehre anhand der oben aufgezeigten Orientierungslinie zu erfassen, was genau nach Schleiermacher unter Schöpfung und ihrer Erhaltung zu verstehen ist. Dabei wird es in einem eigenen Abschnitt geboten sein, näher auf die Problematik des in der von Gott geordneten und in ihrem Sosein gewollten Welt erfahrbaren Übels – die Frage nach den „guten und […] bösen Brunnen“ – einzugehen sowie anschließend zu betrachten, was innerhalb dieser Kategorien vor allem für den sich sowohl als schlechthin abhängig als auch partiell frei verstehenden Menschen der sogenannte „Naturzusammenhang“ austrägt für die Begriffe der göttlichen Allmacht und Allursächlichkeit. In einem letzten Schritt wird zu zeigen sein, wie der als Liebe und Weisheit verstandene Gott in der und durch die Erlösung erkannt werden kann und wie das Ziel der göttlichen Weltregierung, mithin der göttlichen Vorherbestimmung, nach Schleiermacher zu bestimmen ist."
Inhaltsverzeichnis
- Problemskizze
- Vorbetrachtung zu Schleiermachers terminologischem Konstruktionsprinzip
- Das Wesen der Frömmigkeit als Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit
- Drei Stufen des Bewußtseins
- Gottes Schöpferwirken
- Der Naturzusammenhang und seine Erhaltung
- Das Übel und das Böse in Gottes Schöpfung
- Die Allursächlichkeit Gottes
- Gottes Erlösungswirken
- Vorherbestimmung in der erlösenden Weltregierung Gottes
- Gottes Liebe
- Gottes Weisheit
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit Friedrich Schleiermachers Verständnis einer göttlichen Vorsehung, wie es in der 2. Auflage seiner Glaubenslehre von 1830/31 dargestellt wird. Die Arbeit analysiert Schleiermachers Konstruktionsprinzip des „Gefühls schlechthinniger Abhängigkeit“ und untersucht, wie dieses Prinzip auf die Bereiche der Schöpfung, Erhaltung und Erlösung angewendet wird.
- Das Wesen der Frömmigkeit als „Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit“
- Schleiermachers Verständnis von Gottes Schöpferwirken und der Erhaltung der Schöpfung
- Die Rolle des Übels und des Bösen in Gottes Schöpfung
- Die Frage nach der Allursächlichkeit Gottes
- Schleiermachers Interpretation der göttlichen Vorherbestimmung und Weltregierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Problemskizze stellt die Frage nach dem Sinn des Lebens und der Rolle der göttlichen Vorsehung im Angesicht von Leid und Ungerechtigkeit. Schleiermachers „schlechthinige Abhängigkeit“ wird als zentrale Grundlage seiner Glaubenslehre vorgestellt. Die Arbeit analysiert, wie diese Abhängigkeit das Verhältnis des Menschen zu Gott als Schöpfer und Erhalter beeinflusst.
Im Kapitel „Gottes Schöpferwirken“ wird Schleiermachers Verständnis von Gottes Schöpfung und Erhaltung beleuchtet. Die Frage nach dem Übel und dem Bösen in der Schöpfung wird erörtert, sowie die Rolle der Allursächlichkeit Gottes.
Das Kapitel „Gottes Erlösungswirken“ befasst sich mit der Vorherbestimmung in der Weltregierung Gottes, der göttlichen Liebe und Weisheit. Die Arbeit analysiert, wie Schleiermacher die Erlösung als Ausdruck der göttlichen Vorsehung versteht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der „schlechthinnigen Abhängigkeit“, der Schöpfung, Erhaltung, Erlösung, Vorherbestimmung, Allursächlichkeit, Liebe und Weisheit. Sie analysiert Schleiermachers theologische Position im Kontext der christlichen Tradition und erforscht seine Einzigartigkeit in der Interpretation der göttlichen Vorsehung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Schleiermacher unter „Frömmigkeit“?
Frömmigkeit wird als das „Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit“ definiert, welches das unmittelbare Selbstbewusstsein des Menschen gegenüber Gott beschreibt.
Wie definiert Schleiermacher die göttliche Vorsehung?
Er versteht sie als das göttliche Weltregiment, das als innerlich zusammenstimmende Anordnung den Zusammenhang aller Teile des Ganzen sicherstellt.
Wie erklärt die Arbeit das Übel in einer von Gott gewollten Welt?
Die Arbeit untersucht Schleiermachers Ansatz zur Problematik des Übels im Kontext des Naturzusammenhangs und der göttlichen Allursächlichkeit.
Welche Rolle spielt die Erlösung in Schleiermachers System?
Durch die Erlösung kann Gott als Liebe und Weisheit erkannt werden, was die Grundlage für den Begriff der Weltregierung bildet.
Was ist mit „Naturzusammenhang“ gemeint?
Es beschreibt die Ordnung der Welt, in der sich der Mensch sowohl als abhängig als auch als partiell frei erfährt.
- Citation du texte
- Ferenc Herzig (Auteur), 2011, Vorbestimmt und abgesegnet - Schleiermachers Begriff einer göttlichen Vorsehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171420