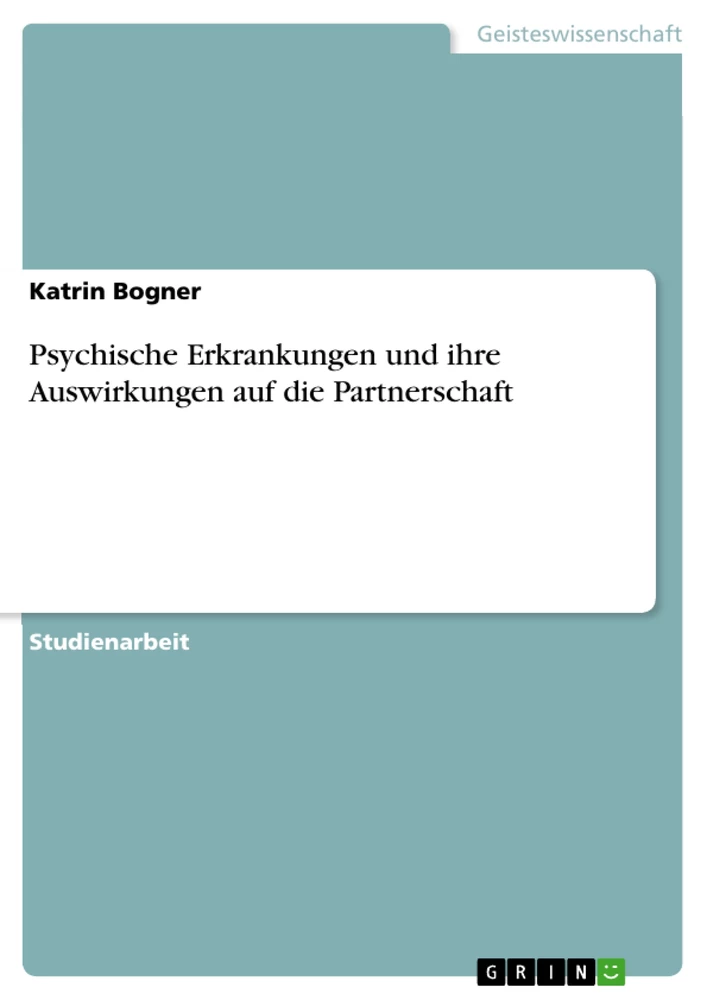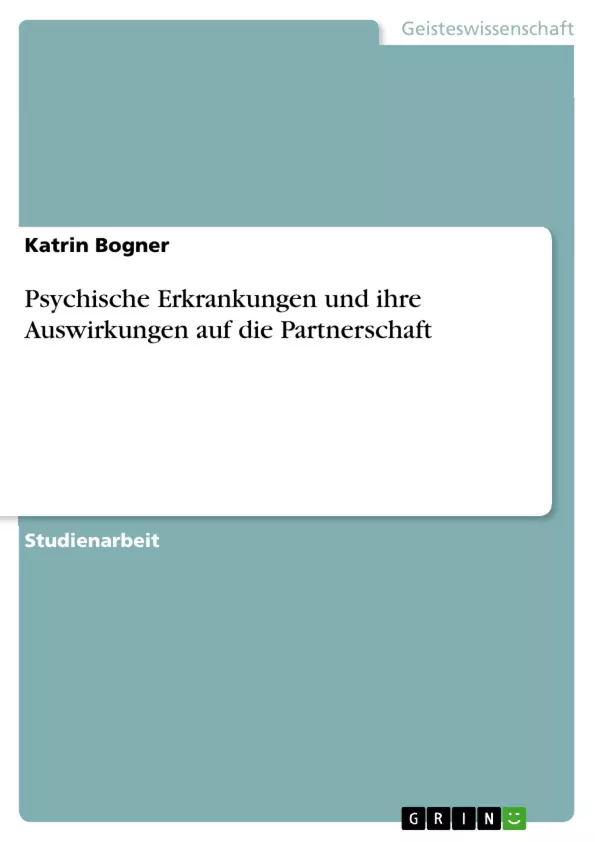In den letzten Jahrzehnten bemühte man sich sehr, psychisch kranke Menschen aus Anstalten herauszuholen. Ermöglicht wurde dieser Schritt durch die Entwicklung wirksamer Medikamente gegen psychische Krankheiten. Im Zusammenhang mit dieser Eingliederungsoffensive wurde verstärkt darauf Wert gelegt, psychisch kranke Menschen als Mitglieder ihrer Familien und der Gesellschaft zu sehen.
Jeder Mensch braucht sozialen Rückhalt, um seine Grundbedürfnisse nach Fürsorge, Akzeptanz und seelischer Unterstützung- besonders in schwierigen Zeiten- zu decken. Sogar wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass ein starker Rückhalt die Genesung von körperlichen und psychischen Krankheiten erheblich beschleunigen kann. Deshalb entscheiden sich immer mehr Angehörige dazu, ihre psychisch kranken Partner auch während einer akuten psychotischen Krise zu Hause zu betreuen, was allerdings nicht selten eine sehr große Belastung darstellt, da die Kranken in dieser Zeit kaum in der Lage sind, ihr Alltagsleben allein zu bewältigen. Die Angehörigen werden oft 24 Stunden am Tag, wochenlang, monatelang oder gar jahrelang hautnah mit der völlig rätselhaften Erkrankung ihres Partners konfrontiert und können sich der Belastung nicht entziehen. Noch dazu kommen die Erfahrungen der Ablehnung und Stigmatisierung, die man oft bei Nachbarn, Bekannten oder Verwandten erlebt, wenn man einen psychisch kranken Partner an seiner Seite hat. Ebenso stellen neben der Erkrankung des Partners und den Reaktionen der sozialen Umwelt auch Scham- und Schuldgefühle sowie die Reduzierung der sozialen Kontakte eine schwere Überforderung für die gesunden Partner da.
In dieser Studienarbeit werde ich die Auswirkungen vorstellen, welche eine Partnerschaft mit einem psychisch kranken Menschen nach sich ziehen sowie aufzeigen, welche Möglichkeiten der Bewältigung und Integration psychotischer Krisen sowohl dem gesunden als auch dem kranken Partner zur Verfügung stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung "psychische Erkrankungen"
- Definition Psychose
- Erste Äußerung einer Psychoseerkrankung
- Auslöser einer Psychose
- Frühwarnzeichen einer Psychose
- Symptome einer Psychose
- Auswirkungen auf bzw. Veränderungen in der Partnerschaft mit einem psychisch kranken Partner
- Veränderungsbereiche der persönlichen Situation der gesunden Partner
- Seelische Belastungen und Gefühle des gesunden Partners
- Veränderungsbereiche im alltäglichen Umgang miteinander
- Absprachen
- Kommunikation
- Konfliktbewältigungsstrategien
- Veränderungen bzw. Auswirkungen einer psychischen Erkrankung auf wichtige Bereiche des partnerschaftlichen Zusammenlebens
- Sexualität
- Kinder- und Familienplanung
- Veränderungsbereiche der persönlichen Situation der gesunden Partner
- Behandlungsmöglichkeiten psychisch kranker Menschen
- Pharmakotherapie
- Psychotherapie
- Soziotherapie
- Hilfen aus dem Bereich der Sozialen Arbeit für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige außerhalb stationärer Einrichtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit den Auswirkungen, die eine Partnerschaft mit einem psychisch kranken Menschen mit sich bringt. Ziel ist es, die Herausforderungen und Belastungen für den gesunden Partner aufzuzeigen und gleichzeitig Möglichkeiten der Bewältigung und Integration psychotischer Krisen für beide Partner aufzuzeigen.
- Die Auswirkungen einer Psychose auf die Partnerschaft
- Die Belastungen und Gefühle des gesunden Partners
- Veränderungen im alltäglichen Umgang und in wichtigen Bereichen des Zusammenlebens
- Behandlungsmöglichkeiten und Hilfen für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige
- Die Bedeutung von sozialem Rückhalt und Integration in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von sozialem Rückhalt für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen, insbesondere in Zeiten akuter Krisen. Sie führt in die Thematik der Studienarbeit ein und stellt die Herausforderungen dar, denen sich gesunde Partner gegenübersehen.
Das Kapitel "Einführung 'psychische Erkrankungen'" differenziert zwischen Neurosen und Psychosen und fokussiert auf die Definition und Charakteristika von Psychosen. Es wird betont, dass eine Unterscheidung zwischen beiden oft schwierig und nicht immer möglich ist.
Das Kapitel "Definition Psychose" erläutert den Begriff "Psychose" als Sammelbegriff für tiefe existenzielle Krisen. Es wird die Unterscheidung zwischen affektiven und kognitiven Psychosen sowie die Herausforderungen bei der Erkennung und Diagnose einer Psychoseerkrankung beleuchtet.
Das Kapitel "Erste Äußerung einer Psychoseerkrankung" beschreibt die Schwierigkeiten bei der frühzeitigen Erkennung einer Psychoseerkrankung durch den Partner. Es werden die Verunsicherung des Erkrankten und die Herausforderungen für den Partner im Umgang mit den "ungewöhnlichen Eigenheiten" des Partners dargestellt.
Das Kapitel "Auslöser einer Psychose" beleuchtet verschiedene "Live-Events", die als Auslöser für das Auftreten von Psychosen angesehen werden können. Es wird betont, dass fast jedes Ereignis im Leben zu einer Psychose führen kann, wobei die Auswirkung und Intensität des Ereignisses für den Betroffenen eine entscheidende Rolle spielen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Studienarbeit sind: psychische Erkrankungen, Psychose, Partnerschaft, Auswirkungen, Belastungen, Bewältigung, Integration, sozialer Rückhalt, Angehörige, Behandlungsmöglichkeiten, Hilfen, Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst eine Psychose das partnerschaftliche Zusammenleben?
Eine Psychose führt oft zu schweren Belastungen in der Kommunikation, bei Absprachen und in sensiblen Bereichen wie Sexualität und Familienplanung.
Was sind typische Frühwarnzeichen einer Psychose?
Die Arbeit erläutert erste Äußerungen und ungewöhnliche Eigenheiten, die oft schwer von gesunden Partnern zu deuten sind, bevor eine akute Krise eintritt.
Welchen Belastungen sind gesunde Partner ausgesetzt?
Partner erleben oft eine 24-Stunden-Belastung, soziale Isolation, Stigmatisierung durch das Umfeld sowie starke Scham- und Schuldgefühle.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es für psychisch Kranke?
Es werden die Pharmakotherapie (Medikamente), Psychotherapie und Soziotherapie als Säulen der Behandlung vorgestellt.
Welche Hilfen bietet die Soziale Arbeit für Angehörige?
Die Arbeit zeigt Möglichkeiten der Unterstützung außerhalb stationärer Einrichtungen auf, um die Integration und Bewältigung im Alltag zu fördern.
- Quote paper
- Katrin Bogner (Author), 2005, Psychische Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf die Partnerschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171492