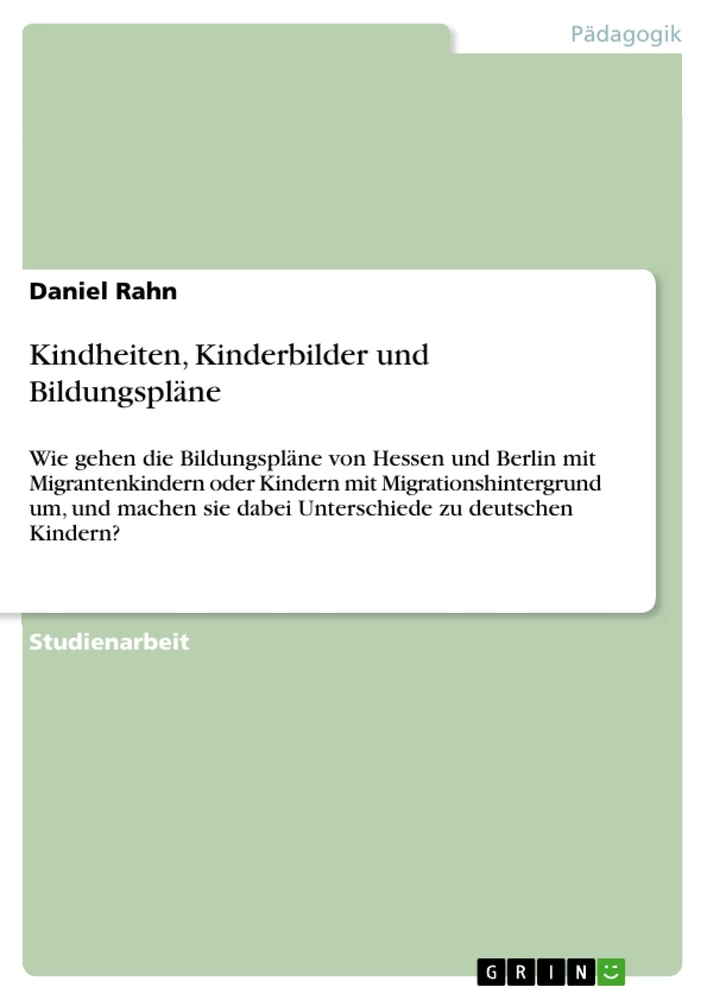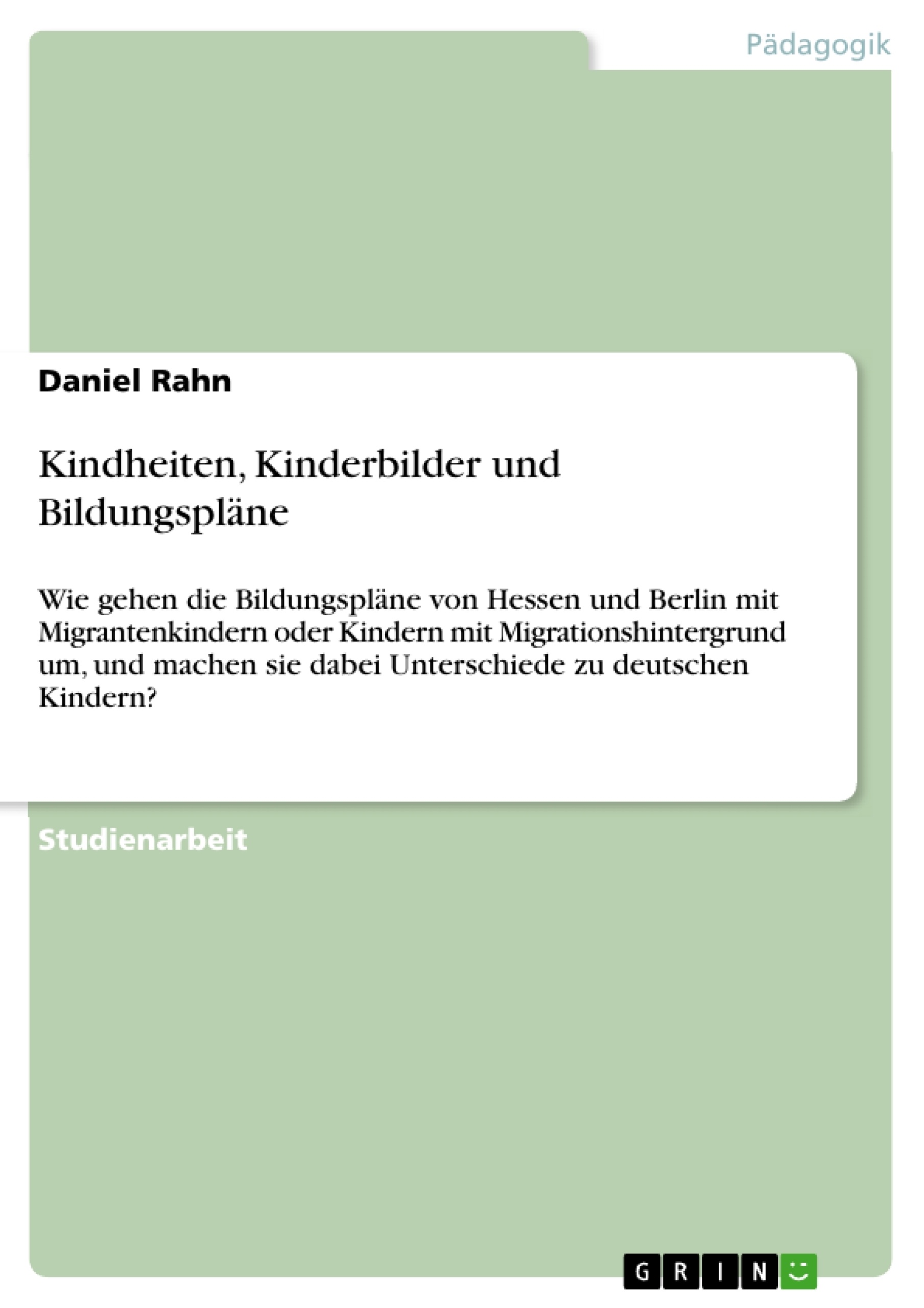Die Diskussionen, die seit Anfang der 1990er Jahre über Kinder, Kindheit und Bilder von Kindern geführt wurden, intensivierten sich nach dem ersten PISA-Schock 2001. Doch die Kultusminister dachten kurioser Weise nicht in erster Linie an eine Schulreform oder über Möglichkeiten nach, wie man Unterricht besser, effektiver und vielleicht auch kindgerechter gestalten könnte. Sie überlegten, ob man in Deutschland Bildungspläne nach skandinavischem Vorbild einführen sollte. Es ging also um Bildung von Anfang an und darum, die Zukunft der Nation zu sichern, denn durch den Geburtenrückgang der letzten Jahrzehnte, werden Kinder eine immer wertvollere und wichtigere Ressource. Diese zukunftswichtige – und nun auch gesellschaftliche – Aufgabe, wollte man nicht der Beliebigkeit der verschiedenen Einrichtungen, deren Konzepten und MitarbeiterInnen überlassen, weshalb man eine gewisse Norm bzw. eine Orientierung geben wollte und ab 2003 anfing, in den einzelnen Bundeslän-dern Bildungspläne einzuführen.
Diese Arbeit hat die Aufgabe, den hessischen Bildungs- und Erziehungsplan und das Berliner Bildungsprogramm hinsichtlich ihres Umgangs mit Migrantenkindern oder Kinder mit Migrationshintergund zu vergleichen, da die heutige Kinderpopulation zu einem Drittel aus diesen Kindern besteht. Da frühkindliche Forschung über multikulturelle Kindheit erst langsam in den Blick gerät, soll untersucht werden, ob die Bildungspläne Unterschiede zwischen autochthonen und nicht autochthonen Kindern machen und wenn ja welche, bzw. an welchen Stellen respektive in welchen Bildungsbereichen. Dabei beschränkt sich der Vergleich und auch die ganze Arbeit, auf die vorschulische Kindheit, da sich Bildungspläne an diese Altersgruppe richten – trotz des Novums des hessischen Bildungsplans, der sich an Kinder von 0-10 Jahren richtet.
Bevor die beiden Pläne hinsichtlich ihres Umgangs mit Migrantenkindern oder Kindern mit Migrationshintergrund analysiert und verglichen werden, erfolgt ein kurzer allgemeiner Vergleich der Pläne, denn es ist wichtig zu wissen, welchen Ansatz und welches Bild vom Kind die beiden Pläne haben, da sich daraus ihre Praxis ableitet. Es soll dahingehend analysiert und verglichen werden, ob die Pläne unterschiedliche Bilder von autochthonen und nicht autochthonen Kindern haben, oder ob sie Unterschiede in der pädagogischen Arbeit mit Migrantenkindern oder Kindern mit Migrationshintergund vorsehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Vorbemerkungen und Grundlagen
- Kind, Kindheit und Kindheitsbilder- bzw. Kindheisperspektiven
- Was ist ein Kind?
- Was ist Kindheit heute?
- Kindheitsbilder aktuell und warum/ zu welchem Zweck gibt es sie?
- Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan und das Berliner Bildungsprogramm im Vergleich
- Was ist ein Bildungsplan und was ist dessen Zweck?
- Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan - ein Kurz-Portrait…
- Das Berliner Bildungsprogramm – ein Kurz-Portrait
- Vergleich der Bildungspläne unter besonderer Berücksichtigung auf den Umgang mit Migrantenkinder bzw. Kinder mit Migrationshintergrund
- Allgemeine Aspekte der Entstehung und Einführung
- Allgemeine Handlungsanforderungen bzw. allgemeine pädagogische Prinzipien
- Pädagogisches Bildungsverständnis
- Migrantenkinder bzw. Kinder mit Migrationshintergrund
- Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Vergleich des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans und des Berliner Bildungsprogramms im Hinblick auf ihren Umgang mit Migrantenkindern oder Kindern mit Migrationshintergrund. Ziel ist es, zu untersuchen, ob die Bildungspläne Unterschiede zwischen autochthonen und nicht autochthonen Kindern machen und wenn ja welche, bzw. an welchen Stellen respektive in welchen Bildungsbereichen.
- Kindheitsbilder und ihre Bedeutung für Bildungspläne
- Analyse der Konzepte und Ziele des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans und des Berliner Bildungsprogramms
- Vergleich der beiden Bildungspläne im Hinblick auf ihre Ansätze zur Förderung von Migrantenkindern
- Diskussion der Rolle von frühkindlicher Forschung in der Gestaltung inklusiver Bildungspläne
- Aufzeigen von Forschungslücken und -bedarfen im Bereich der multikulturellen Kindheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Aktualität der Debatten um Kinder, Kindheit und Kindheitsbilder. Sie stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit dar.
Der zweite Teil der Arbeit beleuchtet die theoretischen Grundlagen, indem er die Begriffe "Kind", "Kindheit" und "Kindheitsbilder" definiert und verschiedene Perspektiven auf Kindheit beleuchtet.
Im dritten Teil der Arbeit werden der hessische Bildungs- und Erziehungsplan und das Berliner Bildungsprogramm im Vergleich vorgestellt. Es werden die Kernaussagen, Ziele und Herangehensweisen der beiden Pläne dargestellt und ein allgemeiner Vergleich hinsichtlich ihrer Ansätze und Bilder vom Kind durchgeführt.
Der vierte Teil der Arbeit analysiert und vergleicht die beiden Bildungspläne hinsichtlich ihres Umgangs mit Migrantenkindern oder Kindern mit Migrationshintergrund. Dabei werden die allgemeinen Aspekte der Entstehung und Einführung, die pädagogischen Prinzipien und das pädagogische Bildungsverständnis betrachtet.
Schlüsselwörter
Kindheit, Kindheitsbilder, Bildungspläne, Migrantenkinder, Migrationshintergrund, Inklusion, frühkindliche Forschung, multikulturelle Kindheit, Bildungsgerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck von Bildungsplänen in der Frühpädagogik?
Sie sollen eine Orientierung und Norm für die frühkindliche Bildung geben, um die Qualität in Kitas bundesweit zu sichern und Kinder optimal zu fördern.
Wie unterscheiden sich der hessische und der Berliner Bildungsplan?
Der hessische Plan richtet sich an Kinder von 0-10 Jahren, während das Berliner Programm spezifischer auf die vorschulische Kindheit fokussiert ist.
Wie gehen Bildungspläne mit Migrantenkindern um?
Die Arbeit untersucht, ob die Pläne spezielle pädagogische Prinzipien für Kinder mit Migrationshintergrund vorsehen oder einen inklusiven Ansatz für alle verfolgen.
Was war der Auslöser für die Einführung dieser Pläne?
Der sogenannte „PISA-Schock“ 2001 führte dazu, dass Bildung bereits im Kindergarten als gesellschaftlich relevante Ressource wahrgenommen wurde.
Welches Bild vom Kind vermitteln moderne Bildungspläne?
Kinder werden als aktive Mitgestalter ihrer Lernprozesse gesehen, wobei ihre individuellen Hintergründe zunehmend Berücksichtigung finden.
- Quote paper
- Daniel Rahn (Author), 2011, Kindheiten, Kinderbilder und Bildungspläne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171528