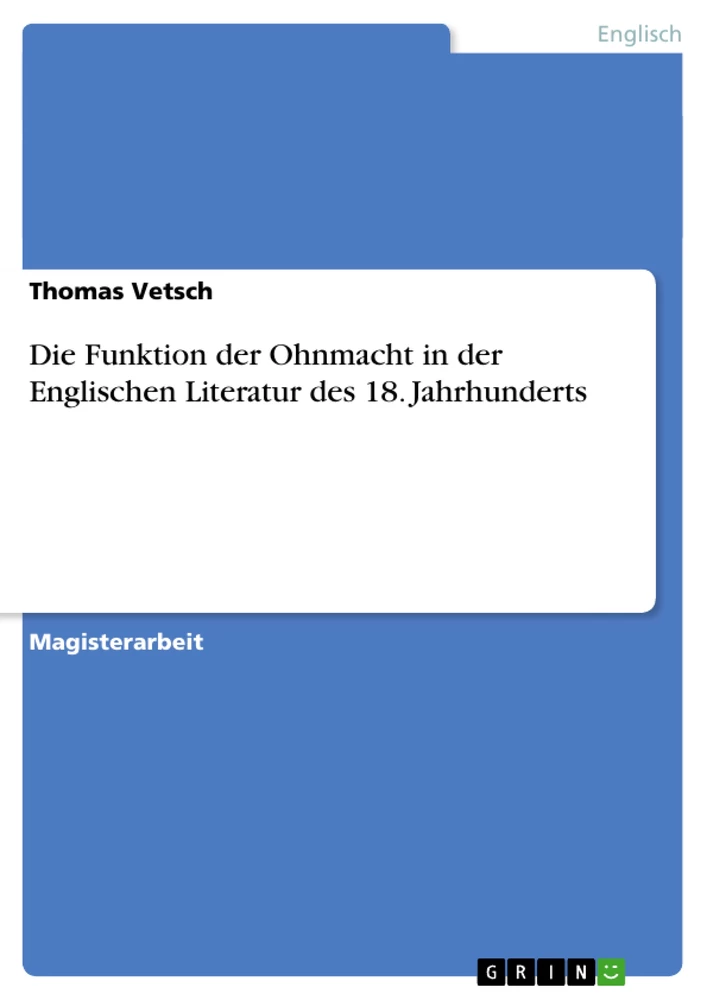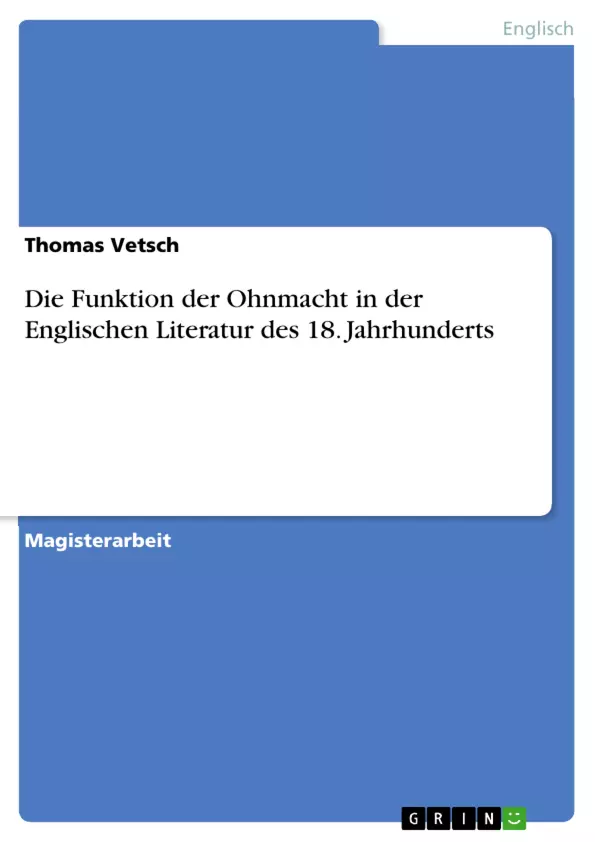Ein Phänomen, das in der literarischen Darstellung des Körpers über alle Epochen
hinweg eine facettenreiche Komponente bildet, ist die Ohnmacht. Es liegt auf der Hand,
dass dieses Phä nomen als Bestandteil der Rhetorik des Überwältigtseins aufgrund seines
ästhetischen Potentials für literarische Inszenierungen besonders reizvoll ist. Dabei folgen
die meisten Ohnmachten dem „Grundmuster von Schrecken, Zusammenbruch und Abwehr“
(Galle 1993, 111). Die vorliegende Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, literarisch
inszenierte Ohnmachten nach eben jenem Grundmuster zu untersuchen. Die Betrachtungen
konzentrieren sich dabei auf die englische Literatur des 18. Jahrhunderts, wobei das Motiv
der Ohnmacht hauptsächlich in narrativen Texten untersucht wird. Wenn die „Variationen,
die eine Zeit mit einem Motiv vornimmt, die Epoche kennzeichnen“ (Frenzel 1966, 30), so
kann davon ausgegangen werden, dass sich an der jeweiligen Ausgestaltung des
Ohnmachtmotivs gleichermaßen signifikante Entwicklungsschritte in der kulturellen
Konzeption des Körpers ablesen lassen. Der Untersuchungsgegenstand legt – wie noch zu
zeigen sein wird – eine Fokussierung des 18. Jahrhunderts nahe.
Die pathologische Dimension der Ohnmacht wird in dieser Untersuchung nicht
untersucht. Ohnmachten, die etwa in Verbindung mit Epilepsie, Katalepsie, Hysterie oder
auch Hypochondrie eintreten, haben ihre Ursache in der jeweiligen Krankheit und nicht in
einem äußeren Geschehen. Für die literarische Ausgestaltung ist jedoch genau dieses äußere
Geschehen von beträchtlichem Interesse, denn es erhält durch einen Ohnmachtanfall eine
besondere Akzentuierung. Die Zeit bleibt für einen kurzen Augenblick stehen und der
Moment erfährt dadurch eine Fokussierung. Des Weiteren beruhen pathologisch begründete
Ohnmachten auf einer anatomischen Dysfunktion, wohingegen die hier relevanten
Ohnmachtanfälle lediglich ein Bild momentan „kollabierender leiblicher Normativität“
(Galle 1993, 104) vermitteln. In Anlehnung an Zedlers Großes Vollständiges Universal-
Lexicon nenne ich meinen Untersuchungsgegenstand die „eigenleidige Ohnmacht“ (1732-
1752, Band V, Spalte 993). Der eben nur kurzzeitige Verlust des normativen körperlichen Status dürfte dafür
verantwortlich sein, dass sowohl die Betroffenen als auch die Betrachter des Spektakels die
Ohnmacht meist als belangloses Ereignis herunterspielen konnten und somit den Blick auf
die eigentliche Brisanz des Phänomens verstellten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Die Ohnmacht aus medizin-philosophischer Sicht
- Sprach- und Körperdiskussion im 18. Jahrhundert
- Exkurs zu Religion und Moralphilosophie im 18. Jahrhundert
- Die Religion im 18. Jahrhundert
- Die Moralphilosophie im 18. Jahrhundert
- Die Frau, das sensible Wesen
- Praktischer Teil
- Ohnmachtanfälle aufgrund eines Objektverlusts
- Moll Flanders
- Tom Jones
- Die schamhafte Ohnmacht
- Pamela
- Dances Pamela; Shamela
- Betsy Thoughtless; Female Quixote; Evelina
- Die glückliche Ohnmacht
- Die Schreckensohnmacht
- Ohnmachtanfälle aufgrund eines Objektverlusts
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht literarisch inszenierte Ohnmachten in der englischen Literatur des 18. Jahrhunderts, fokussiert auf narrative Texte. Ziel ist die Analyse dieser Ohnmachten nach dem Grundmuster von Schrecken, Zusammenbruch und Abwehr, unter Berücksichtigung des zeitgenössischen medizinisch-philosophischen und gesellschaftlichen Wissens. Die Untersuchung beleuchtet die kulturelle Konzeption des Körpers und seine Rolle in der Darstellung von Emotionen und Authentizität.
- Die medizinisch-philosophische Konzeption von Ohnmacht im 18. Jahrhundert
- Die Interaktion von Sprache und Körperausdruck in der Darstellung von Emotionen
- Der Einfluss von Religion und Moralphilosophie auf die Konzeption des weiblichen Körpers und der Ohnmacht
- Die verschiedenen Arten literarischer Ohnmacht und ihre Funktionen (Objektverlust, Scham, Freude, Schrecken)
- Die Rolle der Authentizität und Manipulation von Körperzeichen in der literarischen Darstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Ohnmacht als facettenreiches literarisches Motiv ein und definiert den Fokus der Arbeit auf die englische Literatur des 18. Jahrhunderts. Sie grenzt den Untersuchungsgegenstand auf die „eigenleidige Ohnmacht“ ein, die im Gegensatz zur pathologisch bedingten Ohnmacht durch ein äußeres Geschehen verursacht wird und ein Spannungsverhältnis zwischen Körper und Kultur repräsentiert. Die Bedeutung der zeitgenössischen medizinisch-philosophischen und gesellschaftlichen Konzepte für die Interpretation der literarischen Darstellung wird hervorgehoben.
Theoretischer Teil: Die Ohnmacht aus medizin-philosophischer Sicht: Dieses Kapitel untersucht die medizinische und philosophische Konzeption der Ohnmacht von der Antike bis zur Aufklärung. Es werden verschiedene Definitionen und Theorien von Galen, Descartes und anderen diskutiert, die die Ohnmacht mit der Funktion der Seele, den Körpersäften, dem Blutkreislauf und schließlich dem Nervensystem verbinden. Die Rolle der Leidenschaften und ihre Verbindung zu Nervenkrankheiten wird betont, ebenso die damalige Behandlung von Ohnmachtanfällen. Der Unterschied zwischen heutigem und zeitgenössischem Wissen über Ohnmacht wird hervorgehoben.
Theoretischer Teil: Sprach- und Körperdiskussion im 18. Jahrhundert: Das Kapitel beleuchtet die aufklärerische Sprachdiskussion und deren Einfluss auf die Auffassung vom Körper und dessen Ausdruck. Es wird die Bedeutung der Gebärdensprache im Kontext der Wortsprache analysiert, wobei die spontane Gestik als Ausdruck des Un- und Vorbewussten interpretiert wird. Der Körper wird als ehrliches Artikulationsmedium des Inneren verstanden, und die Rolle der Physiognomie als Wissenschaft der Körpersemiotik wird diskutiert. Das Kapitel beleuchtet den Wandel von der negativen Bewertung der Körpersprache im 17. Jahrhundert hin zur Aufwertung der Authentizität im 18. Jahrhundert, wobei der Konflikt zwischen Authentizität und Simulation von Körperzeichen behandelt wird.
Theoretischer Teil: Exkurs zu Religion und Moralphilosophie im 18. Jahrhundert: Dieser Exkurs behandelt den Einfluss von Rationalismus und Empirismus auf die religiösen und moralischen Vorstellungen des 18. Jahrhunderts. Er untersucht die Auseinandersetzung mit der christlichen Kirche und den Aufstieg von Vernunftreligion und Religionstoleranz. Die Rolle von Moral, Tugend, Gefühl und Vernunft in der ethischen Entscheidungsfindung wird diskutiert, wobei die Konzepte von Locke, Hume, Hutcheson und Smith im Fokus stehen. Die Bedeutung des moralischen Empfindens und der Selbstbeobachtung, sowie die Rolle des imaginären Beobachters in der moralischen Bewertung werden erläutert.
Theoretischer Teil: Die Frau, das sensible Wesen: Das Kapitel untersucht die Gründe für die vermehrt literarische Darstellung weiblicher Ohnmachten im 18. Jahrhundert. Es diskutiert die Vorstellungen von der weiblichen Konstitution, Sensibilität und Nervenschwäche, die sowohl mit anatomischen als auch mit gesellschaftlichen Faktoren in Verbindung gebracht werden. Der Einfluss von Religion und Moralphilosophie auf die Konzeption der schamhaften Frau und ihre Rolle in der Liebe wird analysiert. Die Bedeutung von Schönheit, List und Schamhaftigkeit in der weiblichen Selbstpräsentation und deren Zusammenhang mit der Ohnmacht werden hervorgehoben.
Praktischer Teil: Ohnmachtanfälle aufgrund eines Objektverlusts: Dieses Kapitel analysiert Ohnmachten als Reaktion auf Objektverlust in den Romanen "Moll Flanders" und "Tom Jones". In "Moll Flanders" werden Ohnmachten als Ausdruck von Bedrohung und Reue interpretiert, während in "Tom Jones" die Ohnmacht als Mittel der Manipulation und ein Auslöser dramatischer Handlungswenden dargestellt wird. Die Rolle des Erzählers und die Interpretation der Körperzeichen werden diskutiert.
Praktischer Teil: Die schamhafte Ohnmacht: Dieses Kapitel untersucht Ohnmachten als Ausdruck von verletztem Schamgefühl in verschiedenen Romanen. In "Pamela" wird die Ohnmacht als Mittel zur Verteidigung der weiblichen Tugend und Unschuld dargestellt, während in "Shamela" (Fieldings Parodie) die Simulation von Ohnmachten als Mittel der Manipulation analysiert wird. "Betsy Thoughtless", "Female Quixote" und "Evelina" werden in Bezug auf die Darstellung von schamhaften Ohnmachten und deren Folgen diskutiert.
Praktischer Teil: Die glückliche Ohnmacht: Hier werden Ohnmachten als Reaktion auf freudige Ereignisse untersucht. Beispiele aus "Moll Flanders", "Pamela" und "Betsy Thoughtless" zeigen, dass auch positive Ereignisse zu Ohnmacht führen können und diese nicht immer positive Konsequenzen haben müssen. Die Rolle der Handlungsunfähigkeit der ohnmächtigen Person und die Möglichkeiten der Fehlinterpretation werden erläutert.
Praktischer Teil: Die Schreckensohnmacht: Dieses Kapitel untersucht Ohnmachten im Kontext des Schauerromans ("The Castle of Otranto"). Hier werden Ohnmachten als Ausdruck von Schrecken und Bedrohung interpretiert, wobei deren Funktion als reine Ornamentik ohne tiefere Bedeutung für die Handlung hervorgehoben wird. Der Wandel der Ohnmachtfunktion im Übergang zur Romantik wird angedeutet.
Zusammenfassung und Ausblick: Die Zusammenfassung fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Ohnmacht, Englische Literatur, 18. Jahrhundert, Körper, Sprache, Kommunikation, Religion, Moralphilosophie, Frau, Tugend, Moral, Sensibilität, Empfindsamkeit, Authentizität, Simulation, Objektverlust, Scham, Freude, Schrecken, Roman, Sentimentalität, Schauerroman, Pamela, Moll Flanders, Tom Jones.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Literarisch Inszenierte Ohnmachten in der Englischen Literatur des 18. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht literarisch inszenierte Ohnmachten in englischen Romanen des 18. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der Analyse dieser Ohnmachten nach dem Muster von Schrecken, Zusammenbruch und Abwehr, wobei der zeitgenössische medizinisch-philosophische und gesellschaftliche Kontext berücksichtigt wird. Die Arbeit konzentriert sich auf die sogenannte „eigenleidige Ohnmacht“, die im Gegensatz zur krankheitsbedingten Ohnmacht durch ein äußeres Geschehen verursacht wird.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die kulturelle Konzeption des Körpers und seine Rolle in der Darstellung von Emotionen und Authentizität im Kontext von literarisch dargestellten Ohnmachten. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen Sprache, Körperausdruck und der Inszenierung von Emotionen in der Literatur des 18. Jahrhunderts.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die medizinisch-philosophische Konzeption von Ohnmacht im 18. Jahrhundert, die Interaktion von Sprache und Körperausdruck, den Einfluss von Religion und Moralphilosophie auf die Konzeption des weiblichen Körpers und der Ohnmacht, verschiedene Arten literarischer Ohnmacht (Objektverlust, Scham, Freude, Schrecken) und die Rolle der Authentizität und Manipulation von Körperzeichen in der literarischen Darstellung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil, sowie Einleitung und Zusammenfassung. Der theoretische Teil behandelt die medizinisch-philosophische Sicht auf Ohnmacht, die Sprach- und Körperdiskussion des 18. Jahrhunderts, den Einfluss von Religion und Moralphilosophie sowie die spezifische Darstellung der Frau als „sensibles Wesen“. Der praktische Teil analysiert Ohnmachten in verschiedenen Romanen, kategorisiert nach Objektverlust, Scham, Freude und Schrecken. Die Einleitung führt in das Thema ein, während die Zusammenfassung die Ergebnisse zusammenfasst und einen Ausblick bietet.
Welche Romane werden im praktischen Teil analysiert?
Im praktischen Teil werden unter anderem folgende Romane analysiert: "Moll Flanders", "Tom Jones", "Pamela", "Shamela", "Betsy Thoughtless", "Female Quixote", "Evelina" und "The Castle of Otranto". Die Analyse konzentriert sich auf die unterschiedlichen Funktionen und Darstellungsweisen von Ohnmachten in diesen Werken.
Wie werden die Ohnmachten in den Romanen kategorisiert?
Die Ohnmachten werden in vier Kategorien eingeteilt: Ohnmachten aufgrund von Objektverlust, schamhafte Ohnmachten, glückliche Ohnmachten und Schreckensohnmachten. Jede Kategorie wird anhand von ausgewählten Romanbeispielen analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ohnmacht, Englische Literatur, 18. Jahrhundert, Körper, Sprache, Kommunikation, Religion, Moralphilosophie, Frau, Tugend, Moral, Sensibilität, Empfindsamkeit, Authentizität, Simulation, Objektverlust, Scham, Freude, Schrecken, Roman, Sentimentalität, Schauerroman, Pamela, Moll Flanders, Tom Jones.
Welche Rolle spielt die zeitgenössische Medizin und Philosophie?
Die Arbeit berücksichtigt die zeitgenössischen medizinisch-philosophischen und gesellschaftlichen Konzepte als wichtigen Kontext für die Interpretation der literarischen Darstellung von Ohnmachten. Sie untersucht die damaligen Vorstellungen von Körper, Seele und Emotionen, um die literarischen Darstellungen besser zu verstehen.
Wie wird der Körper in der Arbeit betrachtet?
Der Körper wird als zentrales Element der Analyse betrachtet. Die Arbeit untersucht, wie der Körper in der Literatur des 18. Jahrhunderts dargestellt wird, wie er Emotionen ausdrückt und wie er zur Inszenierung von Authentizität oder Manipulation eingesetzt wird.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Zusammenfassung fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen bezüglich der literarischen Darstellung von Ohnmacht im 18. Jahrhundert und dessen gesellschaftlichen Kontext.
- Citation du texte
- Thomas Vetsch (Auteur), 2002, Die Funktion der Ohnmacht in der Englischen Literatur des 18. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17162