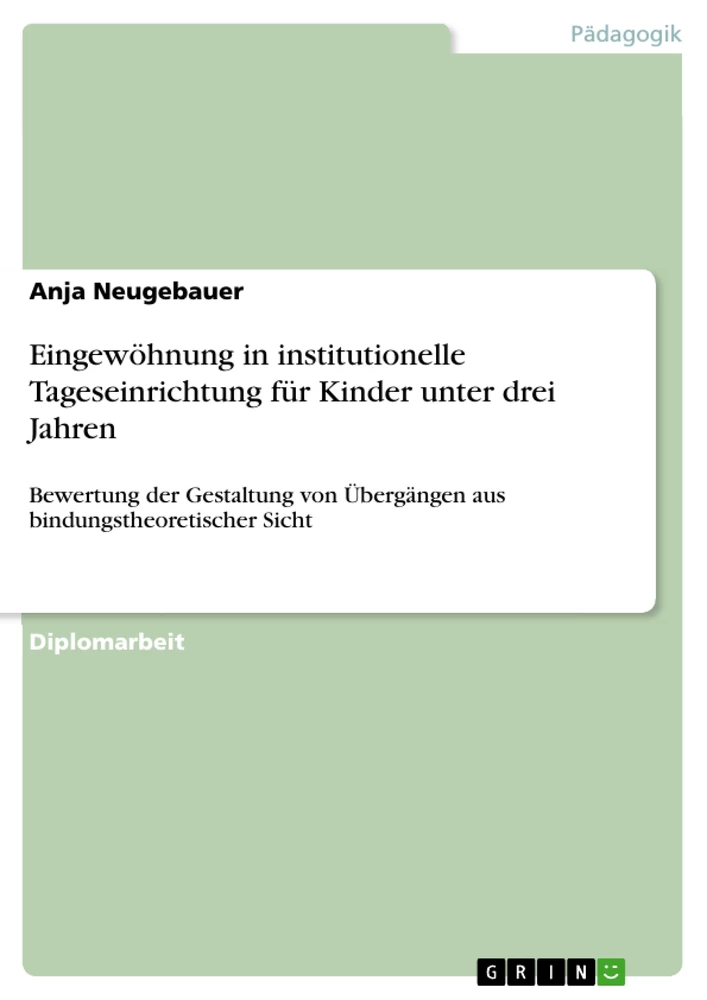Jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens mit einer Reihe von Übergängen konfrontiert. Als häufig auftretende seien hier beispielsweise Übergänge von der Familie in den Kindergarten, vom Kindergarten in die Grundschule oder der Wechsel des Arbeitsplatzes genannt.
Jedes dieser Ereignisse ist in bestimmtem Maße mit einer gewissen Emotionalität besetzt und ruft sicherlich bei vielen Betroffenen Neugier und Spannung, aber auch Ängste sowie Unsicherheit hervor. Daher werden Übergängen in vielen Bereichen Schonräume und Einarbeitungszeiten zugesichert.
Gegenstand dieser Arbeit soll ein ganz bestimmter Übergang sein: die Eingewöhnung von Kindern unter drei Jahren in institutionelle Tageseinrichtungen mit dem Fokus auf ihre Gestaltung und die entsprechende bindungstheoretische Beurteilung.
Wechselt ein Kind von der Familie in die Krippe, übernimmt es die Rolle eines Kleinkindes in einer außerfamiliären Tagesbetreuung. Diese hält andere Aufgaben bereit, als es in seiner Familie der Fall ist. Das Kind ist nun angehalten, fremde Menschen kennen zu lernen und sich an einige Regeln der Einrichtung zu halten, die sich teilweise stark von denen der Familie abgrenzen, aber auch mit anderen Kindern umzugehen.
Um diese unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten gewährleisten zu können, muss das Kind zunächst in seine neue Umgebung eingewöhnt werden. Dieser emotional besetzte Prozess wird auf unterschiedliche Arten gestaltet und führt somit zu verschiedenen Reaktionen der betroffenen Kinder, aber auch der beteiligten Erwachsenen.
Auf welche Weise und unter welchen Umständen dies vollzogen werden kann, soll im Laufe der Arbeit erörtert werden. Damit einhergehend werden die jeweiligen bindungstheoretischen Konsequenzen erläutert.
Weiterhin wird eine empirische Studie zur Erfassung der Gestaltung von Eingewöhnungssituationen in den Einrichtungen für Kinder unter drei Jahren der Stadt Frankfurt am Main durchgeführt. Damit soll ein Praxisbezug hergestellt werden, um zu überprüfen, inwieweit die Mitarbeiterinnen der Einrichtungen Kenntnisse über Eingewöhnungsmodelle und die Bindungstheorie haben und in welchem Maße diese in der Praxis durchführbar sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung des Kindes von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr.
- Definition von Entwicklung.
- Entwicklungsaufgaben
- Entwicklung des Kindes im ersten Lebensjahr
- Sinneswahrnehmungen
- Motorische Entwicklung
- Kognitive Entwicklung
- Entwicklung von Kommunikation, Sozialverhalten und Emotionen..
- Entwicklung des Kindes im zweiten Lebensjahr
- Motorische Entwicklung
- Kognitive Entwicklung
- Entwicklung von Kommunikation, Sozialverhalten und Emotionen..
- Entwicklung des Selbst...
- Entwicklung des Kindes im dritten Lebensjahr
- Motorische Entwicklung.
- Entwicklung von Kommunikation, Sozialverhalten und Emotionen..
- Entwicklung des Selbst .....
- Die Bindungstheorie .......
- Die Geschichte der Bindungstheorie..
- Grundlagen der Bindungstheorie
- Definition von Bindung...
- Bindungsverhalten...
- Explorationsverhalten
- Die,,sichere Basis“ und die Bindungs-Explorations-Balance.
- Internale Arbeitsmodelle.......
- Entstehung und Formen von Bindung.
- Bindungsentwicklung......
- Entdeckung der organisierten Bindungsmuster
- Die,,Fremde Situation“..
- Ursprung und Ziel der Untersuchung.
- Versuchsdurchführung
- Ergebnisse der Untersuchung.
- Die ersten drei Bindungsmuster..
- Das sichere Bindungsmuster.
- Das unsicher-vermeidende Bindungsmuster.
- Das unsicher-ambivalente Bindungsmuster ..
- Die desorganisierte bzw. desorientierte Bindungsqualität .....
- Die,,Fremde Situation“..
- Bedingungen zur Entstehung verschiedener Bindungsmuster ....
- Mütterliche Feinfühligkeit
- Kooperation versus Beeinträchtigung durch die Bindungsperson...
- Annahme versus Zurückweisung ..
- Temperament des Kindes....
- Zusammenfassung.
- Eingewöhnung in die institutionelle Tagesbetreuung.
- Krippen, Krabbelstuben und Kindertagesstätten – Ein Überblick.
- Kindertagesstätten.
- Krippe versus Krabbelstube.
- Sicht auf die außerfamiliale Tagesbetreuung in der DDR und BRD vor 1990..
- Heutige Situation der außerfamiliären Kindesbetreuung.
- Möglichkeiten der Gestaltung von Eingewöhnung.
- Mögliche Reaktionen des Kindes auf die kurze Trennung von der Bindungsperson.....
- Eingewöhnung ohne Beteiligung der Eltern
- Gestaltung der Eingewöhnung ohne Eltern.
- Folgen der Eingewöhnung ohne Eltern und bindungstheoretische Bewertung..
- Schlussfolgerungen
- Eingewöhnung mit Beteiligung der Eltern..
- Das „Berliner Eingewöhnungsmodell“..
- Durchführung der Eingewöhnung nach dem ,,Berliner Modell\".
- Folgen und bindungstheoretische Beurteilung.
- Eingewöhnung nach Reggio Emilia.....
- Das Konzept der Reggio-Pädagogik
- Eingewöhnungskonzept nach Reggio Emilia.
- Beurteilung aus bindungstheoretischer Sicht.
- Eingewöhnung nach Kuno Beller.
- Merkmale und Durchführung der Eingewöhnung
- Zeitlicher Ablauf der Eingewöhnung.
- Bindungstheoretische Beurteilung
- Weitere Einflussfaktoren auf die Eingewöhnung
- Schlussfolgerung zur Beteiligung der Eltern .......
- Das „Berliner Eingewöhnungsmodell“..
- Bestandsaufnahme der Eingewöhnungssituation in Frankfurter
Kindertageseinrichtungen
.............
- Vorbereitung und Durchführung der Erhebung.
- Auswertung der Fragebögen
- Zusammenfassung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Eingewöhnung von Kindern unter drei Jahren in institutionelle Tageseinrichtungen. Im Mittelpunkt steht die Bewertung verschiedener Eingewöhnungsmodelle aus bindungstheoretischer Sicht.
- Die Bedeutung der Bindungstheorie für die Eingewöhnung von Kleinkindern
- Die Auswirkungen von Trennung und Wiedervereinigung auf die Bindungsqualität
- Die Gestaltung von Eingewöhnungsprozessen unter Berücksichtigung bindungstheoretischer Prinzipien
- Die Analyse verschiedener Eingewöhnungsmodelle (z.B. Berliner Modell, Reggio Emilia)
- Die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Eingewöhnungssituation in Frankfurter Kindertageseinrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der kindlichen Entwicklung von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr. Hierbei werden wichtige Entwicklungsbereiche wie die motorische, kognitive und sozial-emotionale Entwicklung beleuchtet. Anschließend wird die Bindungstheorie vorgestellt und ihre Bedeutung für die frühkindliche Entwicklung hervorgehoben. Die verschiedenen Bindungsmuster und ihre Entstehung werden detailliert beschrieben.
Im vierten Kapitel wird die Eingewöhnung in die institutionelle Tagesbetreuung thematisiert. Verschiedene Eingewöhnungsmodelle, ihre Konzepte und Durchführung werden vorgestellt. Die Arbeit analysiert und bewertet diese Modelle aus bindungstheoretischer Sicht und untersucht ihre Auswirkungen auf die Bindungsqualität der Kinder.
Das fünfte Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Eingewöhnungssituation in Frankfurter Kindertageseinrichtungen. Die Untersuchung analysiert die gängigen Eingewöhnungsmethoden, die Berücksichtigung der Bindungstheorie und die Erfahrungen von Eltern und Erzieherinnen.
Schlüsselwörter
Eingewöhnung, Kinder unter drei Jahren, Bindungstheorie, sichere Basis, Explorationsverhalten, Internale Arbeitsmodelle, Berliner Eingewöhnungsmodell, Reggio-Pädagogik, empirische Untersuchung, Frankfurter Kindertageseinrichtungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Eingewöhnung in der Krippe?
Ziel ist es, dem Kind den Übergang von der Familie in die außerfamiliäre Tagesbetreuung zu erleichtern, indem es eine sichere Bindung zu neuen Bezugspersonen aufbaut.
Welche Rolle spielt die Bindungstheorie bei der Eingewöhnung?
Die Bindungstheorie nach Bowlby liefert die Basis für das Verständnis von Trennungsangst und die Notwendigkeit einer „sicheren Basis“ für das Explorationsverhalten des Kindes.
Was ist das „Berliner Eingewöhnungsmodell“?
Es ist ein wissenschaftlich fundiertes Modell, das eine schrittweise Eingewöhnung unter aktiver Beteiligung der Eltern vorsieht, um Stress für das Kind zu minimieren.
Welche anderen Modelle werden in der Arbeit genannt?
Neben dem Berliner Modell werden auch die Konzepte nach Reggio Emilia und Kuno Beller aus bindungstheoretischer Sicht bewertet.
Welche Auswirkungen hat eine Eingewöhnung ohne Eltern?
Die Arbeit untersucht die negativen Folgen und bindungstheoretischen Risiken, wenn Kinder ohne die unterstützende Anwesenheit ihrer Bezugspersonen in die Betreuung eingeführt werden.
- Krippen, Krabbelstuben und Kindertagesstätten – Ein Überblick.
- Citar trabajo
- Anja Neugebauer (Autor), 2009, Eingewöhnung in institutionelle Tageseinrichtung für Kinder unter drei Jahren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171978