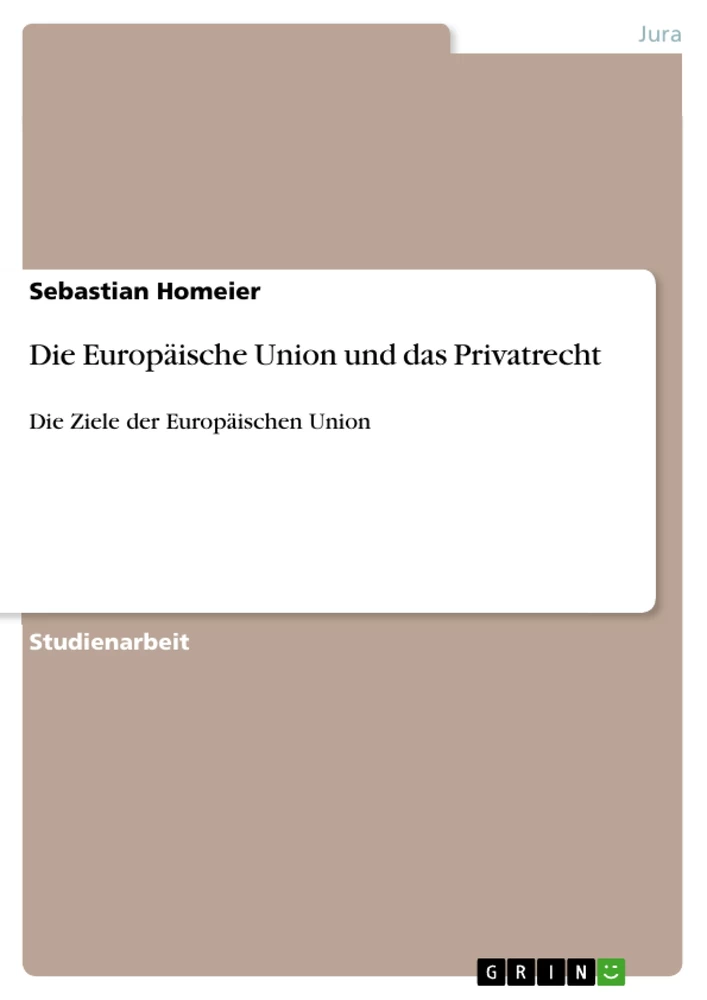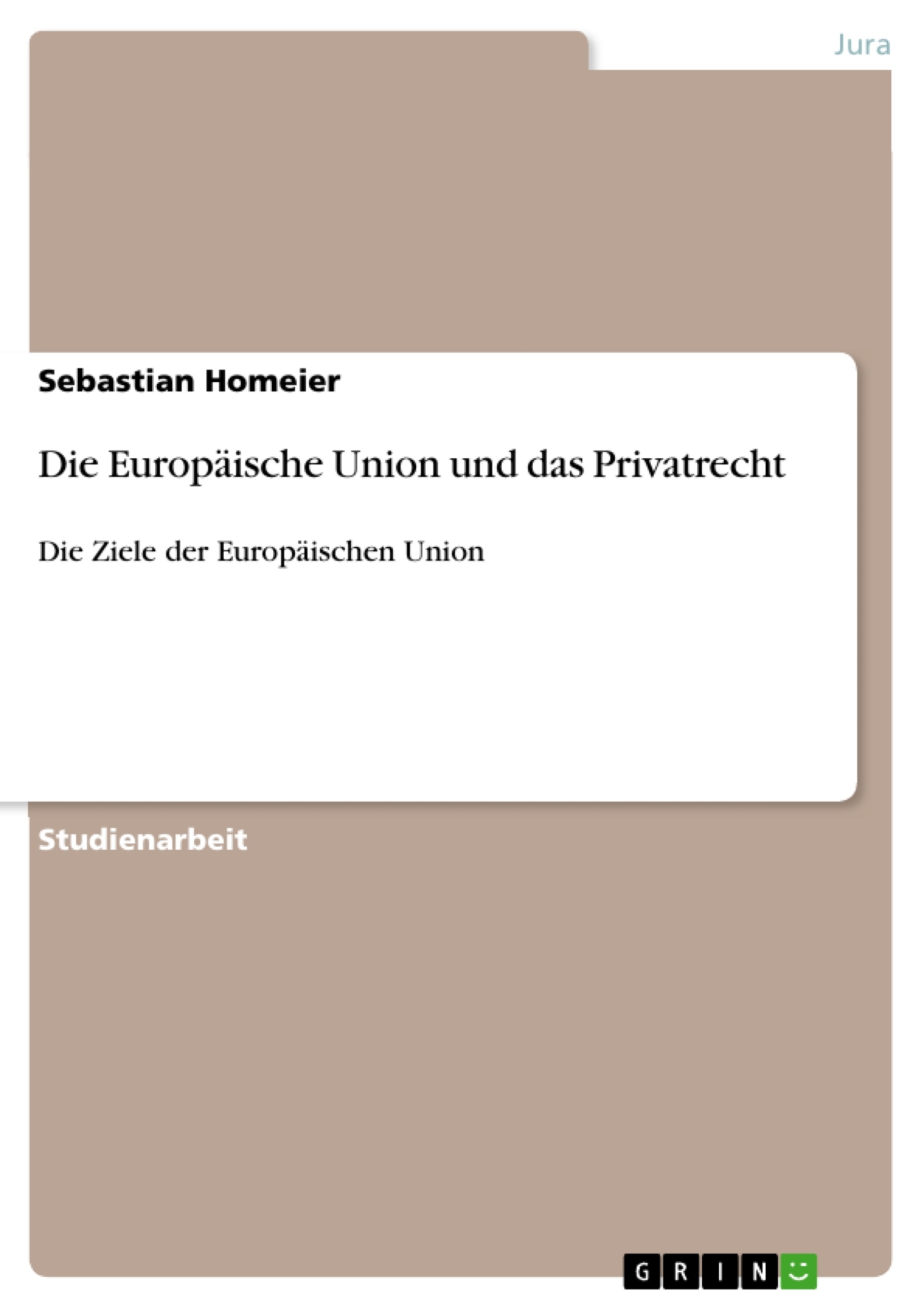Die Arbeit beschreibt die Ziele und Zwecke der Europäischen Union und ihrer Vorläufer. Im Anschluss daran wird an Beispielen erläutert, wie sich diese Ziele auf das Privatrecht ausgewirkt haben. Dabei wird auf die positive und negative Harmonisierung im Bereich der verbraucherschützenden Regelungen eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabe 1:
- Europäische Gemeinschaft Kohle und Stahl
- Europäische Atomgemeinschaft
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
- Die Gemeinschaften
- Aufgabe 2:
- Einheitliche Europäische Akte
- Vertrag von Maastricht
- Verträge von Amsterdam und Nizza
- Aufgabe 3:
- Negative Harmonisierung
- Warenverkehrsfreiheit
- Arbeitnehmerfreizügigkeit
- Niederlassungsfreiheit
- Dienstleistungsfreiheit
- Kapital- und Zahlungsverkehr
- Positive Harmonisierung
- Verbrauchervertragsrecht
- Widerruf von Haustürgeschäften
- Missbräuchliche Vertragsklauseln
- Verbrauchsgüterkauf
- Reisevertrag
- Elektronischer Geschäftsverkehr
- Produkthaftung
- Verbrauchervertragsrecht
- Negative Harmonisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Europäischen Union und ihrem Einfluss auf das Privatrecht. Sie analysiert die Ziele der Europäischen Gemeinschaften bei ihrer Gründung und die späteren Zielsetzungen, die hinzugetreten sind. Die Arbeit untersucht außerdem, wie sich diese Ziele im Privatrecht der Europäischen Union niedergeschlagen haben, sowohl durch negative als auch durch positive Harmonisierung.
- Die Entwicklung der Ziele der Europäischen Gemeinschaften
- Die Bedeutung der negativen Harmonisierung für die Freiheit des Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs
- Die Auswirkungen der positiven Harmonisierung auf das Verbrauchervertragsrecht, den elektronischen Geschäftsverkehr und die Produkthaftung
- Beispiele für die Umsetzung der europäischen Ziele im deutschen Privatrecht
- Die Rolle des Europäischen Gerichtshofs in der Auslegung des europäischen Privatrechts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit ist in drei Aufgaben gegliedert. Aufgabe 1 befasst sich mit den Zielen der Europäischen Gemeinschaften bei ihrer Gründung. Sie analysiert die Ziele der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Europäischen Atomgemeinschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Aufgabe 2 untersucht die späteren Zielsetzungen, die hinzugetreten sind. Dazu gehören die Einheitliche Europäische Akte, der Vertrag von Maastricht und die Verträge von Amsterdam und Nizza. Aufgabe 3 schließlich befasst sich mit der Umsetzung dieser Ziele im Privatrecht der Europäischen Union. Sie unterscheidet zwischen negativer und positiver Harmonisierung und stellt Beispiele für die Umsetzung der europäischen Ziele im deutschen Privatrecht vor.
Schlüsselwörter
Europäische Union, Privatrecht, Harmonisierung, negative Harmonisierung, positive Harmonisierung, Warenverkehrsfreiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit, Kapitalverkehr, Verbrauchervertragsrecht, elektronischer Geschäftsverkehr, Produkthaftung, Europäischer Gerichtshof.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat die EU auf das nationale Privatrecht?
Die EU beeinflusst das Privatrecht durch Harmonisierung, um den Binnenmarkt zu stärken. Dies geschieht durch Richtlinien und Verordnungen, die nationale Gesetze angleichen.
Was versteht man unter "negativer Harmonisierung"?
Negative Harmonisierung bezeichnet den Abbau von nationalen Handelshemmnissen und Beschränkungen, um die Grundfreiheiten (Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr) zu gewährleisten.
Was ist "positive Harmonisierung" im EU-Privatrecht?
Positive Harmonisierung ist die aktive Schaffung von gemeinsamem EU-Recht, wie zum Beispiel im Verbraucherschutzrecht oder bei der Produkthaftung.
Welche Bereiche des Verbraucherschutzes werden durch die EU geregelt?
Beispiele sind der Widerruf von Haustürgeschäften, Regelungen zu missbräuchlichen Vertragsklauseln, der Verbrauchsgüterkauf und Reiseverträge.
Welche Rolle spielt der Europäische Gerichtshof (EuGH) in diesem Kontext?
Der EuGH ist für die verbindliche Auslegung des europäischen Rechts zuständig und stellt sicher, dass die Privatrechtsnormen in allen Mitgliedstaaten einheitlich angewendet werden.
Welche historischen Verträge waren entscheidend für die Entwicklung der EU-Ziele?
Dazu gehören die Einheitliche Europäische Akte, der Vertrag von Maastricht sowie die Verträge von Amsterdam und Nizza.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Homeier (Autor:in), 2004, Die Europäische Union und das Privatrecht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171980