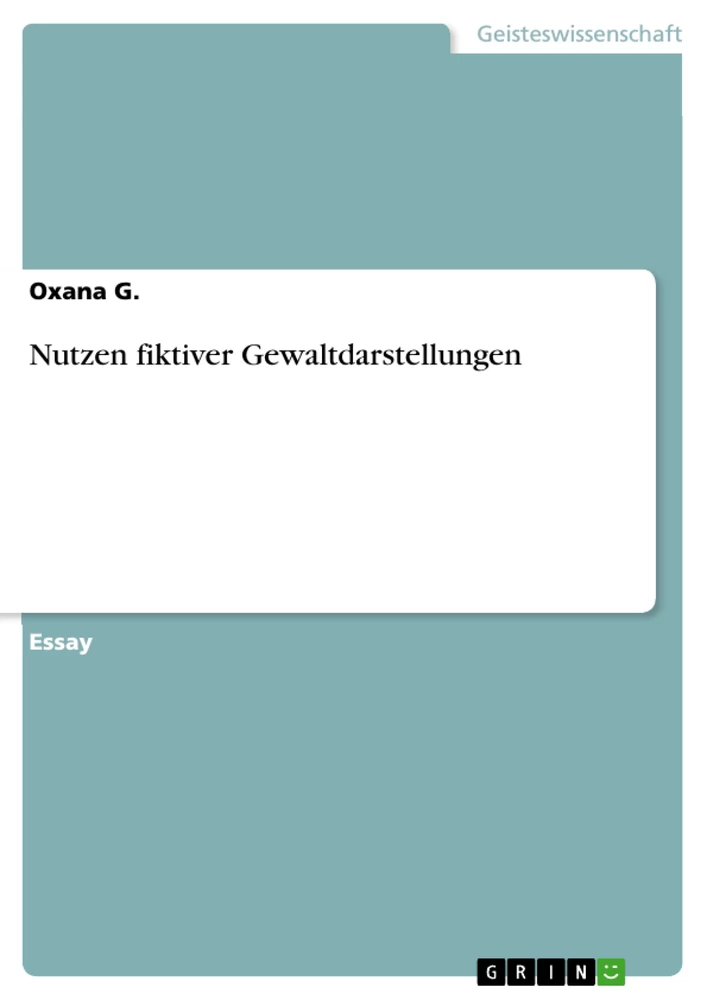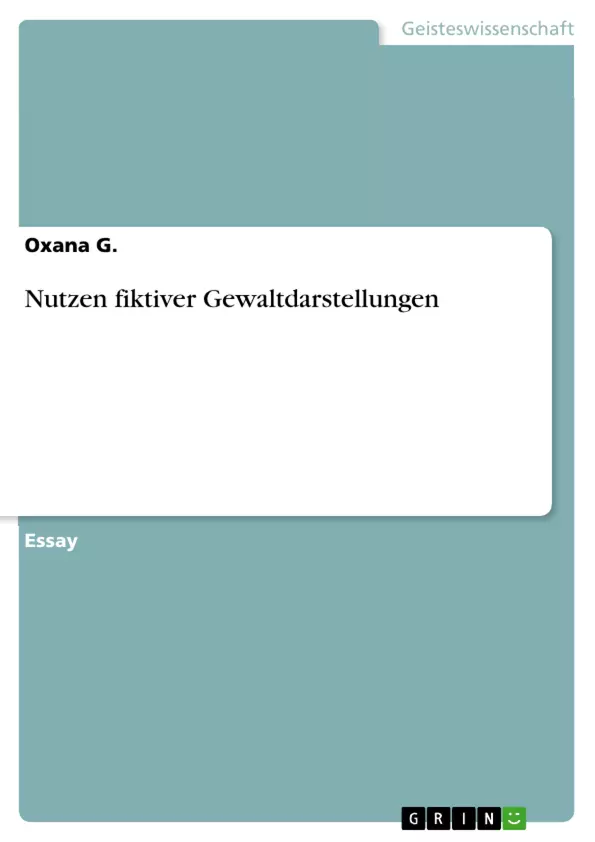Die Medienwirkungsforschung beschäftigt sich seit langem mit Effekten, die Gewaltdarstellungen zum Beispiel in Filmen oder Computerspielen bei ihren Rezipienten bewirken. Je nach Inhalt, Realitätsnähe, aber auch der Persönlichkeit der Konsumenten und den situativen Bedingungen während und nach dem Medienkonsum wird die Wirkung untersucht. Oft werden gewalthaltige Szenarien als schlechter Einflussfaktor, als Gefahr für die geistige und körperliche Entwicklung vor allem Jugendlicher betrachtet, doch bedarf es der genauen Klärung des Bedürfnisses in einer Gesellschaft nach Gewaltszenen und der Faszination der Zuschauer an diesen. Warum kann es einer Person Vergnügen bereiten zu sehen, wie Menschen sterben oder gefoltert werden? Diese Arbeit wird verschiedene Theorien angehen, insbesondere aber die Sichtweisen von Thomas Hausmanninger und einige Erklärungen des Phänomens aus der Wirkungsforschung.
Inhaltsverzeichnis
- Nutzen medialer Gewaltdarstellungen
- Die Wahrnehmung hilft einem sich im Alltag zurechtzufinden.
- Vor allem in Filmen wird man nicht mit der realen Gewalt, sondern mit ihrer fiktiven Darstellung konfrontiert.
- Aus den oben genannten Überlegungen folgt, dass alle vier Ebenen miteinander verbunden und deshalb auch meistens gleichzeitig aktiv sind.
- Neben der Erklärung von Hausmanninger für das mögliche Nutzen des Gewaltkonsums existieren noch unzählige andere Theorien.
- Es reicht nicht zu behaupten, dass gewalthaltige Szenen nur dann wirken, wenn sie besonders brutal sind, denn sie bekommen einen individuellen Sinn durch ihre Nähe zu den Erfahrungen des Rezipienten.
- Die Gewalt kann aber nicht nur zum Gefühlsmanagement beitragen, sondern auch soziale Identität sichern.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die möglichen Vorteile der Rezeption medialer Gewaltdarstellungen, insbesondere in Filmen. Sie analysiert, warum Menschen, trotz der negativen Folgen von realer Gewalt, Gefallen daran finden, fiktive Gewaltdarstellungen zu konsumieren.
- Theoretische Erklärungen für das Vergnügen am Konsum von medialer Gewalt
- Die Rolle von Emotionen, Kognition und Reflexion bei der Wahrnehmung von Gewalt
- Die Verbindung von Sensomotorik und emotionaler Reaktionen auf mediale Gewaltdarstellungen
- Die Bedeutung der Dramaturgie und des narrativen Kontextes
- Das Bedürfnis nach Gewaltverarbeitung und -kompensierung im Alltag
Zusammenfassung der Kapitel
- Nutzen medialer Gewaltdarstellungen: Diese Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und beleuchtet die allgegenwärtige Präsenz von Gewalt in der Gesellschaft, während gleichzeitig das Interesse an fiktiven Gewaltdarstellungen in den Medien betrachtet wird.
- Die Wahrnehmung hilft einem sich im Alltag zurechtzufinden.: Dieser Abschnitt befasst sich mit der menschlichen Wahrnehmung und deren Nutzen im Alltag. Es wird argumentiert, dass selbst scheinbar zwecklose Wahrnehmungen, wie das Betrachten von Kunst, eine Funktion erfüllen und eine Form von ästhetischem Vergnügen hervorrufen können.
- Vor allem in Filmen wird man nicht mit der realen Gewalt, sondern mit ihrer fiktiven Darstellung konfrontiert.: Dieser Abschnitt befasst sich mit der besonderen Form der Gewaltdarstellung in Filmen und betont den künstlichen Charakter dieser Inszenierungen. Er beleuchtet den Einfluss von Faktoren wie Dramaturgie, Musik und Geräusche auf die Wirkung von Gewaltszenen auf den Zuschauer.
- Aus den oben genannten Überlegungen folgt, dass alle vier Ebenen miteinander verbunden und deshalb auch meistens gleichzeitig aktiv sind.: Dieser Abschnitt fasst die vier Ebenen des ästhetischen Ich-Vergnügens zusammen und verdeutlicht ihre enge Verknüpfung. Er argumentiert, dass die Kombination dieser Ebenen zu einem ästhetischen Vergnügen beim Konsum von Gewaltdarstellungen führen kann.
- Neben der Erklärung von Hausmanninger für das mögliche Nutzen des Gewaltkonsums existieren noch unzählige andere Theorien.: Dieser Abschnitt stellt verschiedene Theorien zur Erklärung des Gewaltkonsums vor, insbesondere die Dimensionen der Wiederbelebung und Verarbeitung von Alltagserfahrungen sowie die Sicherung sozialer Identität.
- Es reicht nicht zu behaupten, dass gewalthaltige Szenen nur dann wirken, wenn sie besonders brutal sind, denn sie bekommen einen individuellen Sinn durch ihre Nähe zu den Erfahrungen des Rezipienten.: Dieser Abschnitt behandelt die individuellen Bedeutungen, die Gewaltdarstellungen für den Zuschauer erhalten. Es werden die kontrastiv-konfrontierende und die analogisch-kompensierende Wirkung von Gewaltdarstellungen im Bezug auf alltägliche Erfahrungen erläutert.
- Die Gewalt kann aber nicht nur zum Gefühlsmanagement beitragen, sondern auch soziale Identität sichern.: Dieser Abschnitt befasst sich mit der sozialen Funktion von medialer Gewalt und argumentiert, dass sie zur Identitätsbildung und zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls beitragen kann, insbesondere in Jugendgruppen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Nutzen medialer Gewaltdarstellungen, insbesondere in Filmen. Sie analysiert die Funktionslust, die der Konsum von fiktiver Gewalt hervorrufen kann, sowie die psychologischen und sozialen Aspekte des Gewaltkonsums. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: ästhetisches Vergnügen, Sensomotorik, Kognition, Reflexion, Dramaturgie, Gefühlsmanagement, soziale Identität, Jugendkultur, Kontrastiv-Konfrontation, Analogisch-Kompensation.
Häufig gestellte Fragen
Warum empfinden Menschen Vergnügen beim Betrachten fiktiver Gewalt?
Dies wird oft durch das „ästhetische Ich-Vergnügen“ erklärt, bei dem Sensomotorik, Emotionen, Kognition und Reflexion zusammenwirken, um eine kontrollierte Form der Faszination zu erzeugen.
Wie unterscheidet sich fiktive Gewalt in Filmen von realer Gewalt?
In Filmen ist Gewalt eine künstliche Inszenierung, die durch Dramaturgie, Musik und Schnitt gerahmt wird. Der Zuschauer weiß um den fiktiven Charakter, was den „wohligen Schauer“ erst ermöglicht.
Was bedeutet „Gefühlsmanagement“ durch Medienkonsum?
Rezipienten nutzen gewalthaltige Medien oft, um eigene Alltagserfahrungen zu verarbeiten, Spannungen abzubauen oder Emotionen in einem sicheren Rahmen zu erleben (Kompensation).
Können Gewaltdarstellungen zur sozialen Identität beitragen?
Ja, insbesondere in Jugendgruppen kann der gemeinsame Konsum und Austausch über bestimmte Filme oder Spiele das Gemeinschaftsgefühl stärken und zur Identitätsbildung beitragen.
Was ist die „Analogisch-Kompensation“ in der Wirkungsforschung?
Dabei erhalten Gewaltszenen einen individuellen Sinn, indem sie eine Nähe zu den persönlichen Erfahrungen des Rezipienten herstellen und ihm helfen, diese indirekt zu bewältigen.
Welche Rolle spielt die Dramaturgie bei der Wahrnehmung von Gewalt?
Die Dramaturgie bestimmt, ob Gewalt als gerechtfertigt, abschreckend oder unterhaltend wahrgenommen wird. Sie steuert die emotionale Reaktion des Zuschauers maßgeblich.
- Citar trabajo
- Oxana G. (Autor), 2011, Nutzen fiktiver Gewaltdarstellungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171983