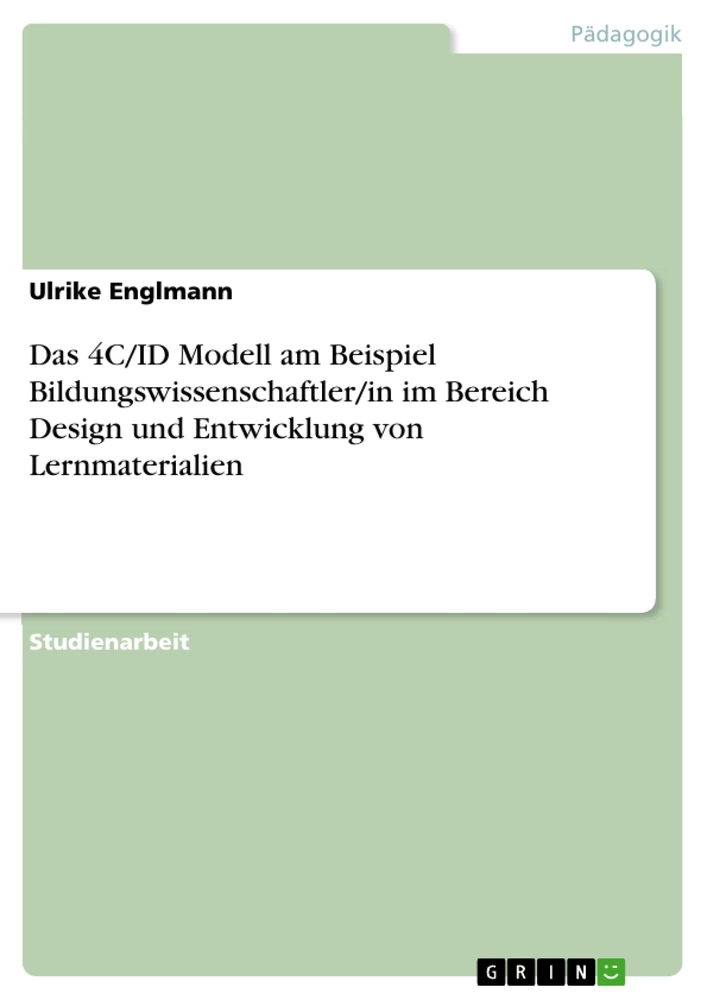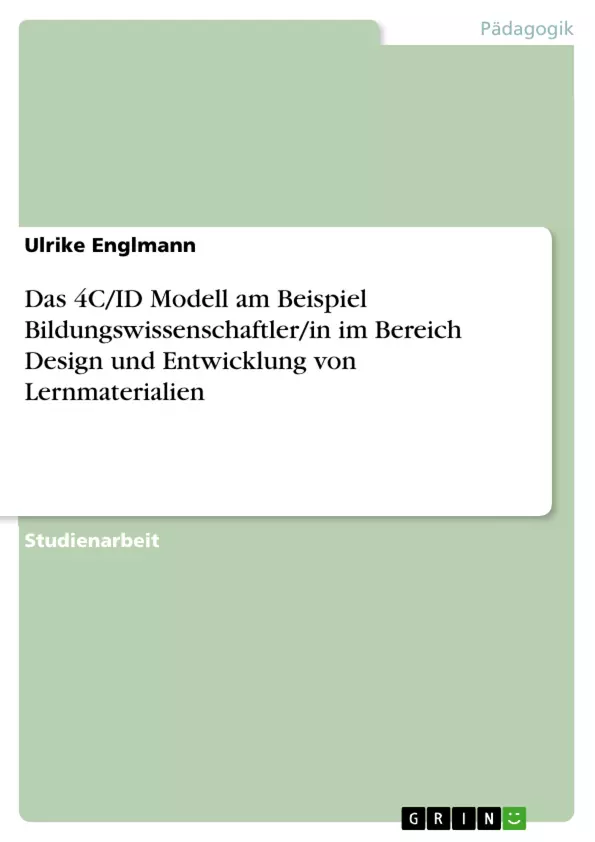Die zunehmende Globalisierung und die damit verbundene strukturelle Veränderung der westlichen Industriegesellschaften lässt den Bedarf an Erwerb von Wissen stetig steigen. Die Lernenden sehen sich mit steigenden Anfor- derungen konfrontiert. Vorliegende Arbeit soll am Beispiel eines „Bildungswissenschaftlers im Bereich Design und Entwicklung von Lernmaterialien“ zeigen, wie anhand des 4C/ID Modells komplexe kognitive Fähigkeiten erfolgreich erlernt werden können. Das Vier-Komponenten-Instruktionsdesign-Modell (four-component instructional design model), kurz 4C/ID Modell, wurde 1997 von Van Merriënboer vorgestellt. Die Komponenten des Modells werden beispielhaft an o.g. Berufsbild erläutert, wobei ein sogenannter Blueprint (Lehrplanentwurf) erstellt wird. Moderne Instruktionsdesigns orientieren sich an der Alltagsrealität und vermitteln anwendbares Wissen, indem sie zur Wissensvermittlung authentische Lernumgebungen schaffen. Das Lernen erfolgt hier kompetenzbasiert in realitätsnahen, authentischen Kontexten innerhalb einer sehr komplexen Umgebung, in der der Lernende aktiv Handlungswissen erwirbt (Bastiaens, Deimann, Schrader & Orth, 2010). Im theoretischen Teil der Arbeit wird der lerntheoretische Bezugsrahmen des 4C/ID Modells erläutert und ein abschließendes Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das 4C/ID Modell am Beispiel eines Bildungswissenschaftlers im Bereich Design und Entwicklung von Lernmaterialien
- Kompetenzanalyse
- Aufgabenklassen
- Lernaufgaben
- Unterstützende Informationen
- Just-in-time Informationen
- Das 4C/ID Modell im Kontext mediendidaktischer Überlegungen
- Lerntheoretischer Bezug
- Aspekte situierten Lernens
- Didaktische Szenarien
- Unterstützende Medien
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem 4C/ID Modell und zeigt am Beispiel eines Bildungswissenschaftlers im Bereich Design und Entwicklung von Lernmaterialien, wie komplexe kognitive Fähigkeiten mithilfe dieses Modells erfolgreich erlernt werden können.
- Das 4C/ID Modell als Ansatz für die Entwicklung von Lernmaterialien
- Komponenten des 4C/ID Modells: Ganzheitliche, authentische Aufgaben, unterstützende Informationen, Just-in-time Informationen, und Part-task Practice
- Die Bedeutung des 4C/ID Modells im Kontext mediendidaktischer Überlegungen
- Anwendung des 4C/ID Modells zur Kompetenzentwicklung im Bereich Design und Entwicklung von Lernmaterialien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz des 4C/ID Modells für die erfolgreiche Kompetenzentwicklung dar. Kapitel 2 beleuchtet das 4C/ID Modell anhand eines Beispiels für den Bereich Design und Entwicklung von Lernmaterialien. Dabei werden die einzelnen Komponenten des Modells (Kompetenzanalyse, Aufgabenklassen, Lernaufgaben, unterstützende Informationen, Just-in-time Informationen) näher erläutert.
Kapitel 3 widmet sich dem 4C/ID Modell im Kontext mediendidaktischer Überlegungen. Hier werden der lerntheoretische Bezug, Aspekte situierten Lernens, didaktische Szenarien und unterstützende Medien im Zusammenhang mit dem Modell dargestellt.
Schlüsselwörter
4C/ID Modell, Instruktionsdesign, komplexes Lernen, Kompetenzanalyse, Aufgabenklassen, Lernaufgaben, unterstützende Informationen, Just-in-time Informationen, mediendidaktische Überlegungen, situiertes Lernen, Kompetenzentwicklung, Design und Entwicklung von Lernmaterialien, Bildungswissenschaftler.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das 4C/ID Modell?
Das Vier-Komponenten-Instruktionsdesign-Modell dient der Entwicklung von Lernumgebungen für das Erlernen komplexer kognitiver Fähigkeiten.
Welche vier Komponenten umfasst das Modell?
Das Modell besteht aus Lernaufgaben (authentische Aufgaben), unterstützenden Informationen, Just-in-time-Informationen und Part-task Practice.
Was ist ein „Blueprint“ im 4C/ID Modell?
Ein Blueprint ist ein detaillierter Lehrplanentwurf, der die Aufgabenklassen und die notwendigen Informationen für den Kompetenzerwerb strukturiert.
Wie wird das Modell für Bildungswissenschaftler angewendet?
Die Arbeit zeigt beispielhaft, wie ein Bildungswissenschaftler das Design und die Entwicklung von Lernmaterialien mithilfe dieses Modells erlernen kann.
Welche Rolle spielt das „situierte Lernen“?
Das Modell basiert auf dem situierten Lernen, indem es authentische, realitätsnahe Kontexte schafft, in denen Lernende aktiv Handlungswissen erwerben.
- Quote paper
- Ulrike Englmann (Author), 2011, Das 4C/ID Modell am Beispiel Bildungswissenschaftler/in im Bereich Design und Entwicklung von Lernmaterialien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172030