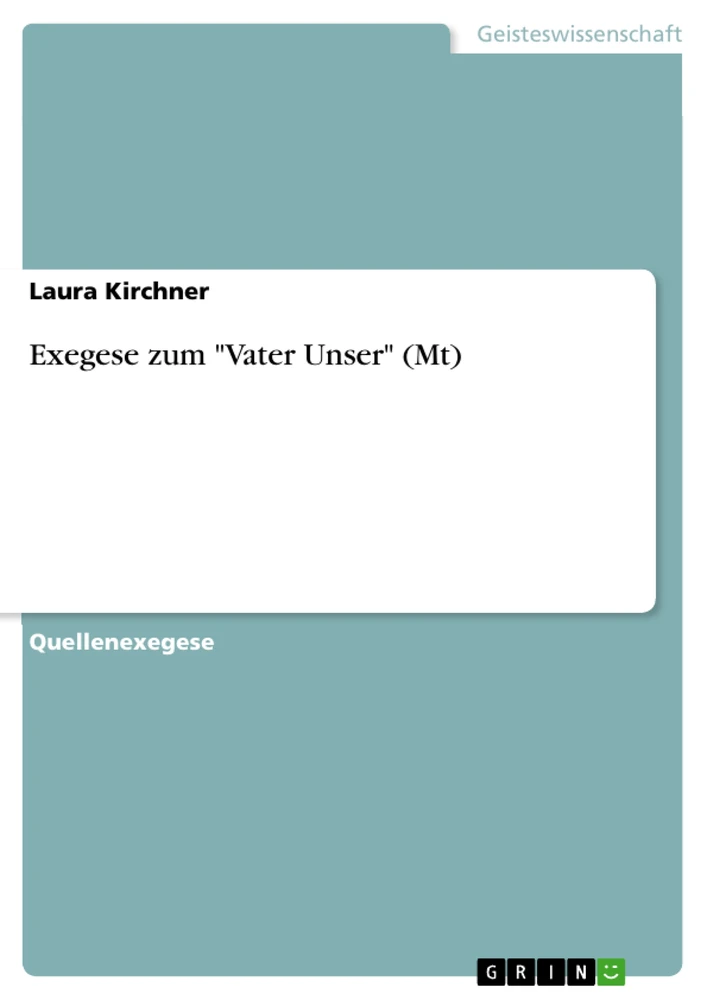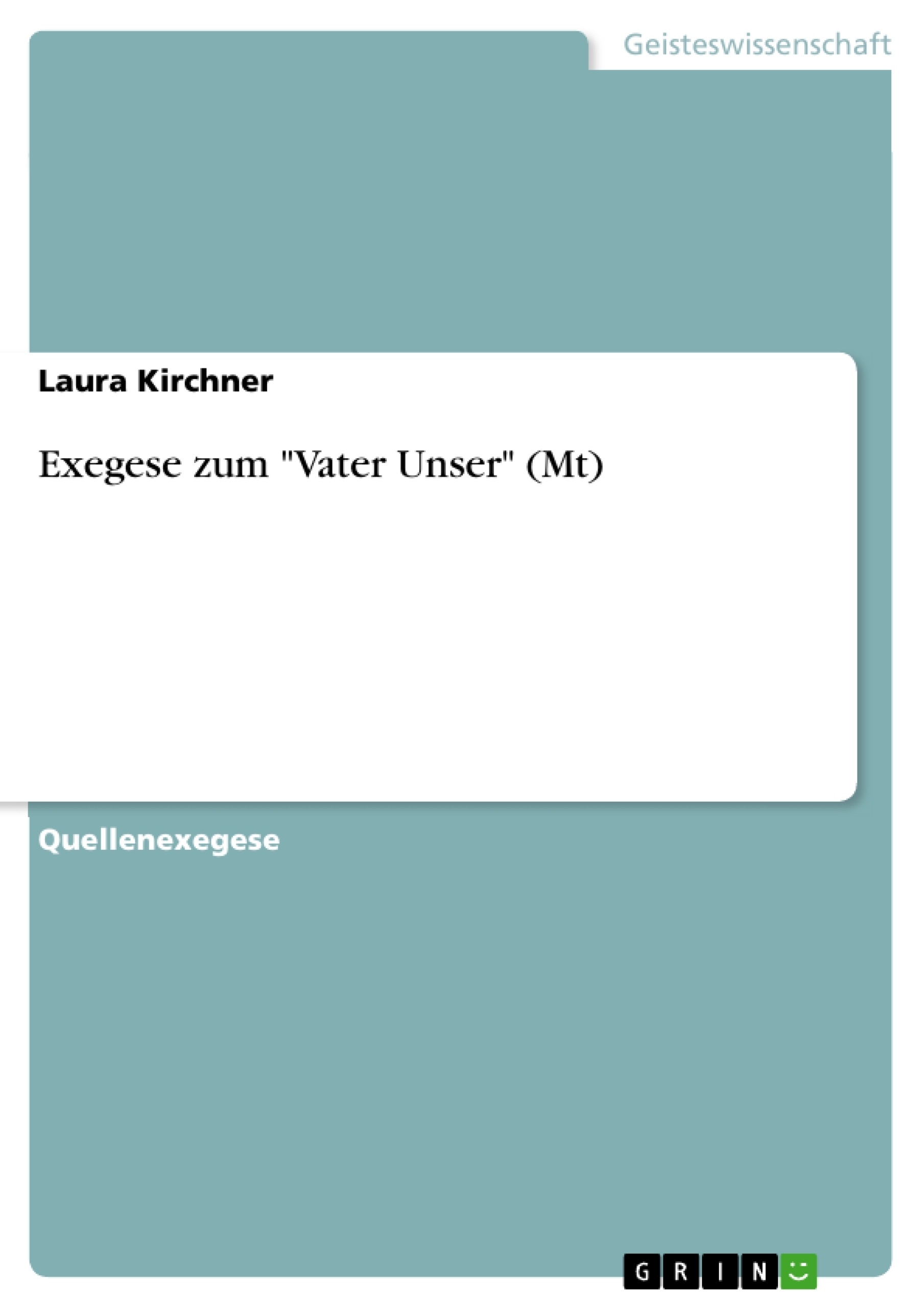Die hier vorliegende historisch- kritische Exegese beschäftigt sich mit dem Vater Unser (Mt 6,9-13). Ansatzweise wird die anschließende Doxologie angesprochen, diese bleibt jedoch im Hintergrund. Das Bittgebet1 an sich ist mir in meinen bisherigen Lebensjahren sehr vertraut geworden. Sobald ich jedoch versuchte, mir inhaltlich über die Zusammenhänge klar zu werden, empfand ich es als fremd. Immer wieder fragte ich mich, was hinter den Bitten steht. Die dabei aufkommenden Fragen blieben bisher unbeantwortet. In einer Vorlesung über Jesus von Nazareth an der TU Braunschweig bei Hr. Prof. Wehnert habe ich erste, inhaltlich und vertiefende Zugänge zu dem Gebet gefunden. Aber auch dort war die Zeit nicht gegeben, um sich näher mit dem Gebet, was zentral im christlichen Glauben verankert ist, zu beschäftigen. An dieser Stelle möchte ich nun die Chance nutzen, das Gebet nach seinem damaligen Verständnis, seiner Bedeutung und Aussagekraft zu untersuchen.
Zwar gibt es das Vater Unser, auch Unservater genannt, ebenfalls bei Lukas (Lk 11,2-4), ich habe mich aber für die matthäische Form entschieden. Die Entscheidung wurzelt darin, dass mir diese Form gegenwärtiger ist und in der liturgischen Form auch stärkeren Anklang gefunden hat.[...]
3. Literarkritik / Quellenkritik
Das Vater Unser kommt, wie bereits erwähnt, in den synoptischen Evangelien zwei Mal vor: Lk 11,2-4 und Mt 6,9-13. Markus hat das Bittgebet nicht, weist aber in der Getsemani Perikope durch Logien Vergleichbarkeiten auf. Außerdem ist das Vater Unser auch in der Did 8,2 f. zu finden und ähnelt dabei der matthäischen Form.14
Das synoptische Problem ist in der Wissenschaft mit diversen Hypothesen versucht worden zu lösen. An dieser Stelle soll ein eine knappe Erläuterung der Benutzungshypothese angeführt werden.
[...]
6. Religionsgeschichtlicher Vergleich
Das Vater Unser weist vor allem zu zwei jüdischen Gebeten Ähnlichkeiten auf. Ich werde in diesem Schritt zunächst das Vater Unser mit dem Qaddisch vergleichen. Danach soll ein Vergleich zu dem Schemone-Esre erfolgen.[...]
9. Gesamtinterpretation und Stellungnahme
Die Anrede
Vater bedeutet auf aramäisch abba.65 Dieses abba kann je nach Artikulation als familiärer Papa, aber auch als mein Vater verstanden werden. Letzteres ist in dem uns vorliegenden Kontext der Fall. Die unverwechselbare Anrede mit Vater offenbart sich erst später, in der Zeit, als die Christen griechisch sprachen, die das aramäische abba übernahmen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzungsvergleich
- Vergleich der Übersetzungen
- Begründung der Übersetzungsauswahl
- Textanalyse
- Literarkritik / Quellenkritik
- Formkritik/Formgeschichte
- Traditionsgeschichte
- Religionsgeschichtlicher Vergleich
- Redaktionskritik / Redaktionsgeschichte
- Pragmatische Analyse
- Gesamtinterpretation und Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende exegetische Arbeit befasst sich mit dem Vater Unser (Mt 6,9-13) und untersucht seine Bedeutung im Kontext des christlichen Glaubens. Ziel ist es, das Gebet in seinem damaligen Verständnis zu beleuchten und seine Aussagekraft im Hinblick auf die christlichen Lebensführung zu erforschen.
- Untersuchung des Vater Unser in seiner historischen und literarischen Kontext
- Analyse der sprachlichen Struktur und der theologischen Inhalte des Gebets
- Bedeutung des Gebets für die christliche Praxis
- Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen
- Zusammenhang des Vater Unser mit anderen christlichen Traditionen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Vater Unser als Gegenstand der Untersuchung vor und skizziert den Forschungsstand.
- Übersetzungsvergleich: Dieses Kapitel vergleicht verschiedene Übersetzungen des Vater Unser, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der sprachlichen Darstellung aufzuzeigen. Es werden exemplarisch drei Verse des Gebets analysiert.
- Textanalyse: Dieses Kapitel analysiert die Struktur des Vater Unser im Kontext der Bergpredigt. Es werden die einzelnen Bitten des Gebets untersucht und ihre Bedeutung in Bezug auf den jüdischen und christlichen Kontext beleuchtet.
- Literarkritik / Quellenkritik: Dieses Kapitel betrachtet die literarische und sprachliche Form des Vater Unser und analysiert seine Quellen.
- Formkritik/Formgeschichte: Dieses Kapitel untersucht die Form des Vater Unser in Bezug auf die Gattungsgeschichte des Gebets.
- Traditionsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Vater Unser in der christlichen Tradition und zeigt, wie das Gebet in verschiedenen Epochen und Kulturen interpretiert wurde.
- Religionsgeschichtlicher Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht das Vater Unser mit anderen Gebeten aus verschiedenen Religionen und Kulturen.
- Redaktionskritik / Redaktionsgeschichte: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung des Vater Unser im Kontext der Evangelien und analysiert die Rolle der Redakteure.
- Pragmatische Analyse: Dieses Kapitel untersucht die praktische Anwendung des Vater Unser im christlichen Leben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Vater Unser, Bergpredigt, Matthäus-Evangelium, Textanalyse, Übersetzungsvergleich, Bibelübersetzung, Liturgie, christlicher Glaube, Gebet, Eschatologie, jüdische Tradition, christliche Tradition.
- Citation du texte
- Laura Kirchner (Auteur), 2011, Exegese zum "Vater Unser" (Mt), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172063