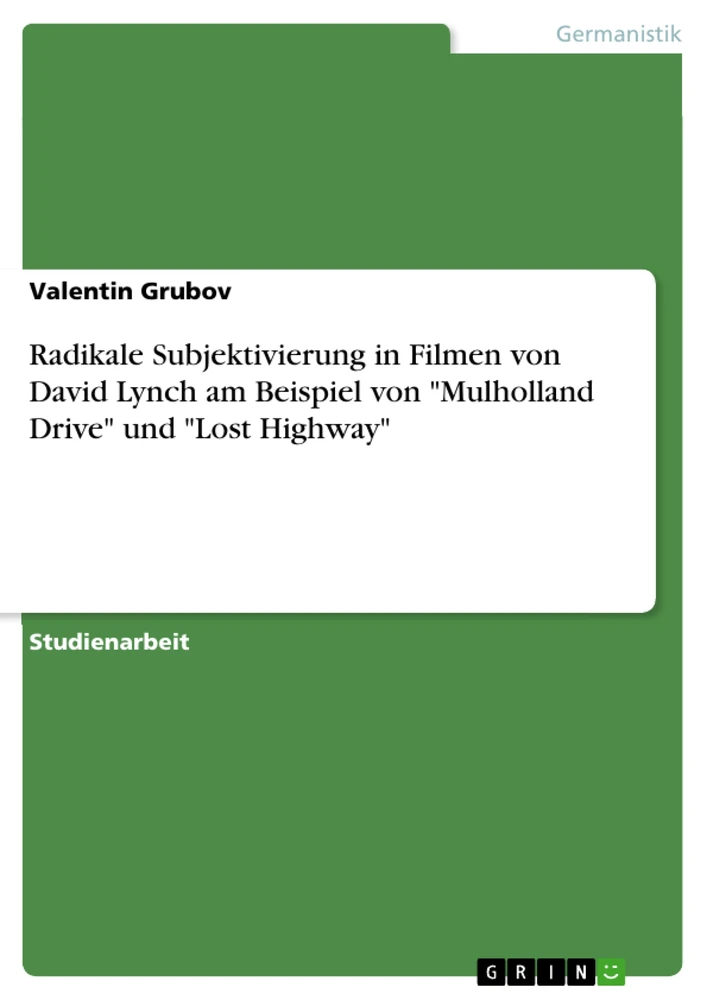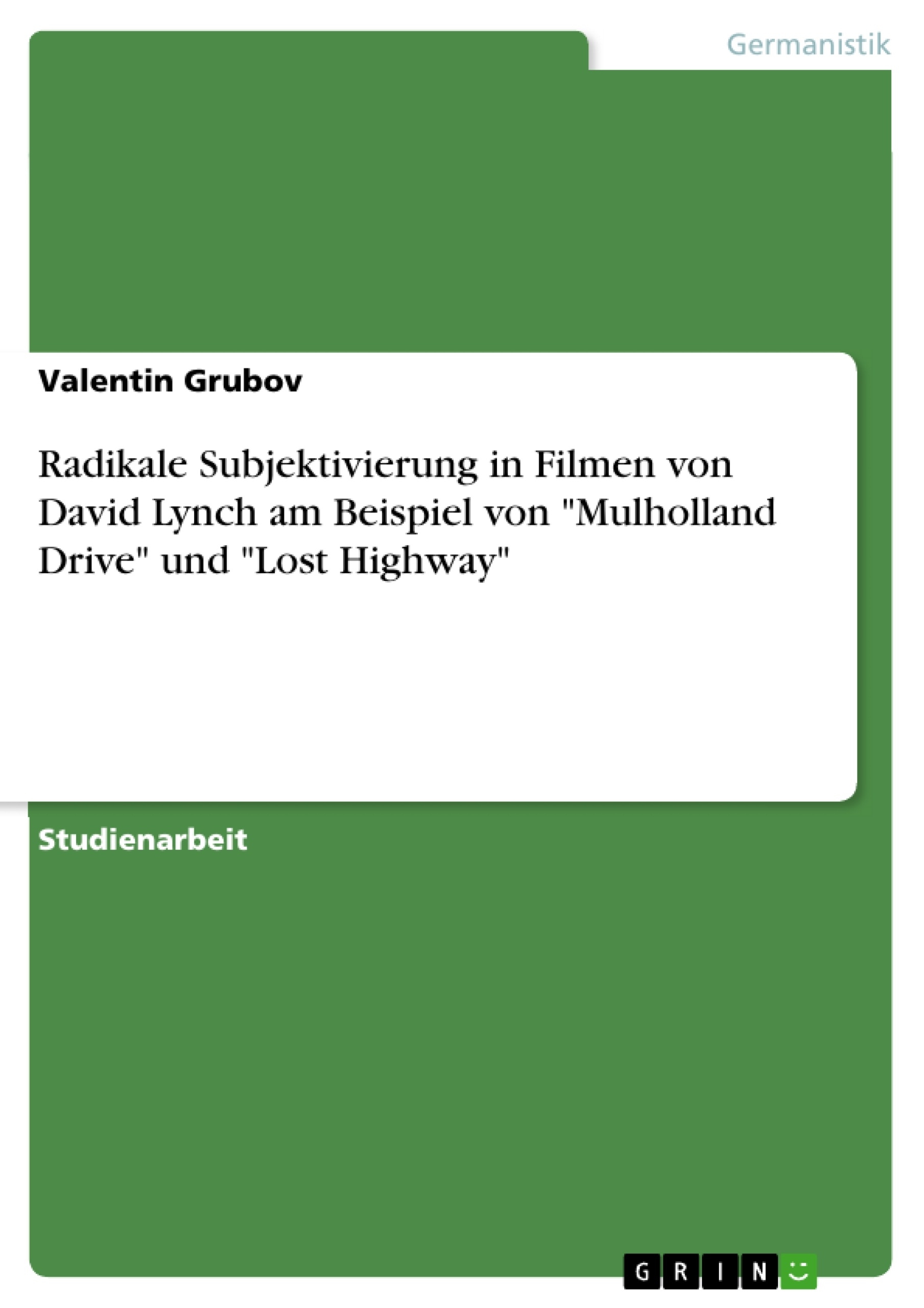Wirklichkeit und Illusion, Normalität und ihre dunklen Abgründe – zwei Leitfäden, die die meisten Filme von David Lynch immer wieder durchziehen. Geplagt von psychischen Problemen begeben sich seine Protagonisten auf eine oft imaginäre Reise, sie betreten ein Möbiusband und kehren nie wieder zurück. Die Handlungsperspektive, die den Zuschauern dabei präsentiert wird, ist subjektiv und somit irritierend und paradox. Auf diese Weise ermöglicht sie einen Einblick in die psychischen Vorgänge der Protagonisten.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Analyse von Subjektivierungsverfahren, die in Lynchs Filmen MULHOLLAND DRIVE und LOST HIGHWAY verwendet werden. Daraufhin möchte ich zunächst auf das Motiv der psychischen Abweichungen in Filmen eingehen, wobei ein besonderes Interesse auf den Film noir gerichtet wird. Im Folgenden beschäftige ich mich mit dem Begriff der Subjektivierung bzw. mit den subjektivierenden Gestaltungsmitteln, die für die Visualisierung v.a. des mentalen Vorgangs der Figur verwendet werden.
Abschließend beabsichtige ich auf das Phänomen der radikalen Subjektivierung bei Lynch einzugehen und anhand von zwei seiner Filme, LOST HIGHWAY und MULHOLLAND DRIVE, es näher zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zwischen Wirklichkeit und Wahn
- Subjektivierung im Film
- Radikale Subjektivierung in Filmen von David Lynch
- „Lost Highway“
- „Mulholland Drive“
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Subjektivierungsverfahren in David Lynchs Filmen "MULHOLLAND DRIVE" und "LOST HIGHWAY". Sie beleuchtet das Motiv der psychischen Abweichungen in Filmen, insbesondere im Film noir, und untersucht den Begriff der Subjektivierung und ihre Gestaltungsmittel. Schließlich betrachtet die Arbeit das Phänomen der radikalen Subjektivierung bei Lynch.
- Psychische Abweichungen im Film noir
- Subjektivierungsverfahren im Film
- Radikale Subjektivierung bei David Lynch
- Analyse von "Lost Highway" und "Mulholland Drive"
- Verbindung zwischen subjektiver Perspektive und psychischen Vorgängen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Themen der Arbeit vor, die sich mit der Analyse von Subjektivierungsverfahren in David Lynchs Filmen "MULHOLLAND DRIVE" und "LOST HIGHWAY" beschäftigt. Sie erläutert die zentralen Motive der Arbeit, wie die psychischen Abweichungen in Filmen, insbesondere im Film noir, und die Bedeutung der Subjektivierung für die Darstellung mentaler Prozesse.
2. Zwischen Wirklichkeit und Wahn
Dieses Kapitel beleuchtet das Motiv der psychischen Störungen in Filmen und fokussiert dabei auf den Film noir. Es werden verschiedene Filmbeispiele genannt, die dieses Motiv aufgreifen, und die Entwicklung des Film noir mit seinen drei Hauptphasen (Romantik, Entfremdung und Obsession) dargestellt. Das Kapitel zeigt die Bedeutung von Träumen und Visionen im Film noir auf und erläutert deren Funktion als Mittel zur Darstellung seelischer Vorgänge und psychischer Belastungen der Protagonisten.
3. Subjektivierung im Film
Das Kapitel definiert den Begriff der Subjektivierung und erläutert, wie sie durch verschiedene filmische Mittel dargestellt werden kann. Es werden Methoden wie die subjektive Kamera, Voice-over, Flashbacks und visuelle Effekte vorgestellt und ihre Bedeutung für die Erzeugung einer subjektiven Perspektive im Film dargestellt. Der amerikanische Filmwissenschaftler Bruce Kawin und seine Kategorien "Voice-over eines Ich-Erzählers", "subjektive Sicht einer diegetischen Figur (physischer Point of View)" und "Visualisierung der Gedanken einer Figur" werden ebenfalls erwähnt. Das Kapitel beleuchtet auch die Verwendung von Träumen und Visionen im Film noir als Mittel zur Erzeugung narrativer Subjektivierung.
Schlüsselwörter
Film noir, Subjektivierung, psychische Abweichungen, David Lynch, "Lost Highway", "Mulholland Drive", Träume, Visionen, Filmsprache, narrative Subjektivierung, subjektive Kamera, Voice-over, Flashbacks, visuelle Effekte.
Häufig gestellte Fragen
Welche Filme von David Lynch werden in dieser Arbeit analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Filme „Mulholland Drive“ und „Lost Highway“.
Was versteht man unter „radikaler Subjektivierung“ bei Lynch?
Es beschreibt eine Erzählweise, bei der die filmische Realität vollständig mit der (oft gestörten) Wahrnehmung, den Träumen oder Wahnvorstellungen der Protagonisten verschmilzt.
Welche filmischen Mittel erzeugen diese subjektive Perspektive?
Lynch nutzt Techniken wie die subjektive Kamera (Point of View), Voice-over, Flashbacks, visuelle Verfremdungen und eine komplexe Tonebene, um mentale Vorgänge zu visualisieren.
Welche Rolle spielt der „Film noir“ für Lynchs Werk?
Die Arbeit zeigt auf, wie Lynch Motive des Film noir – wie psychische Abweichungen, Obsessionen und die Grenze zwischen Wirklichkeit und Wahn – aufgreift und modernisiert.
Wie wirken Lynchs Filme auf den Zuschauer?
Durch die paradoxe und irritierende Handlungsperspektive wird der Zuschauer gezwungen, die filmische Realität selbst zu hinterfragen, was oft ein Gefühl von Unbehagen oder Rätselhaftigkeit erzeugt.
- Quote paper
- Valentin Grubov (Author), 2011, Radikale Subjektivierung in Filmen von David Lynch am Beispiel von "Mulholland Drive" und "Lost Highway", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172281