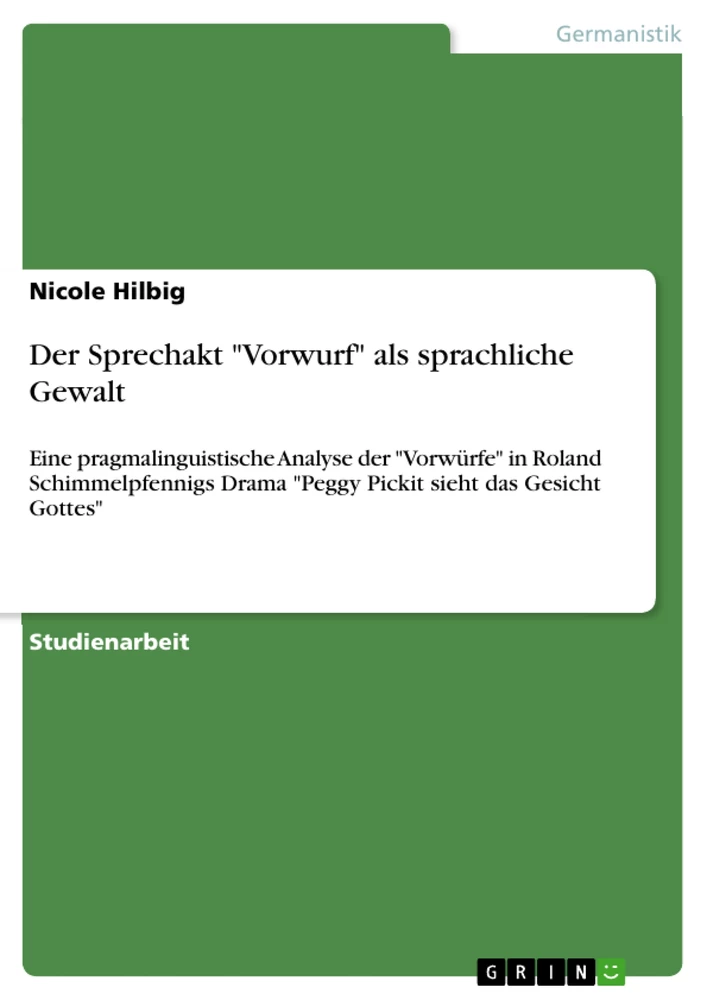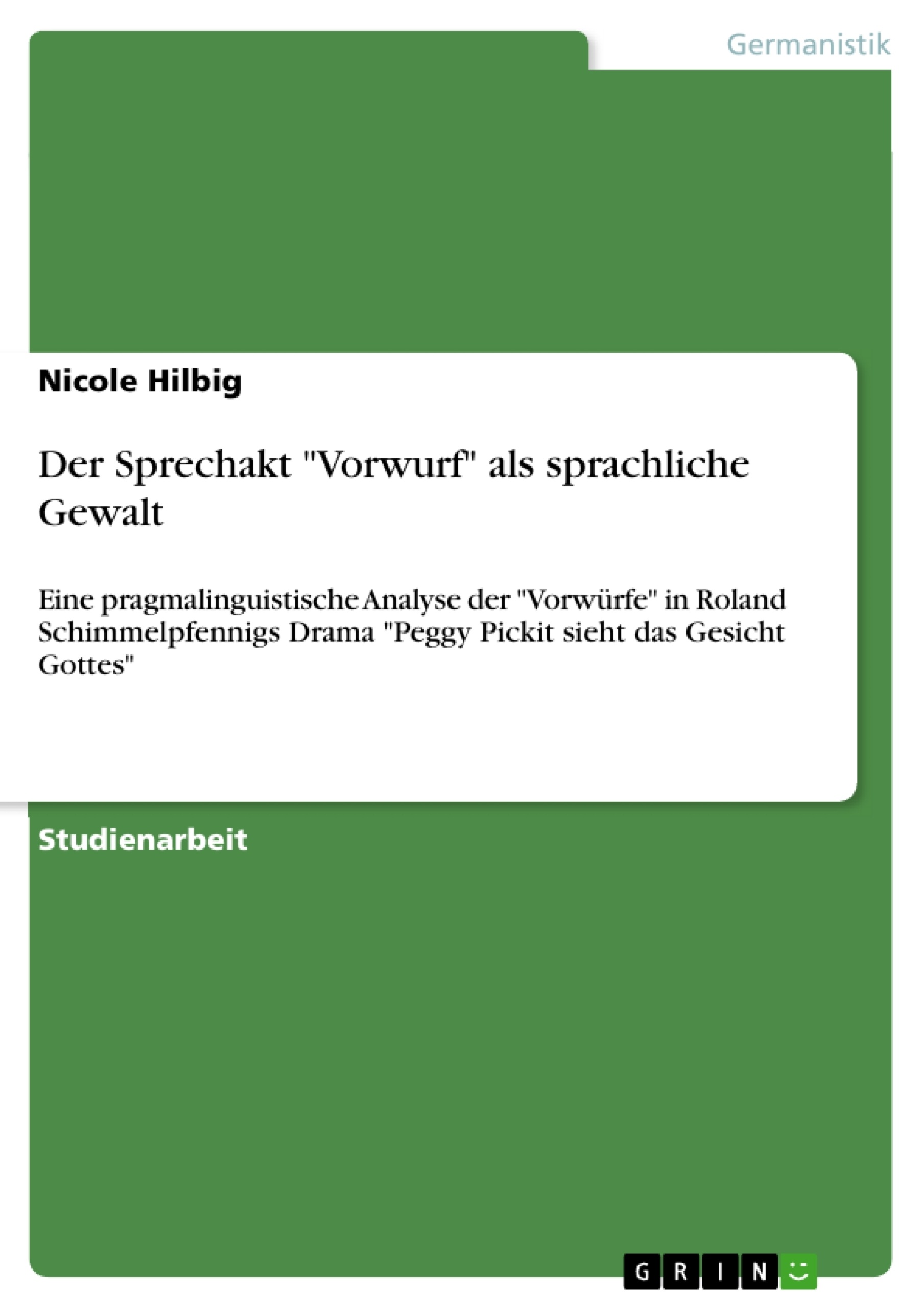Sprachliche Gewalt im freundschaftlichen Umkreis ist in ein Beziehungs- und Handlungssystem eingebettet, das dem der familialen Interaktion sehr ähnlich ist. Besonders die konfliktären Situationen erreichen eine innerspezifische Problematik, die auf Grund der engen Bindung der einzelnen Personen in diesem Beziehungskonstrukt nur schwer bzw. langsam wieder geklärt und aufgelöst werden können.
Mit dem Sprechakt des „Vorwurfs“ ist ein Phänomen angesprochen, das häufig in dieser engen freundschaftlichen Konstellation eine Eskalation bewirkt, was auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches zeigt. Doch aufgrund der tiefen Gefühlsbindung ist ein vorwurfsvoller Ausbruch noch gewaltiger und ´verletzender´ als es andere Sprechakte aufweisen.
Mein Interesse liegt besonders in der sprachlichen Entwicklung des vorwurfsvollen Ausbruchs innerhalb einer engen Freundschaft. Ich möchte zeigen, welche Auswirkungen das Gesagte bzw. die sprachliche Gewalt in solch einer intimen bzw. freundschaftlichen Konstellation hat. Als Analyse-Beispiel habe ich das Theaterstück „Peggy Pickit sieht das Gesicht Gottes“ von Roland Schimmelpfennig ausgewählt, weil hieran, meiner Meinung nach, diese Entwicklung besonders gut veranschaulicht werden kann, dessen Anliegen mein Schwerpunkt in der vorliegenden Arbeit sein soll.
Inhaltsverzeichnis
- Die Bedeutung des „Vorwurfs“ in Interaktionen
- Sprache als Möglichkeit der Gewaltausübung
- Die Einordnung des „Vorwurfs“ in die Sprechakttheorie
- Die Grundbegriffe der Sprechakttheorie in der Pragmatik
- Der Vorwurf als Sprechakt
- Sprechakte als sprachliche Gewalt
- Imageverletzung und Höflichkeit
- der Sprechakt „Vorwurf“ als sprachliche Gewalt
- Bedingungen bzw. Voraussetzungen und Sprecherwartungen
- Formen vorwurfsvoller Sprache und mögliche Reaktionen
- Auswirkungen sprachlicher Gewalt in Form einer „Vorwurf“-Eskalation
- Der Freundeskreis als besonderes psychologisches Umfeld
- Die pragmalinguistische Analyse der „Vorwürfe“ in Roland Schimmelpfennigs Drama „Peggy Pickit“
- Vorbereitungen zur pragmalinguistischen Analyse
- Zweck und Aufgabe der Dramen-Analyse
- Inhaltliche Vorbemerkung zum Drama
- Thematischer und inhaltlicher Zusammenhang der Vorwürfe
- Stufe 1: Überspielen der Unsicherheit
- Stufe 2: Unterdrückung der emotionalen Wahrheit
- Stufe 3: Entwicklung der inneren Aggression
- Stufe 4: Ekstatischer Ausbruch
- Vorbereitungen zur pragmalinguistischen Analyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Sprechakt „Vorwurf“ im Kontext freundschaftlicher Beziehungen und beleuchtet dessen potenzielles Gewaltpotenzial. Ziel ist es, die sprachliche Gewalt des Vorwurfs zu analysieren und deren Auswirkungen auf den Empfänger zu erforschen. Hierfür wird die Sprechakttheorie herangezogen, die es ermöglicht, den Vorwurf als sprachlichen Akt zu verstehen und dessen potenzielle Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Sprecher und Empfänger zu analysieren.
- Die Rolle von Sprache in der Ausübung von Gewalt
- Der Sprechakt „Vorwurf“ im Rahmen der Sprechakttheorie
- Die Auswirkungen von Sprechakten auf die Imagebildung und -erhaltung
- Die spezifische Dynamik von Vorwürfen in freundschaftlichen Beziehungen
- Die pragmalinguistische Analyse von Vorwürfen in einem konkreten literarischen Beispiel (Roland Schimmelpfennigs „Peggy Pickit sieht das Gesicht Gottes“)
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 erörtert die Bedeutung des „Vorwurfs“ in Interaktionen und beleuchtet die Rolle von Sprache als Mittel der Gewaltausübung. Es werden die grundlegenden Konzepte der Sprechakttheorie und die Einordnung des „Vorwurfs“ als Sprechakt behandelt. Des Weiteren wird der „Vorwurf“ als sprachliche Gewalt analysiert, wobei die Aspekte Imageverletzung und Höflichkeit sowie die Bedingungen, Formen und Auswirkungen vorwurfsvoller Sprache betrachtet werden. Abschließend wird der Freundeskreis als besonderes psychologisches Umfeld für die Untersuchung von „Vorwürfen“ charakterisiert.
Kapitel 2 befasst sich mit der pragmalinguistischen Analyse von „Vorwürfen“ in Roland Schimmelpfennigs Drama „Peggy Pickit sieht das Gesicht Gottes“. Hier werden die Analysemethoden erläutert und die thematische Entwicklung der „Vorwürfe“ im Drama untersucht. Es wird dabei auf verschiedene Stufen des vorwurfsvollen Ausbruchs eingegangen, die jeweils eine eigene Dynamik aufweisen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen „Vorwurf“, „sprachliche Gewalt“, „Sprechakttheorie“, „Imageverletzung“, „Höflichkeit“, „Freundschaft“, „Interaktion“, „Dramenanalyse“ und „Pragmalinguistik“. Sie untersucht die Funktionsweise des Sprechakts „Vorwurf“ als Mittel der Gewaltausübung im Kontext freundschaftlicher Beziehungen und beleuchtet dessen Auswirkungen auf die Beteiligten.
- Quote paper
- Nicole Hilbig (Author), 2011, Der Sprechakt "Vorwurf" als sprachliche Gewalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172376