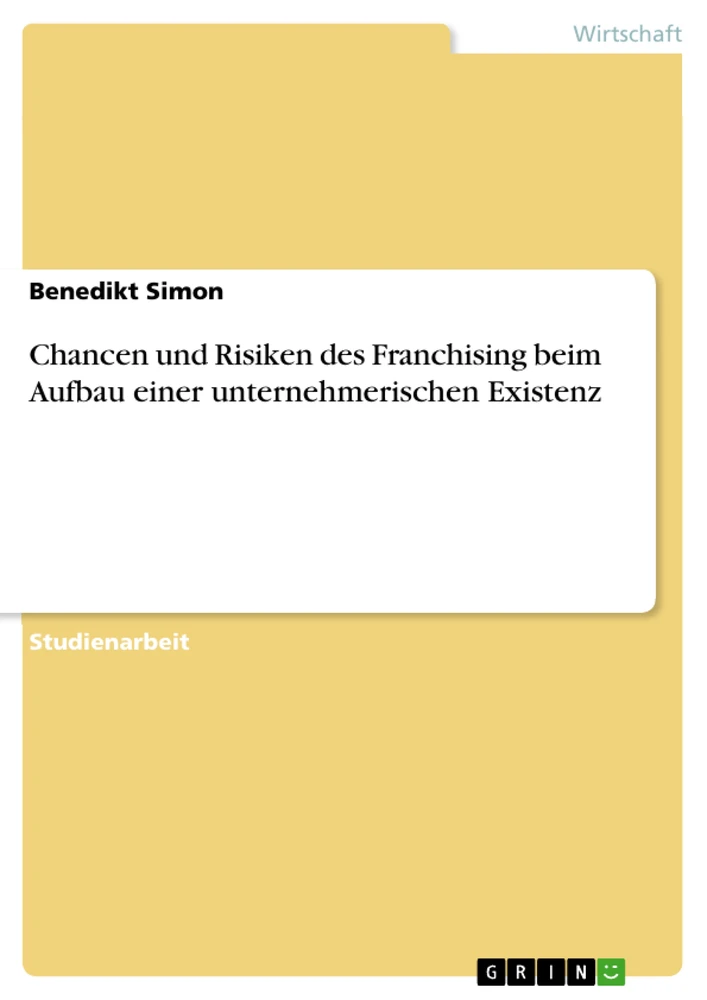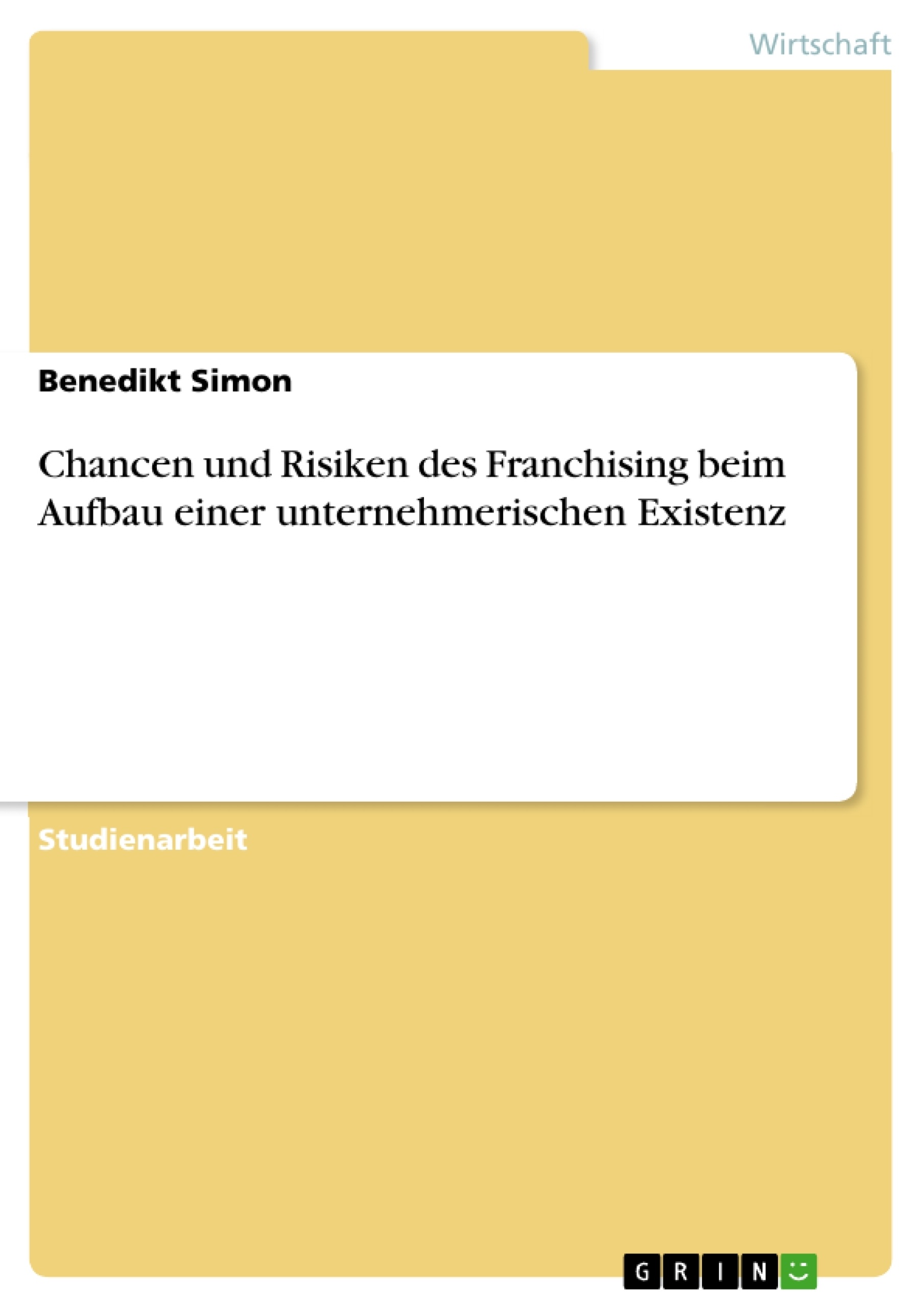Hertz, Holiday Inn, Pepsi und McDonald´s, wer kennt diese weltweit vertretenen Marken nicht? Doch worin liegt eigentlich das Erfolgsgeheimnis dieser Unternehmen und kann dieses als Wegweiser zu einer eigenen unternehmerischen Existenz dienen?
Laut dem Institut für Mittelstandsforschung in Bonn gab es im Jahr 2009 412.600 Unternehmensgründungen, gleichzeitig lagen aber auch 393.400 Unternehmensaufgaben vor. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass der Vorgehensweise eines Jungunternehmers eine große Bedeutung zugeschrieben werden muss. Eine Existenzgründung
ist mit vielen Risiken verbunden, doch können die Chancen genutzt werden, die sich aus einer Selbstständigkeit ergeben, ohne dabei ein zu hohes unternehmerisches Risiko einzugehen?
Die Lösung könnte in einem fertigen Geschäftskonzept liegen, das gegen eine Gebühr und eine Umsatzbeteiligung erworben wird. Dieses Prinzip nennt sich Franchising und erfreut sich zunehmender Beliebtheit.
Das Franchising stellt einem Existenzgründer ein bereits getestetes Marktkonzept zur Verfügung und vermittelt ihm das nötigte Know-how für eine erfolgreiche unternehmerische Zukunft. Doch die Motive einer Partnerschaft sind verschieden und bürgen somit auch Risiken für den Existenzgründer.
Diese Hausarbeit setzt sich schwerpunktmäßig mit der Frage auseinander, inwieweit das Franchising von einem Existenzgründer als Einstieg in eine Selbständigkeit genutzt werden kann. Hierfür werden zunächst die zentralen Begriffe definiert, um mögliche Missverständnisse oder auch Verständnisschwierigkeiten zu minimieren.
Daraufhin wir die Geschäftsidee des Franchising in Bezug auf den potentiellen Existenzgründer vorgestellt. Behandelt werden die Chancen und Risiken, die sich bei der Wahl des Franchising ergeben und welche Alternativen einem Existenzgründer bei dem Aufbau einer unternehmerischen Existenz zur Verfügung stehen. Die Auswahl
und die konkreten Anforderungen an einen Franchisegeber werden im vierten Kapitel entwickelt. Diese werden in einem praktischen Beispiel angewandt und anschließend kritisch bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Abgrenzung und Grundlagen
- Charakteristika von Dienstleistungen und Dienstleistungsunternehmen
- Definition und Wortursprung des Begriffes „Franchising“
- Die Geschäftsidee des Franchising
- Chancen für den Franchisenehmer
- Risiken für den Franchisenehmer
- Alternativen zum Franchising beim Aufbau einer unternehmerischen Existenz
- Vertragshändler
- Handelsvertreter
- Die Auswahl des Franchising-Partners und allgemeine Bewertung des Franchising
- Anforderungen an den Franchisegeber
- Aufbau einer unternehmerischen Existenz bei der „Kamps GmbH“
- Bewertung des Franchising als Weg zur Selbstständigkeit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit Franchising als Einstieg in die Selbstständigkeit für einen Existenzgründer genutzt werden kann. Die Arbeit analysiert Chancen und Risiken des Franchising im Vergleich zu anderen Möglichkeiten der Existenzgründung. Sie untersucht die Anforderungen an einen Franchisegeber und bewertet das Franchising-Modell anhand eines praktischen Beispiels.
- Definition und Charakteristika von Dienstleistungen und Franchising
- Chancen und Risiken des Franchising für Existenzgründer
- Alternativen zum Franchising im Kontext der Existenzgründung
- Anforderungen an einen Franchisegeber
- Bewertung des Franchising-Modells als Weg zur Selbstständigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Franchising und die Relevanz für Existenzgründer ein. Kapitel 2 definiert den Begriff „Franchising“ und beleuchtet die Charakteristika von Dienstleistungen. Kapitel 3 stellt die Geschäftsidee des Franchising vor, inklusive der Chancen und Risiken für den Franchisenehmer, sowie Alternativen zum Franchising. Kapitel 4 befasst sich mit der Auswahl des Franchising-Partners, den Anforderungen an einen Franchisegeber und bietet eine praktische Beispielanalyse anhand der „Kamps GmbH“. Die Arbeit fokussiert auf die Analyse des Franchising-Modells im Kontext der Existenzgründung und die Möglichkeiten der Selbstständigkeit.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind: Franchising, Existenzgründung, Dienstleistung, Chancen, Risiken, Franchisegeber, Franchisepartner, Selbstständigkeit, Alternativen, Vertragshändler, Handelsvertreter.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Franchising?
Franchising ist ein Prinzip, bei dem ein Existenzgründer gegen Gebühr und Umsatzbeteiligung ein bereits getestetes Geschäftskonzept und Know-how eines Franchisegebers nutzt.
Welche Chancen bietet Franchising für Existenzgründer?
Es bietet ein fertiges Markkonzept, minimiert das Risiko durch erprobtes Wissen und ermöglicht einen schnelleren Markteintritt unter einer bekannten Marke.
Welche Risiken sind mit Franchising verbunden?
Risiken bestehen in der Abhängigkeit vom Franchisegeber, den laufenden Kosten (Gebühren/Umsatzbeteiligung) und möglichen Fehlentscheidungen des Systemzentrums.
Welche Alternativen gibt es zum Franchising?
Alternativen zum Aufbau einer unternehmerischen Existenz sind unter anderem die Tätigkeit als Vertragshändler oder als Handelsvertreter.
Worauf sollte man bei der Auswahl eines Franchisegebers achten?
Wichtig sind die konkreten Anforderungen an den Partner, die Stabilität des Systems und die Unterstützung bei der Existenzgründung, wie am Beispiel der Kamps GmbH gezeigt wird.
Wie hoch ist die Erfolgsquote bei Unternehmensgründungen?
Statistiken zeigen, dass die Zahl der Aufgaben oft fast so hoch ist wie die der Neugründungen, weshalb die Wahl der richtigen Strategie (z.B. Franchising) entscheidend ist.
- Citation du texte
- Benedikt Simon (Auteur), 2010, Chancen und Risiken des Franchising beim Aufbau einer unternehmerischen Existenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172397